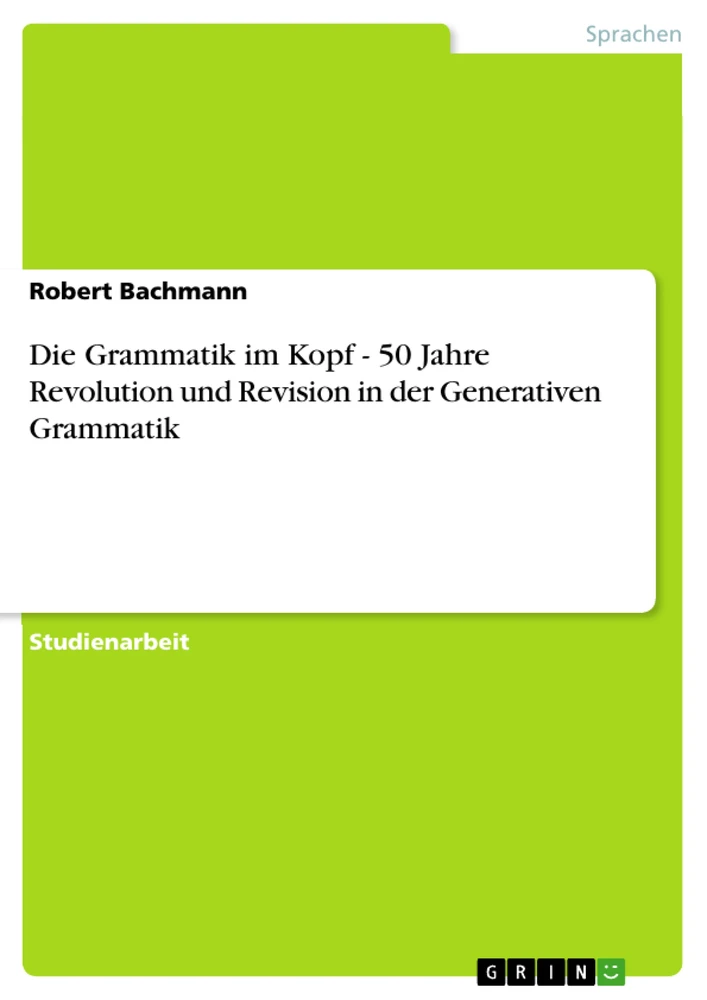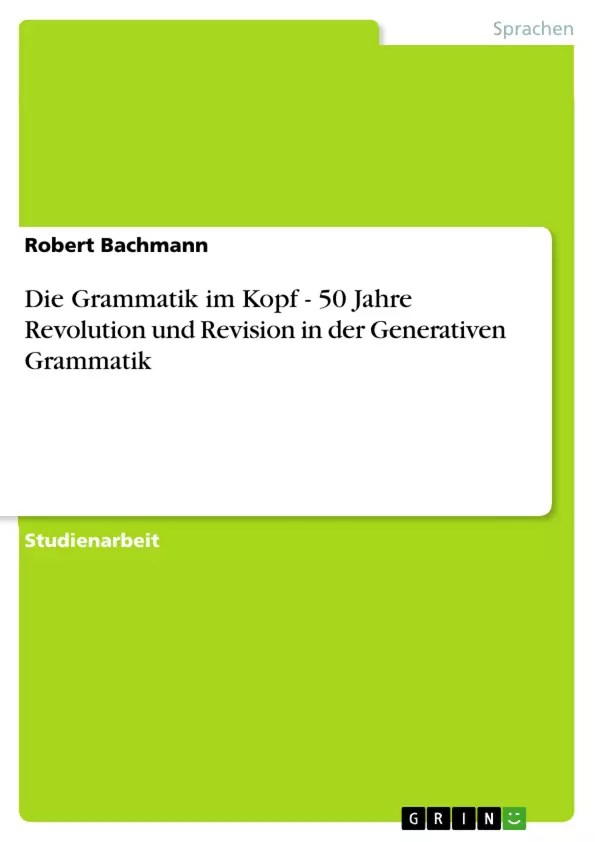Aus der Einleitung: „Was weiss jemand oder hat jemand im Kopf, der eine Sprache, z.B. die deutsche Sprache, beherrscht?“ (Angelika Linke, Markus Nussbaumer, Paul R. Portmann: Studienbuch Linguistik. 5., erweiterte Auflage. Tübingen: Max Niemeyer Verlag 2004. S. 103.)
Seit nahezu über einem halben Jahrhundert steht diese Frage im Zentrum einer der prominentesten Richtungen moderner grammatiktheoretischer Ansätze. Mit der Veröffentlichung der syntactic structures begründet Noam Chomsky 1957 die Generative Grammatik. Mit seiner Betrachtung der Grammatik, sowie der Sprache überhaupt, geht eine radikale Neuorientierung in der Linguistik einher. Insbesondere die Abwendung vom bis dato vorherrschenden Strukturalismus hin zur Erforschung der Spracherzeugung im Kopf des Menschen, als Ausgangspunkt syntaktischer Untersuchungen an sich, sind wesentliche Eckpunkte des generativen Theoriegerüsts. So revolutionär diese Idee ist, so schwierig stellt sich das Unterfangen auch dar. Günther Grewendorf bezeichnet es in seiner Abhandlung über das linguistische Gesamtwerk Chomskys nicht ohne Hintergrund als Das generative Unternehmen. Der universalistische Anspruch der Generativen Grammatik und das Ziel, eine Grammatik zu modellieren, die der kognitiven Realität – d.h. dem tatsächlichen menschlichen Sprachverarbeitungssystem – entspricht, sind sehr hoch gesteckt und stellen den Linguisten vor enorm komplexe Probleme. Jeder Entwurf gab immer auch Anlass zur Kritik. Es ist daher nicht nur der lange Zeitraum, den die Forschung nun schon andauert, sondern vor allem auch die zahlreichen Verwürfe und Neukonzipierungen innerhalb der generativen Theoriebildung, welche die Entwicklungsgeschichte der Generativen Grammatik ungemein prägen.
Im Folgenden soll diese Entwicklungsgeschichte von den Anfängen bis zu den neueren Ansätzen skizziert werden. Das Ziel dabei ist nicht, eine umfassende Übersicht jeder einzelnen Phase zu bieten. Vielmehr soll herausgestellt werden, welchen Weg die Generative Grammatik verfolgt und worin sich die Triebkraft der ständigen Weiter- und Neuentwicklungen begründet. Auf die genaue Erläuterung jedes einzelnen Details der verschiedenen Modelle muss aus diesem Grund verzichtet werden. Im Fokus der Darstellung sollen eher die wesentlichen Grundgedanken und Zielsetzungen der jeweiligen Konzeptionen stehen, unter der Fragestellung, welche generelle Programmatik sich daraus ableiten lässt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Phase 1 – Harris, Chomsky und die Transformation
- Phase 2 - Adäquate Grammatik im Standardmodell
- Grundgedanken weiterer Entwicklungen
- UG- Grammatik und Genetik
- X' und move a - einfache Syntax (?)
- Operation am grammatischen Blinddarm – Das minimalistische Programm
- Fazit.....
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Dieser Text verfolgt das Ziel, die Entwicklungsgeschichte der Generativen Grammatik von ihren Anfängen bis zu den neueren Ansätzen zu skizzieren. Dabei soll gezeigt werden, welchen Weg die Generative Grammatik verfolgt und worin sich die Triebkraft der ständigen Weiter- und Neuentwicklungen begründet.
- Die Entstehung der Generativen Grammatik und ihre Abgrenzung vom Strukturalismus
- Die Transformationstheorie von Harris und Chomskys Beitrag zur Generativen Grammatik
- Die Entwicklung des Standardmodells der Generativen Grammatik und seine Kernprinzipien
- Das minimalistische Programm und seine Veränderungen in der generativen Theoriebildung
- Die zentralen Fragestellungen und Herausforderungen der Generativen Grammatik
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Dieser Abschnitt stellt die zentrale Frage nach dem Wissen, das ein Sprecher über die deutsche Sprache besitzt, und führt in die Thematik der Generativen Grammatik ein. Er beschreibt die Bedeutung von Noam Chomsky und die Revolution, die er mit seinem Werk „Syntactic Structures“ in der Linguistik auslöste. Außerdem wird auf die Herausforderungen und die lange Entwicklungsgeschichte der Generativen Grammatik hingewiesen.
Phase 1 – Harris, Chomsky und die Transformation
Dieser Abschnitt beleuchtet die Anfänge der Generativen Grammatik und die Rolle von Zellig Harris, dem Lehrer Chomskys. Er erklärt die Entwicklung des Transformationsbegriffs und die Bedeutung der Transformationen für die Beschreibung von syntaktischen Beziehungen zwischen Sätzen. Es wird anhand eines Beispiels (Aktiv- und Passivkonstruktionen) gezeigt, wie Transformationen die Umformung von Satzstrukturen beschreiben.
Phase 2 - Adäquate Grammatik im Standardmodell
Dieser Abschnitt behandelt die Weiterentwicklung der Generativen Grammatik zum Standardmodell. Es werden die wichtigsten Elemente des Standardmodells, wie die Unterscheidung zwischen Oberflächenstruktur und Tiefenstruktur, sowie die Rolle von Transformationsregeln erläutert.
Schlüsselwörter
Generative Grammatik, Syntaktische Strukturen, Transformationen, Standardmodell, Minimalistisches Programm, Sprachverarbeitung, Sprachproduktion, Universalgrammatik, Kognition, Syntax, Semantik, Linguistik.
Häufig gestellte Fragen
Wer begründete die Generative Grammatik?
Noam Chomsky begründete die Generative Grammatik im Jahr 1957 mit der Veröffentlichung seines Werkes „Syntactic Structures“.
Was ist das Kernziel der Generativen Grammatik?
Ziel ist es, ein Modell zu entwerfen, das der kognitiven Realität des menschlichen Sprachverarbeitungssystems im Kopf entspricht.
Wie grenzt sich Chomsky vom Strukturalismus ab?
Chomsky wandte sich von der reinen Beschreibung sprachlicher Strukturen ab und konzentrierte sich stattdessen auf die Erforschung der Spracherzeugung im Gehirn.
Was versteht man unter dem „Minimalistischen Programm“?
Es ist eine neuere Phase der Theoriebildung, die darauf abzielt, die Grammatik auf ihre absolut notwendigen Bestandteile zu reduzieren (ökonomisches Prinzip).
Was unterscheidet Tiefenstruktur von Oberflächenstruktur?
Im Standardmodell ist die Tiefenstruktur die abstrakte semantische Basis eines Satzes, während die Oberflächenstruktur die tatsächlich gesprochene oder geschriebene Form darstellt.
Was ist die Universalgrammatik (UG)?
Die UG ist die Theorie, dass Menschen über ein angeborenes biologisches Sprachvermögen verfügen, das die Grundprinzipien aller menschlichen Sprachen enthält.
- Citar trabajo
- Robert Bachmann (Autor), 2007, Die Grammatik im Kopf - 50 Jahre Revolution und Revision in der Generativen Grammatik , Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/172723