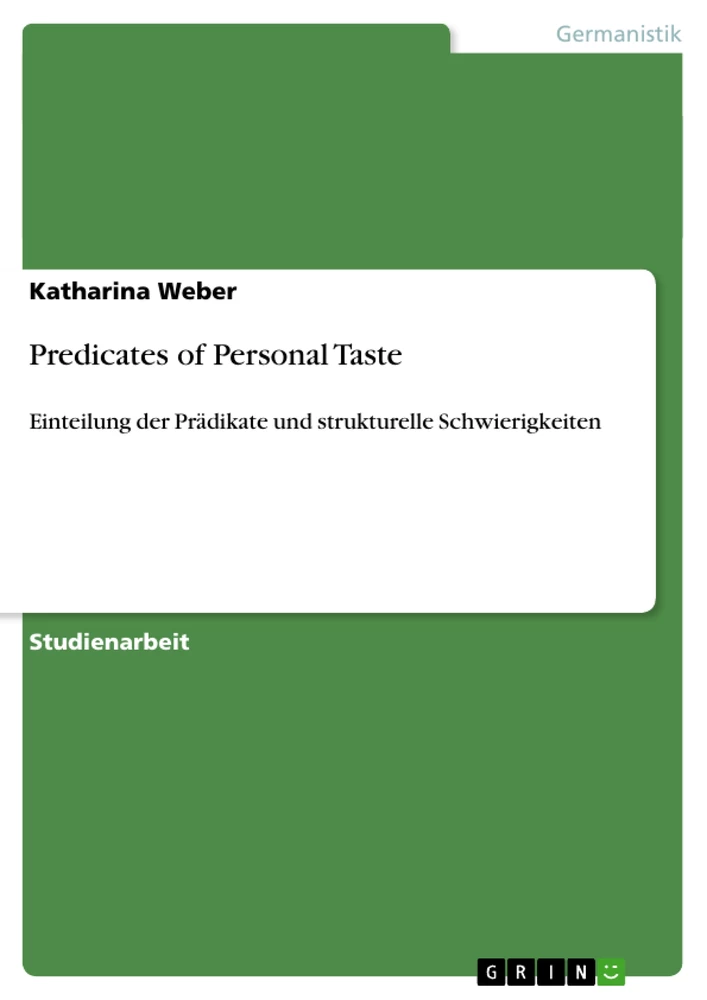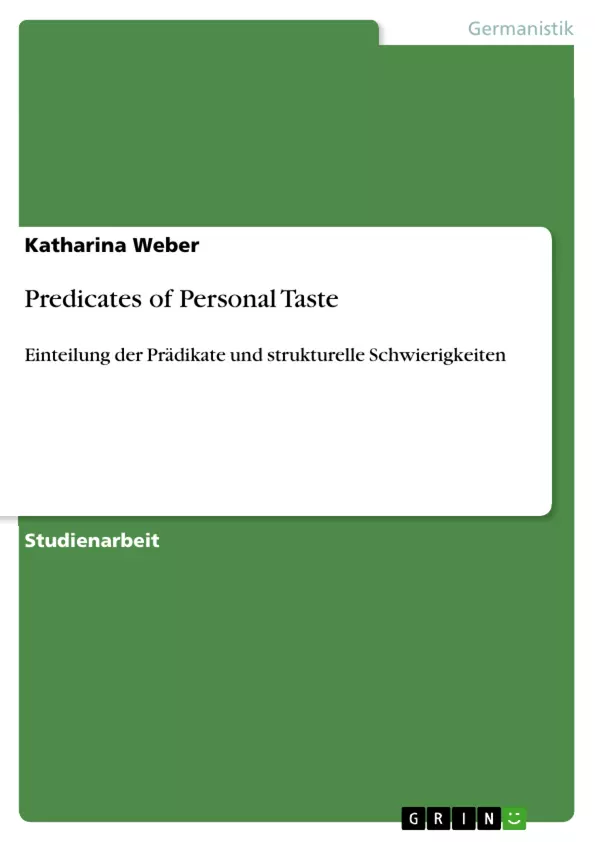(1) A: Die Pizza ist lecker. p
B: Die Pizza ist nicht lecker. ¬ p
(2) A: Hans ist groß. p
B: Hans ist nicht groß. ¬ p
(3) A: Anna ist schwanger. p
B: Anna ist nicht schwanger. ¬ p
Wer hat Recht, Sprecher A oder B?
Wenn in Beispiel 3 einer der beiden Sprecher Recht hat, muss der andere Unrecht haben. Entweder ist Anna schwanger oder eben nicht. Beide Aussagen zusammen führen zu einem Widerspruch (p ˄ ¬p), p und ¬p können nicht gleichzeitig gelten. In Beispiel 2 lässt sich allerdings nicht eindeutig entscheiden, ob einer der beiden Sprecher Recht hat.
Intuitiv würde man vermuten, dass die beiden Urteile aus verschiedenen Perspektiven gefällt worden sind und sich die Maßstäbe von Sprecher A und B unterscheiden. Auch in Beispiel 1 ist es schwierig, sogar unmöglich, einem Sprecher Recht zu geben. (p ˄ ¬p)bilden hier keine Kontradiktion mehr, sondern es ist "halt Geschmackssache". Das relationale Verhältnis der drei Beispiele scheint sich zu verändern. Erstaunlich, denn prima facie wirken Beispiel 1, 2 und 3 strukturell identisch. Worin liegt also der semantische Unterschied, der Beispiel 3 widersprüchlich macht und Beispiel 1 und 2 nicht?
Inhaltsverzeichnis (Table of Contents)
- 1. Einführung
- 2. Einteilung der Prädikate
- 2.1 Graduierbare Prädikate
- 2.1.1 Predicates of Personal Taste (PTS)
- 2.1.2 Vage Prädikate
- 2.2 Nicht-graduierbare Prädikate
- 3. Proben und versteckte Vergleiche
- 3.1 Ergänzungsprobe mit finden
- 3.2 Gradpartikel zu
- 3.3 Modalverben
- 4. Tabelle
- 5. Strukturelle Unterschiede
- 5.1 0-Rolle
- 5.2 Dativ-Argumente
- 6. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte (Objectives and Key Themes)
Diese Arbeit untersucht die semantische Unterscheidung zwischen graduierbaren und nicht-graduierbaren Prädikaten, insbesondere die Rolle von "Predicates of Personal Taste" (PTS). Sie analysiert, wie subjektive Bewertungen und versteckte Vergleiche in sprachlichen Konstruktionen zum Ausdruck kommen.
- Unterscheidung zwischen graduierbaren und nicht-graduierbaren Prädikaten
- Analyse der Merkmale und Eigenschaften von PTS
- Bedeutung von subjektiven Bewertungen und versteckten Vergleichen in der Sprache
- Rolle von Gradpartikeln und Modalverben in Bezug auf Graduierbarkeit
- Strukturelle Unterschiede und semantische Implikationen
Zusammenfassung der Kapitel (Chapter Summaries)
- Kapitel 1: Einführung: Dieser Abschnitt führt in das Thema der Prädikate ein und stellt anhand von Beispielen den Unterschied zwischen objektiven und subjektiven Urteilen dar. Die Frage nach dem semantischen Unterschied zwischen Beispielen mit objektiv feststellbaren Sachverhalten und Beispielen, die auf persönlicher Einschätzung beruhen, wird aufgeworfen.
- Kapitel 2: Einteilung der Prädikate: Hier werden graduierbare und nicht-graduierbare Prädikate unterschieden. Die Kategorie der "Predicates of Personal Taste" (PTS) wird eingeführt und ihre Merkmale, wie Subjektivität und fehlender eindeutiger Wahrheitsgehalt, werden erläutert. Vage Prädikate werden als eine Sonderform der graduierbaren Prädikate vorgestellt.
- Kapitel 3: Proben und versteckte Vergleiche: In diesem Kapitel werden verschiedene Tests vorgestellt, um zu überprüfen, ob ein Prädikat graduierbar ist. Die Ergänzungsprobe mit "finden" und die Verwendung der Gradpartikel "zu" werden analysiert. Der Zusammenhang zwischen diesen Tests und versteckten Vergleichen wird aufgezeigt.
Schlüsselwörter (Keywords)
Graduierbare Prädikate, nicht-graduierbare Prädikate, Predicates of Personal Taste (PTS), subjektive Bewertung, versteckter Vergleich, Gradpartikel, Modalverben, semantische Analyse, Sprachphilosophie.
Häufig gestellte Fragen
Was sind „Predicates of Personal Taste“ (PTS)?
PTS sind Prädikate wie „lecker“ oder „schön“, deren Wahrheitsgehalt von der subjektiven Perspektive des Sprechers abhängt und keinen objektiven Standard hat.
Wie unterscheiden sich PTS von objektiven Prädikaten?
Während objektive Aussagen (z. B. „Anna ist schwanger“) einen klaren Widerspruch erzeugen, führen unterschiedliche Meinungen bei PTS (z. B. „Die Pizza ist lecker“) nicht zu einer echten Kontradiktion.
Was ist ein vages Prädikat?
Ein vages Prädikat wie „groß“ ist graduierbar, hängt aber oft von einem Vergleichsmaßstab ab, der je nach Kontext variieren kann (z. B. groß für ein Kind vs. groß für einen Basketballspieler).
Wie kann man Graduierbarkeit sprachlich testen?
Mithilfe der Ergänzungsprobe mit „finden“ (z. B. „Ich finde das lecker“) oder durch Gradpartikel wie „sehr“ oder „zu“.
Warum sind PTS für die Sprachphilosophie interessant?
Sie werfen Fragen nach der Natur von Wahrheit und Relativismus auf, da zwei Sprecher sich scheinbar widersprechen können, ohne dass einer von beiden „Unrecht“ hat.
- Arbeit zitieren
- Katharina Weber (Autor:in), 2011, Predicates of Personal Taste, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/172786