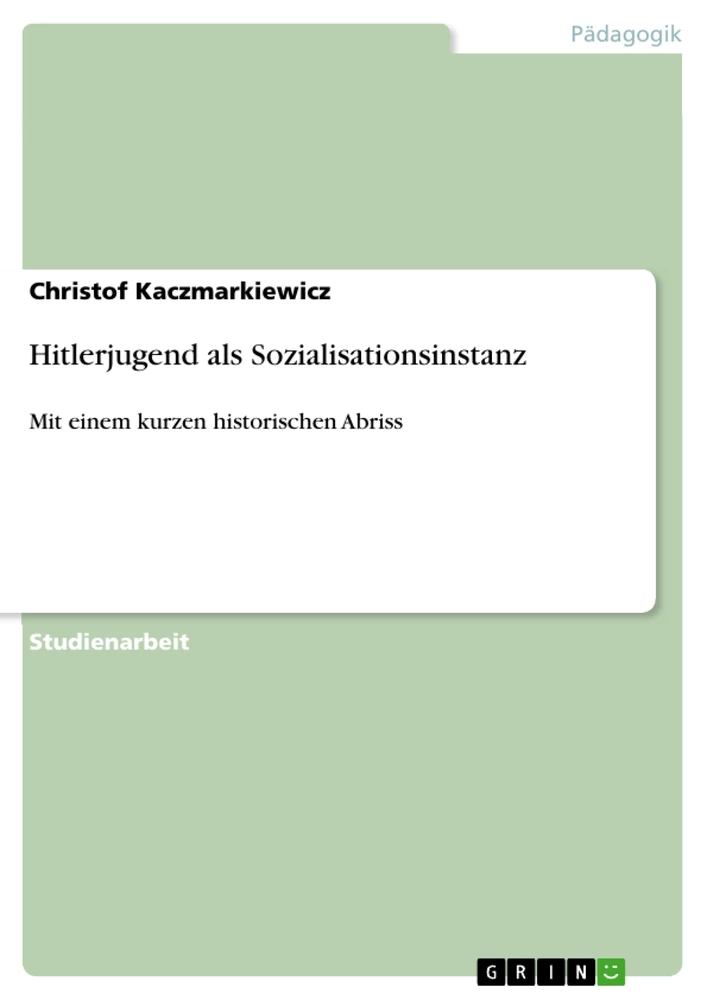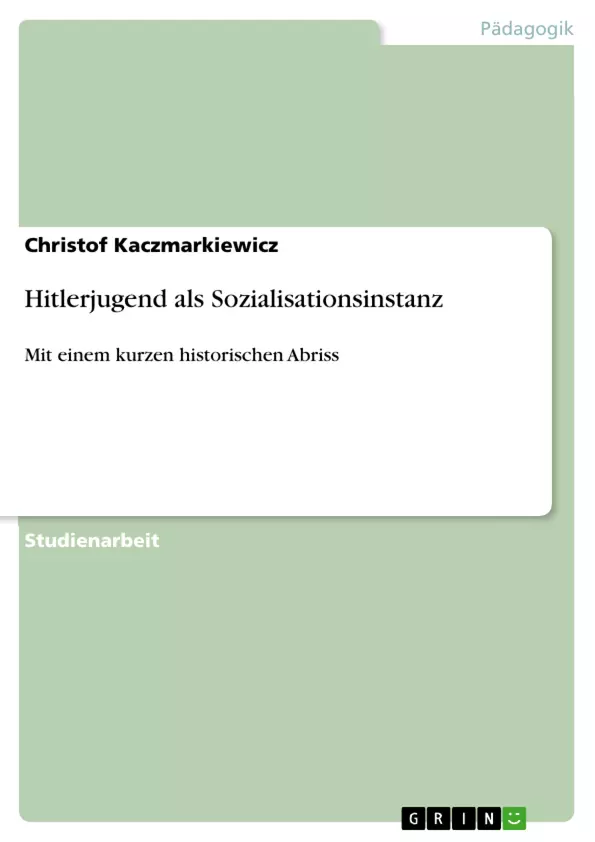Eine Hausarbeit über die Hitlerjugend als Sozialisationsinstanz mit einem kurzen historischen Abriss der Geschichte dieser Organisation. Beleuchtung des Lebens in der HJ anhand von Dienst und Widerstand unter Nutzung von Zeitzeugenberichten und Metaanalysen.
Inhaltsverzeichnis (Table of Contents)
- Abkürzungsverzeichnis
- Abbildungsverzeichnis
- 1. Einleitung
- Thema
- Fragestellung
- Vorgehen
- Gliederung
- 2. Sozialisation und Sozialisationsinstanzen
- 3. Die HJ als Organisation
- a. Historische Genese
- Vorgeschichte
- Die HJ als Jugendorganisation der NSDAP (1926 - 1939)
- Die HJ als Staatsjugend (1939 - 45)
- b. Auftrag und Ziele der HJ
- 4. Der Dienst in der HJ
- Inhalte
- Sondergruppierungen
- Jugend führt Jugend
- 5. Widerstand gegen die HJ
- a. Formen des Widerstandes
- b. Mittel der Disziplinierung in der HJ
- 6. Diskussion
- 7. Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte (Objectives and Key Themes)
Diese Arbeit befasst sich mit der Hitlerjugend, einer der bestimmenden Organisationen für Kinder und Jugendliche im Dritten Reich, und untersucht deren Entwicklung von einer Jugendorganisation der NSDAP zur Staatsjugend. Die Arbeit analysiert die dienstlichen Verpflichtungen der Mitglieder, die Disziplinarmittel bei Zuwiderhandlungen und den Widerstand gegen die HJ.
- Die Entwicklung der HJ von einer Parteijugend zur Staatsjugend
- Der Dienst in der HJ und dessen Einfluss auf die Jugend
- Die ideologischen und körperlichen Ausbildungen der HJ
- Widerstand gegen die HJ und die Reaktion des NS-Staates
- Die Rolle der HJ in der Sozialisation der Jugend
Zusammenfassung der Kapitel (Chapter Summaries)
Das zweite Kapitel erklärt die Begriffe Sozialisation und Sozialisationsinstanz. Das dritte Kapitel zeichnet die Geschichte der HJ nach, von ihrer Entstehung als Parteijugend der NSDAP bis zu ihrer Umwandlung in die Staatsjugend. Das vierte Kapitel beschreibt den Dienst in der HJ und seine Inhalte, darunter sportliche Aktivitäten, ideologische Ausbildung und Sondergruppierungen. Das fünfte Kapitel untersucht den Widerstand gegen die HJ und die Methoden der Disziplinierung, die von der Organisation angewandt wurden.
Schlüsselwörter (Keywords)
Hitlerjugend, NSDAP, Staatsjugend, Sozialisation, Jugendorganisation, Dienst, Widerstand, Disziplinierung, Erziehung, Nationalsozialismus, Drittes Reich, Jugendbewegung, Sozialisationsinstanzen.
Häufig gestellte Fragen
Welche Funktion hatte die Hitlerjugend im Nationalsozialismus?
Die HJ diente als zentrale Sozialisationsinstanz zur ideologischen Formung und körperlichen Ertüchtigung der Jugend im Sinne der NS-Ideologie.
Wie entwickelte sich die HJ zur Staatsjugend?
Ursprünglich als Parteijugend der NSDAP gegründet, wurde sie ab 1939 per Gesetz zur Staatsjugend, in der die Mitgliedschaft für alle Jugendlichen verpflichtend war.
Was beinhaltete der Dienst in der HJ?
Der Dienst umfasste Geländespiele, Sport, ideologische Schulungen sowie Tätigkeiten in Sondergruppierungen (z.B. Flieger-HJ oder Marine-HJ).
Gab es Widerstand gegen die Hitlerjugend?
Ja, es gab verschiedene Formen des Widerstands, von passiver Verweigerung bis hin zur Bildung oppositioneller Jugendgruppen wie den Edelweißpiraten.
Mit welchen Mitteln wurde die Disziplin in der HJ aufrechterhalten?
Der NS-Staat setzte verschiedene Disziplinierungsmittel ein, die von sozialem Druck innerhalb der Gruppe bis hin zu staatlichen Strafmaßnahmen reichten.
- Quote paper
- Christof Kaczmarkiewicz (Author), 2010, Hitlerjugend als Sozialisationsinstanz, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/172902