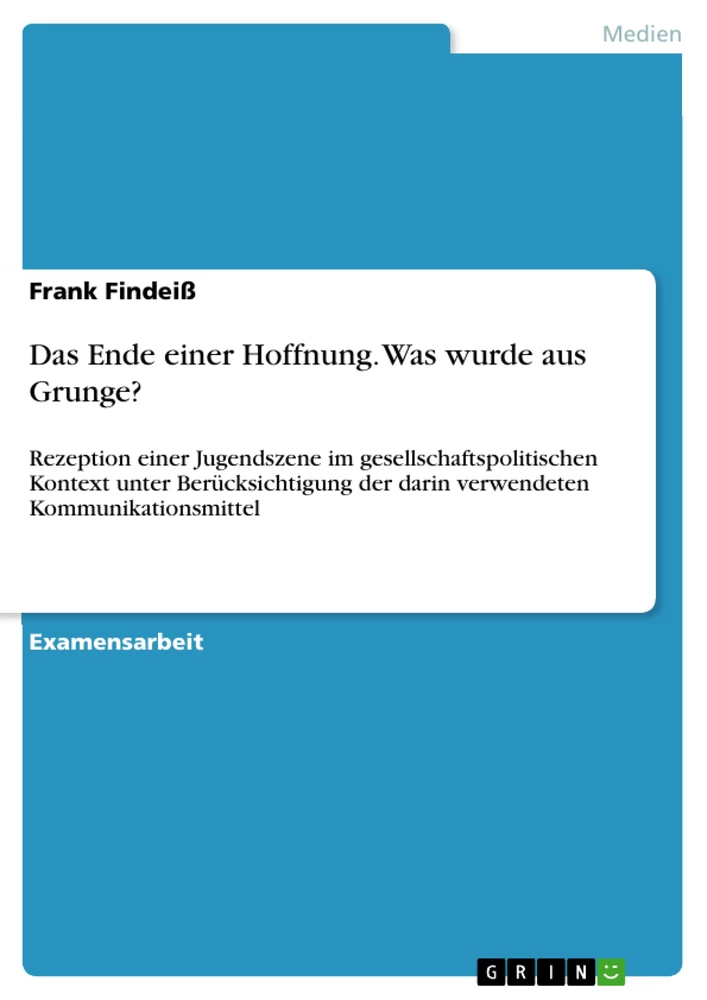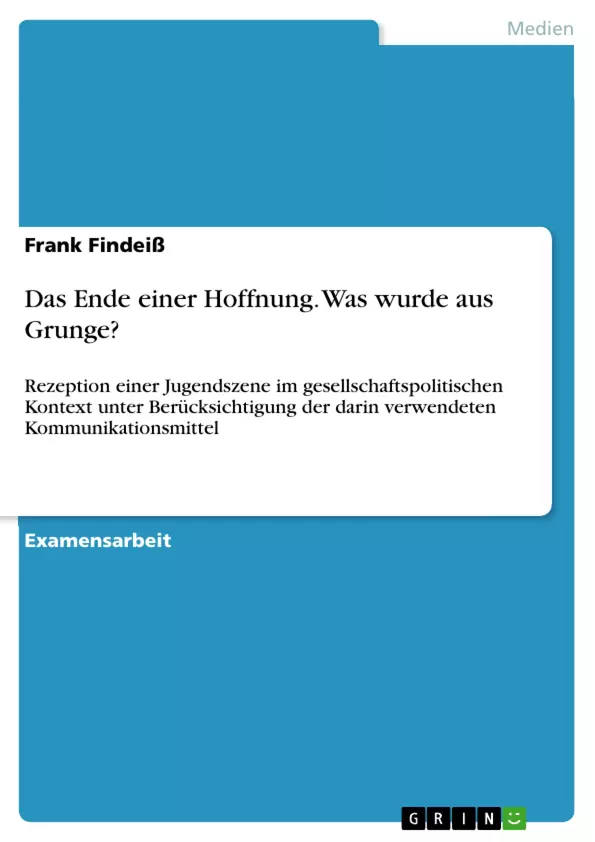Grunge ist ein Jugendphänomen, das sich in erster Linie über die Musik artikuliert. Es hatte ab Beginn der 80er Jahre eine Vorlaufzeit, die man als Pre-Grunge-Ära bezeichnen kann und die bis ca. 1985 dauerte. Ab 1986 wurde der sich langsam zur Szene verdichtende, mittlerweile als Grunge bezeichnete Underground durch das Platten-Label Sub Pop von Seattle in den USA ausgehend vermarktet. 1988 trat das Phänomen seinen Siegeszug auch auf dem europäischen Kontinent an, bevor es im November 1991 mit der Veröffentlichung des Werkes „Nevermind“ der Gruppe Nirvana weltweit seinen Durchbruch erlebte. Nach dem Selbstmord des Sängers dieser Gruppe, Kurt Cobain, im April 1994 verschwand das Phänomen aus dem öffentlichen Bewusstsein.
Die vorliegende Arbeit zeigt zunächst auf, wodurch sich eine Jugendkultur kennzeichnet und stellt fest, dass Grunge dem Status einer Jugendkultur nicht gerecht wird, sondern als Szene betrachtet werden muss (Kapitel 1). Ferner war Grunge das Produkt der Generation X, die von einem stark innerlich zerrissenen Charakter und Melancholie geprägt war, deren Gründe sowohl in gesellschaftlichen, wie auch wirtschaftlichen und politischen Veränderungen gesehen werden können (Kapitel 2.1 bis 2.3). Dabei wurde das mit Grunge transportierte Lebensgefühl einer „Verlierer-Generation“, das lediglich für kurze Zeit auf Grund des Erfolges einiger Vertreter des Grunge einen Hoffnungsschimmer aufkeimen ließ, schließlich durch den Ausverkauf der Szene begünstigt, weshalb ihr der Makel eines Hypes angeheftet wurde (Kapitel 2.4). Die in der Szene verwendeten Kommunikationsstilmittel trugen der inneren Haltung, die sich sowohl an einem einfachen Leben orientierte als auch durch äußere Faktoren geprägt war und der mit ihr verbundenen Ideologie Rechnung (Kapitel 3). Vor dem Hintergrund des in Kapitel 1 bis 3 Gesagten wird deutlich, dass Grunge zum einen Independent-Labels (also unabhängigen Musikproduktionsfirmen) zum Aufstieg in den Mainstream verhalf und zum anderen zu einer Stilvermischung beitrug, in deren Zuge neue Richtungen, wie der Nu Metal entstanden (Kapitel 4).
Inhaltsverzeichnis (Table of Contents)
- Einleitung
- Von der Jugendkultur zur Szene
- Die Bedeutung von Jugendkulturen
- Die Entstehung von Szenen
- Die Generation X
- Der Einfluss der Baby-Boomer (Yuppies)
- Das gesellschaftspolitische Erbe der 80er Jahre
- Kristallisationspunkt Seattle
- Die Rolle der Musikindustrie
- Authentizität als Reaktion gegen das Rockbusiness
- Die Vermarktung der Authentizität durch Sub Pop
- Kommunikationsstilmittel im Grunge
- Musik/ Tanz
- Ideologie/ Werte
- Kleidung/ Mode
- Schluss und Ausblick: Was wurde aus Grunge?
Zielsetzung und Themenschwerpunkte (Objectives and Key Themes)
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit dem Jugendphänomen Grunge, das sich in erster Linie über Musik artikuliert und in den 1990er Jahren seinen Höhepunkt erreichte. Die Arbeit analysiert die Entstehung, Entwicklung und Kommunikationsstilmittel der Grunge-Szene. Sie beleuchtet die Rolle der Generation X, die sozio-politischen Einflüsse der 1980er Jahre und die Vermarktung durch das Independent-Label Sub Pop.
- Die Abgrenzung von Jugendkultur und Szene
- Der Einfluss der Generation X und ihrer pessimistischen Grundhaltung
- Die Rolle der Musikindustrie und die Vermarktung von Authentizität
- Die Kommunikationsstilmittel von Grunge in Musik, Tanz, Ideologie und Mode
- Die Auflösung des Mainstreams und die Entstehung neuer Musikrichtungen wie Nu Metal
Zusammenfassung der Kapitel (Chapter Summaries)
- Einleitung: Die Einleitung stellt Grunge als Jugendphänomen dar und skizziert seine Entstehungsgeschichte.
- 1. Von der Jugendkultur zur Szene: Dieses Kapitel unterscheidet zwischen Jugendkultur und Szene und argumentiert, dass Grunge eher als Szene betrachtet werden sollte. Es werden Merkmale und Bedeutung von Jugendkulturen erläutert.
- 2. Die Generation X: Dieses Kapitel analysiert die Generation X, die mit dem Grunge-Phänomen assoziiert wird. Es wird erläutert, wie die Generation X durch die Baby-Boomer, die sozio-politischen Entwicklungen der 1980er Jahre und die spezifischen Lebensumstände in Seattle geprägt wurde.
- 3. Kommunikationsstilmittel im Grunge: Dieses Kapitel beleuchtet die Musik, den Tanz, die Ideologie und die Mode der Grunge-Szene. Es wird erläutert, wie diese Elemente die innere Haltung und das Lebensgefühl der Szene widerspiegeln.
Schlüsselwörter (Keywords)
Grunge, Jugendkultur, Szene, Generation X, Baby-Boomer, Seattle, Sub Pop, Musikindustrie, Authentizität, Kommunikationsstilmittel, Musik, Tanz, Ideologie, Mode, Nu Metal, Independent-Labels, Alternative Rock, Medienkonstrukt.
- Quote paper
- M. A. Frank Findeiß (Author), 2010, Das Ende einer Hoffnung. Was wurde aus Grunge?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/172926