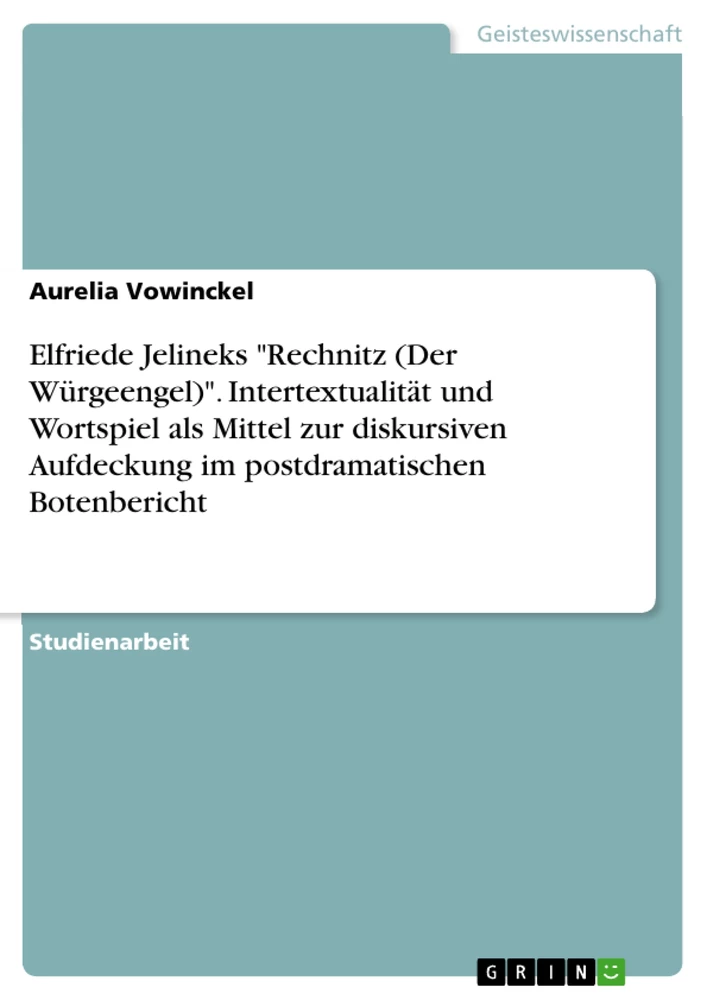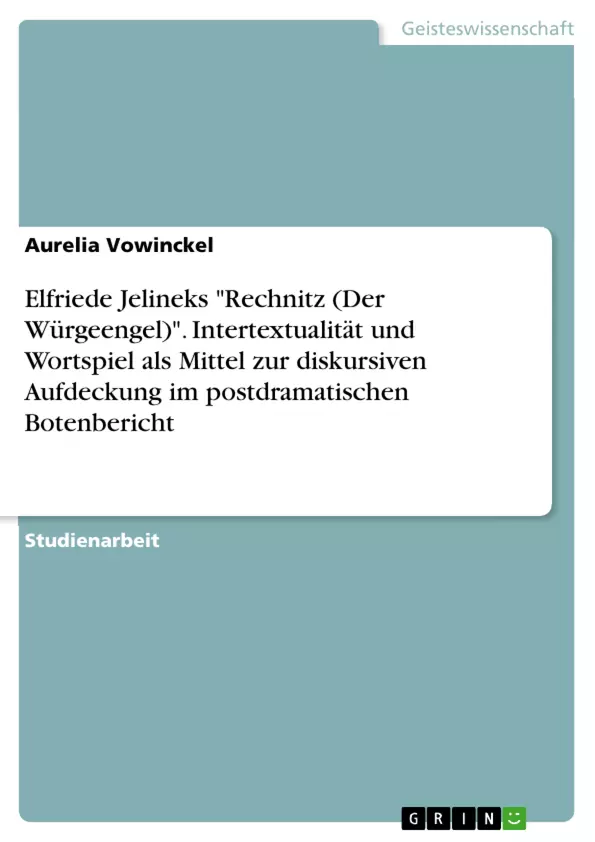Die 1946 in der Steiermark/Österreich geborene Schriftstellerin Elfriede Jelinek ist seit den 70er Jahren ein steter Bestandteil der deutschsprachigen Theaterlandschaft – die Ursache ihrer Öffentlichkeitswirkung lässt sich jedoch nicht allein auf ihre (beizeiten feministische) Literatur und den eigenwilligen Lebensstil, der zwar ihre intellektuelle, jedoch nicht physische Präsenz, zulässt, zurückführen. Ihr konsequentes Vorhaben zu widersprechen, sich nicht anzupassen und dem allgemeinen Duktus der deutschsprachigen Autorenschaft bereitwillig abzusagen, scheint mit ein Grund dafür zu sein, dass ihr Engagement für die Aufarbeitung von Geschichte und gesellschaftlicher Missstände, sowie ihre Beteiligung im Gender Diskurs kritischer gehört wird als das von manch Anderem. Es ist also kein Wunder, dass die Österreicherin mit der Tolle und den französischen Zöpfen sich zwar einerseits der Öffentlichkeit entzieht , sich andererseits jedoch in hohem Maße an der öffentlichen Diskussion um Vergangenheitsbewältigung, vornehmlich jene um die Zeit des NS-Regimes und die der RAF, beteiligt – auf ihre individuelle und bestimmte Weise. Rechnitz (Der Würgeengel) entstand 2008 für die Münchner Kammerspiele, als Auftragswerk. Der Ausgangspunkt: Ein Stück für die Bühne, das auf Buñuels Film Der Würgeengel (1962) Bezug nehmen sollte. Das Ereignis, auf das sich der Theatertext bezieht, ist ein nationalistisches Gefolgschaftsfest am Abend des 24. März 1945, das im Burgenländischen Rechnitz im Schloß der Batthyány-Thyssen-Dynastie abgehalten wurde. Im Verlauf des Abends wurden 180 arbeitsunfähige ungarisch-jüdiusche Zwangsarbeiter im Ortskern von Gästen des Festes erschossen und notdürftig verscharrt. Am darauf folgenden Tag wurden weitere Erschießungen vorgenommen; im Zuge dessen wurden alle Leichen in Massengräber verfrachtet – diese sind bis heute nicht auffindbar. Nicht nur die Tatsache der Unauffindbarkeit der Massengräber, sondern vor Allem die Brutalität und das Kalkül, das bei diesem NS-Verbrechen vorherrscht, machen das Massaker von Rechnitz bis heute zu einem viel diskutierten Verbrechen. In welcher Form Informationen und Positionen vertreten und vermittelt werden ergründet Jelinek in Rechnitz (Der Würgeengel). Wie sich dieser Diskurs konstituiert und welche intertextuellen Bezüge primär von Bedeutung sind, soll an ausgewählten Beispielen dargestellt werden.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. „Sie hörten soeben unsere tägliche Sendung von der Banalität des Bösen“. Intertextualität und historische Verwertungsmaschinerie
- 3. Theaterkonvention Botenbericht
- 3.1 Der Bote als Medium
- 3.2 Das Problem der Neutralität
- 4. Fazit
- 5. Anhang
- 5.1 Primärliteratur
- 5.2 Sekundärliteratur
- 5.3 Sonstiges Quellenverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit untersucht Elfriede Jelineks Theatertext „Rechnitz (Der Würgeengel)“ im Hinblick auf seine intertextuellen Bezüge und die Verwendung der Botenbericht-Konvention. Ziel ist es, die diskursive Aufdeckung des Massakers von Rechnitz und die damit verbundenen historischen und gesellschaftlichen Missstände zu analysieren. Die sprachliche Gestaltung und die Abweichung von dramatischen Konventionen werden dabei ebenfalls berücksichtigt.
- Intertextualität und historische Verwertung
- Die Funktion des Botenberichts im postdramatischen Theater
- Aufarbeitung des Massakers von Rechnitz und die NS-Vergangenheit
- Sprachliche Gestaltung und ihre Bedeutung für den Diskurs
- Brechung dramatischer Konventionen
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik ein und stellt Elfriede Jelinek und ihr Werk im Kontext der deutschsprachigen Theaterlandschaft vor. Sie betont Jelineks Engagement für die Aufarbeitung von Geschichte und gesellschaftlichen Missständen, insbesondere im Hinblick auf das NS-Regime. Der Fokus wird auf den Theatertext „Rechnitz (Der Würgeengel)“ gelegt, der das Massaker von Rechnitz 1945 thematisiert und dessen intertextuelle Bezüge und sprachliche Besonderheiten im Mittelpunkt der Analyse stehen.
2. Gebrochene Theaterkonventionen: Dieses Kapitel analysiert die Abweichungen von klassischen dramatischen Konventionen in Jelineks „Rechnitz (Der Würgeengel)“. Es wird deutlich, dass der Text keine traditionelle dramatische Struktur aufweist, sondern als „Theatertext“ die Konventionen des aristotelischen Theaters bewusst bricht. Die fehlende Aktaufteilung, Szenen und ein fehlendes Dramatis Personae unterstreichen diese Strukturarmut und die Abkehr von einer linearen Handlung.
Schlüsselwörter
Elfriede Jelinek, Rechnitz (Der Würgeengel), Botenbericht, Intertextualität, Postdramatisches Theater, NS-Verbrechen, Geschichtsbewältigung, Sprachliche Gestaltung, Dramatische Konventionen, Massaker von Rechnitz, Diskursiver Aufdeckung.
Häufig gestellte Fragen zu Elfriede Jelineks „Rechnitz (Der Würgeengel)“
Was ist der Gegenstand der vorliegenden Arbeit?
Die Arbeit analysiert Elfriede Jelineks Theatertext „Rechnitz (Der Würgeengel)“. Der Fokus liegt auf den intertextuellen Bezügen des Textes und der Verwendung der Botenbericht-Konvention. Ziel ist die Untersuchung der diskursiven Aufdeckung des Massakers von Rechnitz und der damit verbundenen historischen und gesellschaftlichen Missstände. Die sprachliche Gestaltung und die Abweichung von dramatischen Konventionen werden ebenfalls berücksichtigt.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themenschwerpunkte: Intertextualität und historische Verwertung, die Funktion des Botenberichts im postdramatischen Theater, die Aufarbeitung des Massakers von Rechnitz und die NS-Vergangenheit, die sprachliche Gestaltung und ihre Bedeutung für den Diskurs sowie die Brechung dramatischer Konventionen.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in folgende Kapitel: Einleitung, „Sie hörten soeben unsere tägliche Sendung von der Banalität des Bösen“. Intertextualität und historische Verwertungsmaschinerie, Theaterkonvention Botenbericht (mit den Unterkapiteln Der Bote als Medium und Das Problem der Neutralität), Fazit und Anhang (mit den Unterkapiteln Primärliteratur, Sekundärliteratur und Sonstiges Quellenverzeichnis).
Wie wird die Einleitung gestaltet?
Die Einleitung führt in die Thematik ein und stellt Elfriede Jelinek und ihr Werk im Kontext der deutschsprachigen Theaterlandschaft vor. Sie betont Jelineks Engagement für die Aufarbeitung von Geschichte und gesellschaftlichen Missständen, insbesondere im Hinblick auf das NS-Regime. Der Fokus wird auf „Rechnitz (Der Würgeengel)“ gelegt, dessen intertextuelle Bezüge und sprachliche Besonderheiten im Mittelpunkt der Analyse stehen.
Was wird im Kapitel über die gebrochenen Theaterkonventionen analysiert?
Dieses Kapitel analysiert die Abweichungen von klassischen dramatischen Konventionen in Jelineks „Rechnitz (Der Würgeengel)“. Es wird gezeigt, dass der Text keine traditionelle dramatische Struktur aufweist, sondern die Konventionen des aristotelischen Theaters bewusst bricht. Die fehlende Aktaufteilung, Szenen und ein fehlendes Dramatis Personae unterstreichen die Strukturarmut und die Abkehr von einer linearen Handlung.
Welche Schlüsselwörter sind relevant für die Arbeit?
Relevante Schlüsselwörter sind: Elfriede Jelinek, Rechnitz (Der Würgeengel), Botenbericht, Intertextualität, Postdramatisches Theater, NS-Verbrechen, Geschichtsbewältigung, Sprachliche Gestaltung, Dramatische Konventionen, Massaker von Rechnitz, Diskursiver Aufdeckung.
- Quote paper
- Aurelia Vowinckel (Author), 2009, Elfriede Jelineks "Rechnitz (Der Würgeengel)". Intertextualität und Wortspiel als Mittel zur diskursiven Aufdeckung im postdramatischen Botenbericht, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/172932