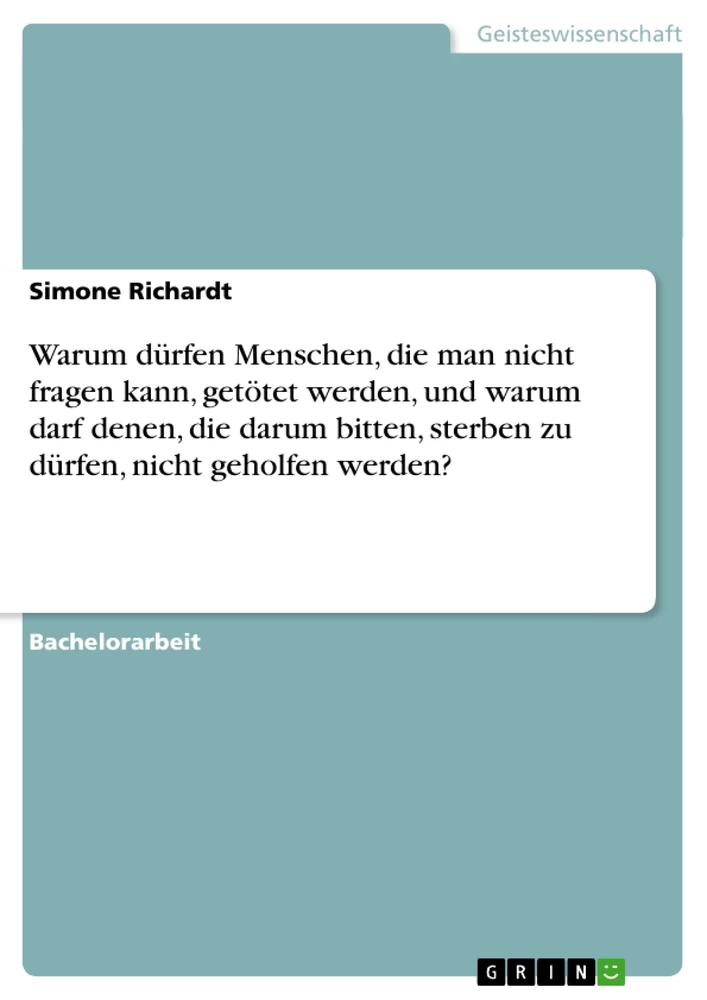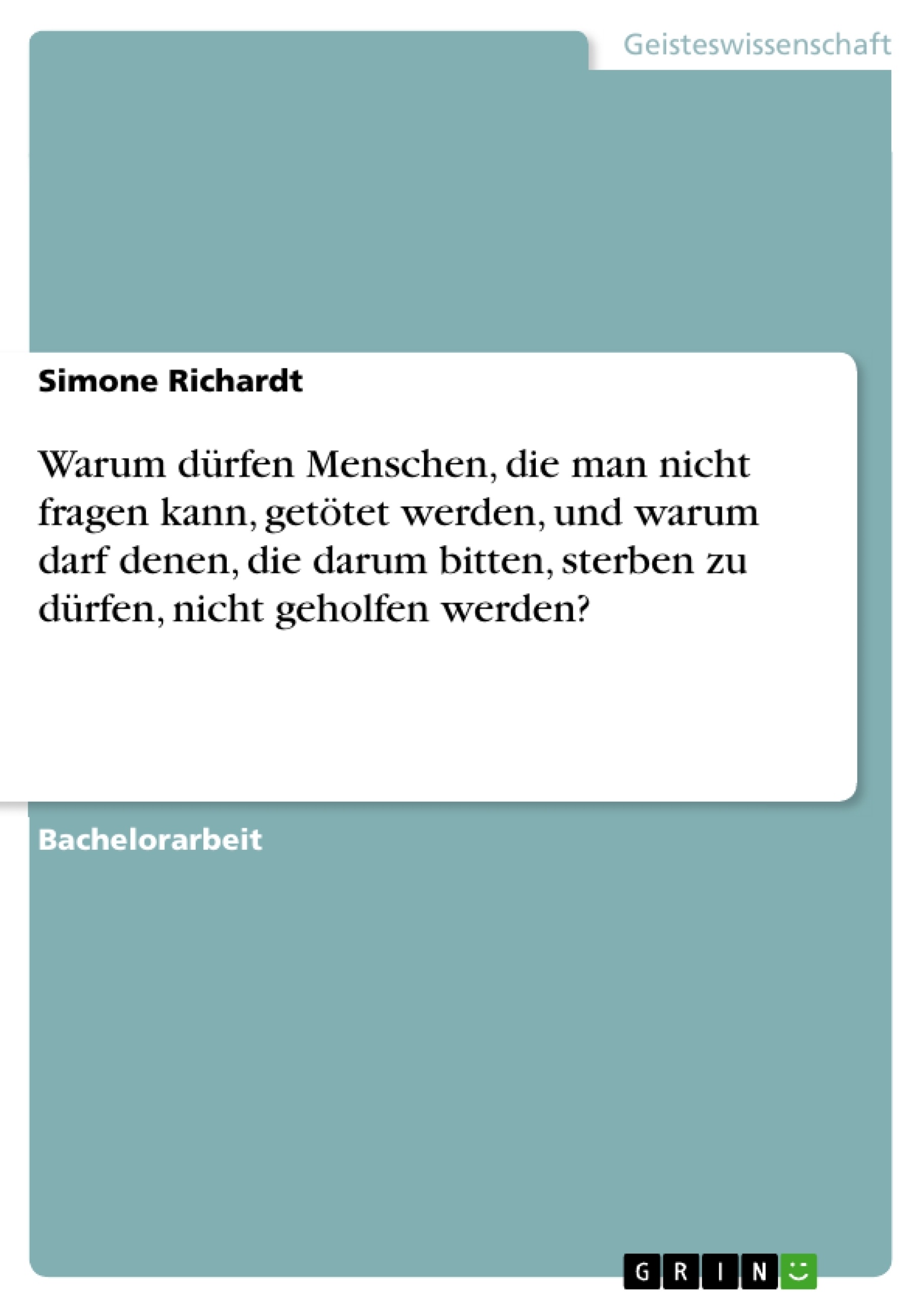Dramatisch formuliert, soll es in dieser Thesis um den Anfang und das Ende des Lebens gehen. Ein Anfang und ein Ende über das der Mensch heute in der Lage ist selbst zu entscheiden.
Aber ist er das wirklich?
Immerhin werden wir geboren – oder eben nicht, weil jemand anderes sich überlegte uns zu zeugen und / oder bei geschehener Zeugung in die Welt zu setzen. Und wir sterben zum Beispiel, weil wir alt oder krank sind, uns ein tödlicher Unfall geschieht, jemand unser Ableben beabsichtigt und dementsprechende Handlungen vollzog oder jemand Maschinen abstellt, deren Betrieb unser Ableben verhindert hätten.
Passend und entsprechend dazu sagt George Santayana:
„Es gibt kein Mittel gegen Geburt oder Tod, außer die Zwischenzeit zu genießen.“
(vgl. Santayana 2000, 308)
Denn wenn zwar Menschen, die aber nicht wir selbst sind, über unser Leben und unser Ableben entscheiden dürfen: Was sollten wir ansonsten anderes tun?
Eine zentrale Frage zu zu diesem Thema angestrebten Überlegungen ist somit sicherlich auch:
„Warum dürfen Menschen, die man nicht fragen kann, getötet werden, und warum darf denen, die darum bitten, sterben zu dürfen, nicht geholfen werden?“
Und genau aus diesem Grund widme ich mich der wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit dieser Fragestellung in den Kapiteln dieser Thesis. Geschichtlich, rechtlich, psychologisch und ethisch werde ich mich mit den einzelnen Komponenten zu dieser Frage beschäftigen und jeweils kurz zusammenfassend feststellen, ob die betreffende Wissenschaft uns Antwort auf die Fragestellung dieser Thesis geben kann, um abschließend zu selbiger ein Fazit ziehen zu können.
Inhaltsverzeichnis (Table of Contents)
- Vorwort
- 1. Einleitung
- 2. Definitionen von selbst- und fremdbestimmtem Tot
- 2.1 Tod
- 2.2 Abortion
- 2.3 Suizid / Freitod
- 2.4 Sterbehilfe
- 3. Geschichtliche Situation
- 3.1 Zum Thema Abortion
- 3.2 Zum Thema Suizid / Freitod
- 3.3 Zum Thema Sterbehilfe
- 3.3 Zusammenhänge
- 4. Rechtliche Situation
- 4.1 Zum Thema Abortion
- 4.2 Zum Thema Suizid / Freitod
- 4.3 Zum Thema Sterbehilfe
- 4.4 Zusammenhänge
- 5. Psychologische Situation
- 5.1 Zum Thema Abortion
- 5.2 Zum Thema Suizid / Freitod
- 5.3 Zum Thema Sterbehilfe
- 5.4 Zusammenhänge
- 6. Ethische Situation
- 6.1 Zum Thema Abortion
- 6.2 Zum Thema Suizid / Freitod und zum Thema Sterbehilfe
- 6.3 Zusammenhänge
- 7. Konsequenzen aller Zusammenhänge für Fachkräfte der Sozialen Arbeit
- 8. Fazit
- 9. Literaturverzeichnis
- 9.1 Buchquellen
- 9.2 Internetquellen
- 9.3 Sonstige Quellen
- 10. Anhang
- 10.1 Gesetze
- 10.2 Abwehrmechanismen nach Freud
- 10.3 Adressen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte (Objectives and Key Themes)
Die Arbeit befasst sich mit der Frage, warum es in Deutschland erlaubt ist, ein ungeborenes Kind zu töten, während Menschen, die um Sterbehilfe bitten, keine legale Möglichkeit haben, ihrem Leben ein Ende zu setzen.
- Rechtliche Aspekte der Abtreibung, des Suizids und der Sterbehilfe in Deutschland
- Geschichtliche Entwicklungen der drei Themengebiete
- Psychologische Auswirkungen von Abtreibung, Suizid und Sterbehilfe auf Betroffene und Hinterbliebene
- Ethische Diskussionen um die Rechtfertigung von Abtreibung, Suizid und Sterbehilfe
- Konsequenzen der behandelten Themen für Fachkräfte der Sozialen Arbeit
Zusammenfassung der Kapitel (Chapter Summaries)
Die ersten Kapitel befassen sich mit Definitionen der Begriffe „Tod“, „Abtreibung“, „Suizid“, „Freitod“ und „Sterbehilfe“. Es wird ein Überblick über die historische Entwicklung der drei Themengebiete gegeben, wobei deutlich wird, dass Abtreibung, Suizid und Sterbehilfe seit Jahrhunderten Teil der Menschheitsgeschichte sind.
In den folgenden Kapiteln werden die rechtlichen Rahmenbedingungen in Deutschland beleuchtet. Dabei wird deutlich, dass Abtreibung unter bestimmten Bedingungen legal ist, während aktive Sterbehilfe verboten ist. Die passive Sterbehilfe ist in Deutschland zwar nicht verboten, jedoch gibt es keine eindeutige rechtliche Regelung. Suizid ist in Deutschland straffrei.
Kapitel 5 beschäftigt sich mit den psychologischen Folgen von Abtreibung, Suizid und Sterbehilfe. Es werden verschiedene Formen und Gründe für Suizid sowie mögliche psychische Belastungen nach einer Abtreibung oder im Zusammenhang mit Sterbehilfe erläutert. Die Bedeutung des Trauerprozesses für Angehörige wird hervorgehoben.
Im sechsten Kapitel werden die ethischen Dimensionen der drei Themengebiete diskutiert. Es werden verschiedene philosophische Positionen zum Thema Tötungsrecht und Menschenwürde beleuchtet und kritisch hinterfragt.
Das letzte Kapitel befasst sich mit den Konsequenzen der Untersuchungsergebnisse für Fachkräfte der Sozialen Arbeit. Es wird ein Überblick über verschiedene Beratungsmethoden gegeben und deren Relevanz für die Arbeit mit Betroffenen von Abtreibung, Suizid und Sterbehilfe erläutert.
Schlüsselwörter (Keywords)
Die Arbeit befasst sich mit den Themen Abtreibung, Suizid, Sterbehilfe und den damit verbundenen rechtlichen, geschichtlichen, psychologischen und ethischen Aspekten. Darüber hinaus werden die Konsequenzen für die Soziale Arbeit beleuchtet. Wichtige Begriffe sind: Selbstbestimmung, Menschenwürde, Tötungsrecht, Recht auf Leben, Trauer, Abwehrmechanismen, Beratungsmethoden, klientenzentrierte Beratung, lösungsorientierte Beratung.
Häufig gestellte Fragen
Warum ist Abtreibung in Deutschland unter bestimmten Bedingungen legal?
Die rechtliche Situation erlaubt Abtreibungen innerhalb gewisser Fristen und nach Beratung, was eine Abwägung zwischen dem Lebensrecht des Ungeborenen und dem Selbstbestimmungsrecht der Frau darstellt.
Warum ist aktive Sterbehilfe in Deutschland verboten?
Das Verbot begründet sich oft auf ethischen Bedenken, der historischen Belastung durch NS-Euthanasie und dem staatlichen Schutzauftrag für das Leben.
Was ist der Unterschied zwischen Suizid und Sterbehilfe?
Suizid ist die Selbsttötung, die in Deutschland straffrei ist. Sterbehilfe bezeichnet die Unterstützung oder Herbeiführung des Todes durch Dritte, wobei zwischen aktiver, passiver und indirekter Sterbehilfe unterschieden wird.
Welche psychologischen Folgen haben Abtreibung und Suizid für Angehörige?
Hinterbliebene oder Betroffene leiden oft unter komplexen Trauerprozessen, Schuldgefühlen und psychischen Belastungen, die professionelle soziale Arbeit erfordern.
Was bedeutet 'Selbstbestimmung' am Lebensanfang und Lebensende?
Es geht um die ethische Frage, inwieweit der Mensch das Recht hat, über den Zeitpunkt seines Todes oder die Austragung einer Schwangerschaft selbst zu entscheiden.
- Arbeit zitieren
- BA Simone Richardt (Autor:in), 2011, Warum dürfen Menschen, die man nicht fragen kann, getötet werden, und warum darf denen, die darum bitten, sterben zu dürfen, nicht geholfen werden?, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/172953