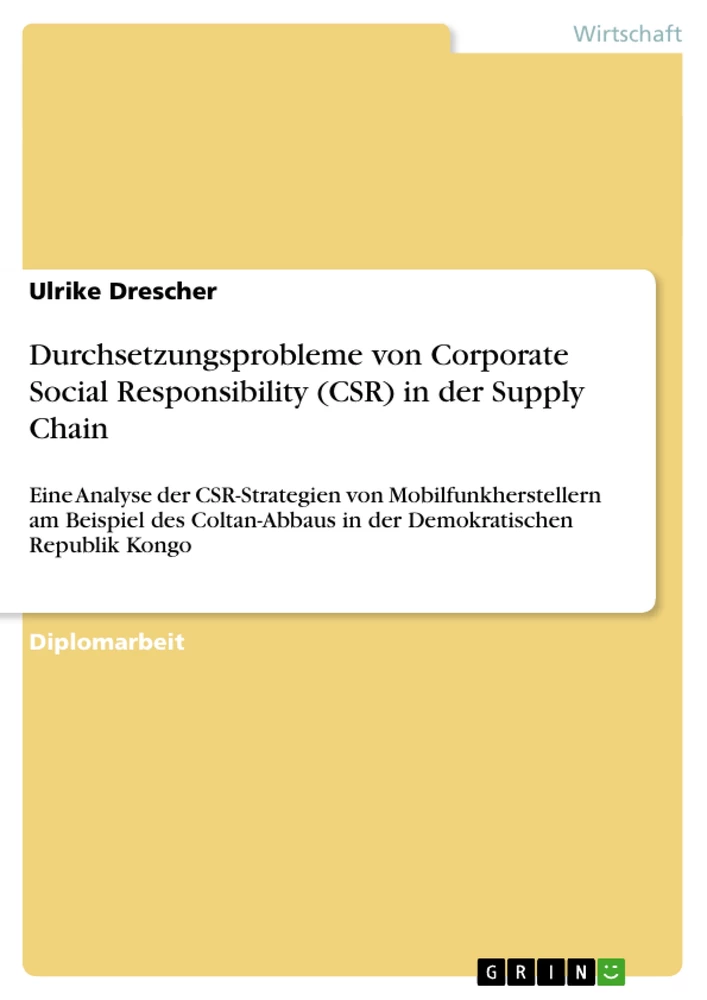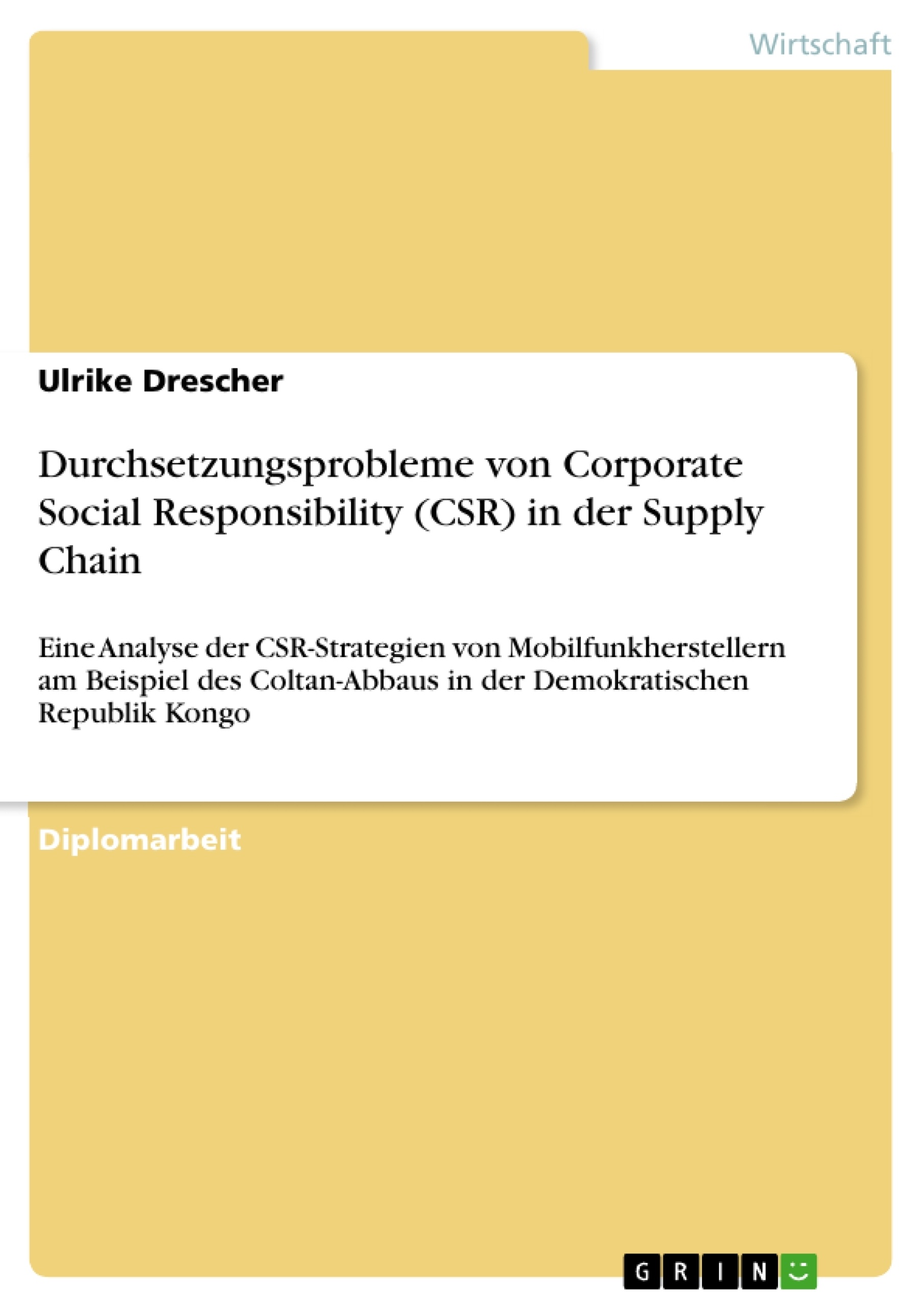Die gesellschaftliche Verantwortung von Multinationalen Unternehmen spielt mit zunehmenden globalen Aktivitäten eine immer größere Rolle. Umweltverschmutzung, schlechte Arbeitsbedingungen und geringe Löhne, bis hin zu Menschenrechtsverletzungen und Kinderarbeit in den Zulieferketten, sind die Vorwürfe der Öffentlichkeit gegen große Markenunternehmen. Besonders in Schwellen- und Entwicklungsländern sind soziale und ökologische Standards, aufgrund mangelnder Regulierungen und Durchsetzbarkeit, nicht gegeben (vgl. BDA 2005, S. 6). Nichtregierungsorganisationen und Gewerkschaften fordern Multinationale Unternehmen auf Verantwortung für ihre Lieferkette zu übernehmen, indem sie über Missstände in den Zulieferketten berichten. Bücher wie „No Logo!“ von Klein (2005) oder „Das Neue Schwarzbuch Markenfirmen“ von Werner und Weiss (2009) tragen dazu bei, dass die Öffentlichkeit erfährt, unter welchen Bedingungen
Kleidung, Spielzeug oder Elektronikgeräte hergestellt werden. Moralisch nicht vertretbare Unternehmenstätigkeiten bergen ein Geschäftsrisiko, da diese zu Reputationsverlusten führen können, weshalb die Unternehmen zunehmend unter Druck geraten, ihrer gesellschaftlichen Verantwortung gerecht zu werden. Unternehmen,
die sich durch ein hohes Markenimage auszeichnen, sind besonders deshalb Zielscheibe der Anschuldigungen. Um auf Vorwürfe der Öffentlichkeit zu reagieren, bedienen sich Multinationale Unternehmen zunehmend dem Ansatz der Übernahme von gesellschaftlicher Verantwortung, welcher unter dem Begriff
Corporate Social Responsibility geläufig ist. Sie entwickeln sogenannte CSR-Strategien, die für sie und ihre Geschäftspartner verbindlich sein sollen. Doch besonders die Implementierung und Durchsetzung einer „Responsable Supply Chain“ stellt für Unternehmen eine große Herausforderung dar.
Inhaltsverzeichnis (Table of Contents)
- Einleitung
- Corporate Social Responsibility
- Stakeholder – Die Treiber von CSR
- Die neue Rolle der Multinationalen Unternehmen
- Verhaltenskodizes
- Theoretischer Bezugsrahmen
- Die Neue Institutionenökonomik
- Transaktionskostentheorie
- Prinzipal-Agenten-Theorie
- Geschäftsbeziehungsmanagement
- Mobilfunkhersteller und ihre Supply Chain – Das Fallbeispiel Coltan
- Trends auf dem Mobilfunkmarkt
- Die Tantal-Lieferkette der Mobilfunkhersteller
- Die Rohstoffgewinnung
- Der Konfliktrohstoff Coltan
- Umweltzerstörung und soziale Missstände
- Folgen für den Tantalmarkt
- Zwischenhändler
- Tantalverarbeitung
- Kondensatorhersteller und Leiterplattenmonteure
- Die CSR-Aktivitäten der Mobilfunkhersteller
- Verhaltenskodizes und Coltan-Policy
- CSR-Instrumente
- Institutionenökonomische Analyse
- Die Prinzipal-Agenten-Beziehungen in der Lieferkette
- Bewertung der CSR-Instrumente
- Monitoring
- Lieferantenentwicklung
- Brancheninitiativen und Stakeholderdialog
- Zwischenfazit
- Die Zertifizierung zur Schaffung von Transparenz
- Die Zertifizierung von Handelsketten
- Das Pilotprojekt Ruanda
- Bewertung des Ansatzes
- Schlussbemerkung und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte (Objectives and Key Themes)
Die Diplomarbeit befasst sich mit den Herausforderungen der Durchsetzung von Corporate Social Responsibility (CSR) in der Supply Chain von Mobilfunkherstellern am Beispiel des Coltan-Abbaus in der Demokratischen Republik Kongo. Die Arbeit analysiert die CSR-Strategien von Mobilfunkherstellern, insbesondere deren Instrumente zur Durchsetzung von CSR-Standards, und bewertet deren Effizienz.
- Der CSR-Ansatz und seine Bedeutung für Unternehmen und Stakeholder
- Die Problematik des Coltan-Abbaus in der Demokratischen Republik Kongo, einschließlich der sozialen und ökologischen Folgen
- Die Prinzipal-Agenten-Beziehungen in der Lieferkette und die daraus resultierenden Herausforderungen für die Durchsetzung von CSR-Standards
- Die Effizienz der CSR-Instrumente von Mobilfunkherstellern, wie Monitoring, Lieferantenentwicklung und Stakeholderdialoge
- Das Potenzial der Zertifizierung als Instrument zur Schaffung von Transparenz und zur Lösung der Coltan-Problematik
Zusammenfassung der Kapitel (Chapter Summaries)
Kapitel 2 erläutert das Konzept der Corporate Social Responsibility (CSR) und seine Relevanz für Unternehmen, insbesondere vor dem Hintergrund des zunehmenden öffentlichen Drucks auf multinationale Unternehmen. Das Kapitel beleuchtet die Rolle von Stakeholdern als Treiber von CSR und geht auf die Bedeutung von Verhaltenskodizes als Instrument der Selbstregulierung ein.
Kapitel 3 stellt den theoretischen Bezugsrahmen für die Analyse der CSR-Instrumente vor, die Neue Institutionenökonomik (NIÖ). Die Kapitel fokussiert auf die Transaktionskostentheorie und die Prinzipal-Agenten-Theorie, die zur Erklärung von Koordinations- und Motivationsproblemen in Lieferketten beitragen.
Kapitel 4 beschreibt die Lieferkette des Rohstoffes Coltan, die für die Produktion von Mobilfunkgeräten benötigt wird. Das Kapitel beleuchtet die Problematik des Coltan-Abbaus in der Demokratischen Republik Kongo, einschließlich der Umweltzerstörung und der sozialen Missstände.
Kapitel 5 analysiert die CSR-Instrumente der Mobilfunkhersteller unter Anwendung der NIÖ. Die Kapitel untersucht die Effizienz von Monitoring, Lieferantenentwicklung und Stakeholderdialogen in Bezug auf die Lösung der Coltan-Problematik.
Kapitel 6 befasst sich mit der Zertifizierung als Instrument zur Schaffung von Transparenz und zur Verbesserung der Standards in der Coltan-Lieferkette. Das Kapitel beleuchtet die staatliche Initiative der BGR zur Zertifizierung von Handelsketten (CTC) und analysiert die Chancen und Herausforderungen dieses Ansatzes.
Schlüsselwörter (Keywords)
Die Arbeit widmet sich den Themen der Corporate Social Responsibility (CSR), der Lieferkette (Supply Chain), dem Coltan-Abbau, der Demokratischen Republik Kongo, der Neuen Institutionenökonomik (NIÖ), den Prinzipal-Agenten-Beziehungen, dem Monitoring, der Lieferantenentwicklung, dem Stakeholderdialog, den Brancheninitiativen und der Zertifizierung.
Häufig gestellte Fragen
Was sind die Herausforderungen von CSR in der Supply Chain?
Die Implementierung und Durchsetzung sozialer und ökologischer Standards bei globalen Zulieferern ist schwierig, da oft mangelnde Regulierungen in Schwellenländern und komplexe Lieferkettenstrukturen vorliegen.
Warum ist der Coltan-Abbau in der DR Kongo ein CSR-Problem?
Coltan ist ein Konfliktrohstoff. Der Abbau ist oft mit Menschenrechtsverletzungen, Kinderarbeit, Umweltzerstörung und der Finanzierung bewaffneter Konflikte verbunden.
Welche Rolle spielt die Prinzipal-Agenten-Theorie hierbei?
Sie erklärt das Informationsasymmetrie-Problem: Der Hersteller (Prinzipal) kann nur schwer kontrollieren, ob der Zulieferer (Agent) die vereinbarten CSR-Standards tatsächlich einhält.
Welche Instrumente nutzen Mobilfunkhersteller zur CSR-Durchsetzung?
Zu den Instrumenten gehören Verhaltenskodizes (Codes of Conduct), Monitoring (Audits), Lieferantenentwicklung und Brancheninitiativen.
Kann eine Zertifizierung die Transparenz verbessern?
Ja, Pilotprojekte wie die Zertifizierung von Handelsketten (CTC) in Ruanda zeigen Ansätze auf, wie durch staatliche und unabhängige Kontrollen die Herkunft von Rohstoffen transparenter gemacht werden kann.
- Quote paper
- Ulrike Drescher (Author), 2010, Durchsetzungsprobleme von Corporate Social Responsibility (CSR) in der Supply Chain, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/172964