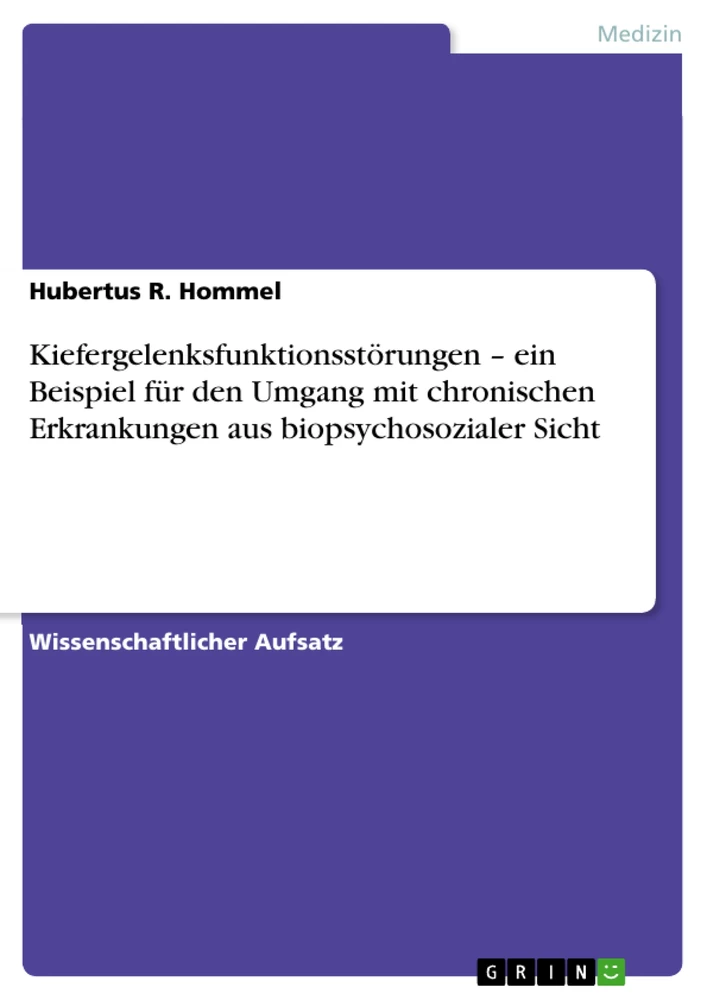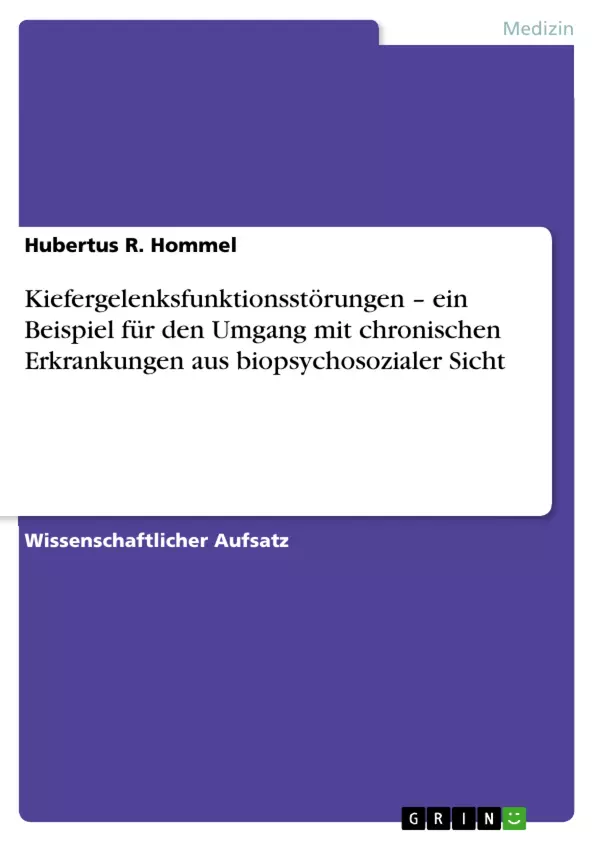Die körperlichen Reaktionen auf Kiefergelenksdysfunktionen können individuell sehr unterschiedlich sein und lassen sich daher nicht ausschließlich über bewährte Ursache-Wirkungsbeziehungen erklären. Ähnliches gilt für chronische Krankheiten, auch hier lassen sich Krankheitsbild und Ursache selten in Kausalzusammenhang bringen. Unter psychosomatischer Sicht resultieren sie aus einer multifaktoriellen Genese, die zu kognitiv-transaktionalem Stressverhalten führen können. Demnach werden externe Reizgegebenheiten von dem jeweilig Betroffenen mit seinem eigenen Ressourcenpotential verglichen und bewertet. Bei Passung zwischen Umwelt und Organismus besteht eine Ausgewogenheit zwischen Psyche und Soma. Der Verlust dieser individuellen Passung kann dagegen zu umfassenden biosemiotischen Interpretationsstörungen auf sämtlichen Ebenen führen, deren Auswirkungen sich somatisch äußern können. Dies gilt als eine ätiologische Variante für sämtliche Erkrankungen. Demnach haben alle somatischen Krankheiten einen psychischen Bezug. Die psychischen Faktoren bekommen eine zusätzlich vordergründige Bedeutung, wenn sich trotz ausführlicher ärztlicher Untersuchung kein hinreichender Bezug der Symptomatik zu organischen Ursachen nachweisen lässt. Solche sich unter herkömmlicher Sicht nicht eindeutig fassbaren Beschwerden werden deshalb den „somatoformen Störungen“ zugeordnet. Ein wichtiges Kriterium liefert hierzu das Phänomen Schmerz, wenn Hyperalgesien und Allodynien vorliegen oder Schmerzempathien bestehen. Nach Angaben der Deutschen Schmerzliga leiden mindestens acht Millionen Bundesbürger an schweren Dauerschmerzen verschiedenster Art, die sich mitunter zu einem eigenen Krankheitsbild entwickeln können. Hierunter zählen auch Schmerzsymptomatiken des Bewegungsapparates und somit auch der Kiefergelenke. Aufgrund der mangelhaften Möglichkeiten zur Klassifikation chronischer Schmerzen wird angenommen, dass psychische Faktoren eine entscheidende Rolle beim Beginn, für die Schwere, die Verschlechterung und die Erhaltung des Schmerzes spielen. Besteht ein Zusammenspiel von biologischen und psychischen Krankheitsfaktoren ohne rein physiologisch erklärbare Grundstörung, lassen sich die sich körperlich manifestierenden Krankheitsverläufe als „Psychosomatosen“ einordnen. [...]
Inhaltsverzeichnis
- Einführung
- was lange währt, macht endlich krank
- ein Jeder ist seines Glückes Schmied
- die ganze Welt ist ein System
- was gibt dem Sinn einen Sinn?
- der Apfel fällt oft weit vom Stamm
- lange Leitung, kurzer Weg
- Komunikation – die interaktive Toolbox
- wehe, wenn die Hexe schießt
- alles Psycho, oder was?
- Gefühl ist alles
- Lifestyle ist ein schlechter Guru
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Dieser Text befasst sich mit Kiefergelenksfunktionsstörungen aus einer biopsychosozialen Perspektive. Das Ziel ist es, die Komplexität der Krankheitsentstehung und -entwicklung zu beleuchten, wobei sowohl die biologischen als auch die psychosozialen Faktoren berücksichtigt werden.
- Die Bedeutung von individuell wahrgenommenen Umweltbedingungen und deren Einfluss auf das Wohlbefinden
- Die Rolle von Stress und psychosozialen Faktoren bei der Entstehung chronischer Erkrankungen
- Die Bedeutung von individuellen Ressourcen und der "Sense of Coherence" für die Bewältigung von Krankheitsbelastungen
- Das Zusammenspiel von körperlichen und psychischen Faktoren bei Kiefergelenksdysfunktionen
- Die Bedeutung einer ganzheitlichen Sichtweise auf die Gesundheit und die Integration psychosozialer Aspekte in die Behandlung chronischer Erkrankungen
Zusammenfassung der Kapitel
Der Text beginnt mit einer Einführung, die den Zusammenhang zwischen individueller Umwelt, Wohlbefinden und Gesundheit beleuchtet. Er erklärt, dass die Gesundheit als ein dynamischer Prozess zu verstehen ist, der sich durch das subjektive Empfinden des Einzelnen definiert.
Anschließend geht der Text auf das Thema "was lange währt, macht endlich krank" ein und beleuchtet die Bedeutung der Zeit und des Zeitverständnisses in der Krankheitsentwicklung. Es wird betont, dass Krankheiten nicht als statische Zustände, sondern als dynamische Prozesse zu betrachten sind.
Das Kapitel "ein Jeder ist seines Glückes Schmied" beleuchtet die Rolle der eigenen Ressourcen und der individuellen Bewältigungsstrategien im Umgang mit Krankheit. Es wird die Bedeutung von Persönlichkeitseigenschaften und der "Sense of Coherence" für die Stärkung der Widerstandsfähigkeit betont.
Im Kapitel "die ganze Welt ist ein System" wird das Zusammenspiel von biologischen, psychischen und sozialen Faktoren in der Krankheitsentstehung und -entwicklung näher betrachtet. Die Interaktion zwischen dem Individuum und seiner Umwelt, sowie die Entstehung von Stress als Folge einer Diskrepanz zwischen Umweltanforderungen und eigenen Ressourcen werden erläutert.
Im weiteren Verlauf werden die Kapitel "was gibt dem Sinn einen Sinn?", "der Apfel fällt oft weit vom Stamm" und "lange Leitung, kurzer Weg" die verschiedenen Aspekte der Krankheitsentwicklung im Detail beleuchten und spezifische Beispiele zur Veranschaulichung liefern.
Schlüsselwörter
Kiefergelenksdysfunktion, biopsychosoziales Modell, chronische Erkrankung, Stress, Ressourcen, "Sense of Coherence", Wohlbefinden, individuelle Wahrnehmung, Gesundheit, Zeit, Krankheitsverständnis, psychosoziale Faktoren, ganzheitliche Sichtweise, präventive Maßnahmen, Behandlungsansätze.
Häufig gestellte Fragen
Was bedeutet die biopsychosoziale Sicht auf Kiefergelenksstörungen?
Es bedeutet, dass die Erkrankung nicht nur als rein körperlicher Defekt gesehen wird, sondern als Zusammenspiel von biologischen Faktoren, psychischem Befinden und sozialen Umweltreizen.
Welche Rolle spielt Stress bei chronischen Schmerzen im Kiefer?
Stress führt zu kognitiv-transaktionalem Stressverhalten. Wenn das Ressourcenpotential des Betroffenen nicht ausreicht, kann dies zu somatischen Beschwerden wie Kiefergelenksdysfunktionen führen.
Was sind „somatoforme Störungen“ im Zusammenhang mit dem Kiefer?
Das sind Beschwerden, für die sich trotz ausführlicher Untersuchung keine hinreichenden organischen Ursachen finden lassen, bei denen aber psychische Faktoren eine große Rolle spielen.
Was ist der „Sense of Coherence“?
Es beschreibt ein Gefühl der Stimmigkeit und des Verstehens der eigenen Welt, das als wichtige Ressource dient, um Krankheitsbelastungen besser bewältigen zu können.
Warum ist Gesundheit als dynamischer Prozess zu verstehen?
Gesundheit ist kein statischer Zustand, sondern resultiert aus der ständigen Bewertung der Umwelt durch das Individuum und dem Gleichgewicht zwischen Psyche und Soma.
Welche Bedeutung hat das Phänomen Schmerz in dieser Betrachtung?
Chronischer Schmerz kann sich zu einem eigenen Krankheitsbild entwickeln, bei dem psychische Faktoren entscheidend für den Beginn, die Schwere und die Erhaltung des Leidens sind.
- Arbeit zitieren
- Dr.med.dent. Hubertus R. Hommel (Autor:in), 2011, Kiefergelenksfunktionsstörungen – ein Beispiel für den Umgang mit chronischen Erkrankungen aus biopsychosozialer Sicht, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/173022