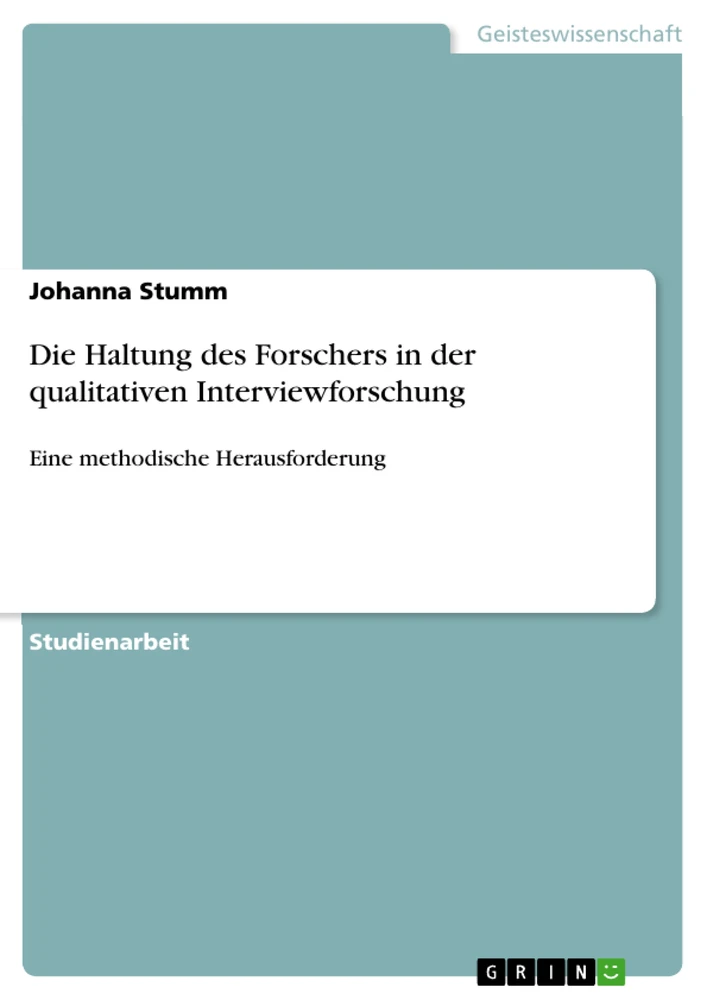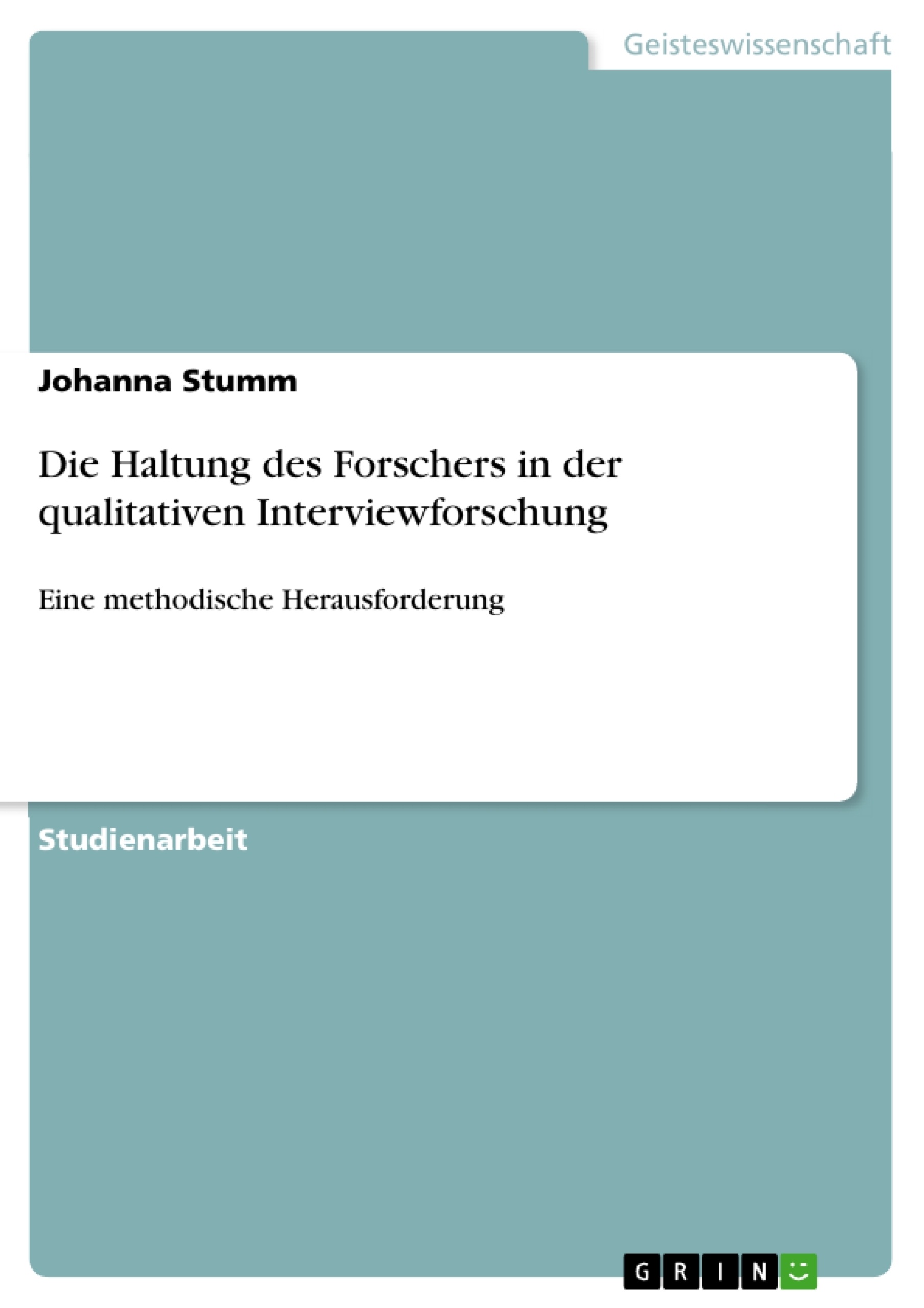Die qualitative Forschung zeichnet sich in Abgrenzung zu einer quantitativen Forschungsvorgehensweise vor allem dadurch aus, dass nicht der Versuch unternommen wird, Subjektivität so weit wie möglich auszuschalten. Während in der quantitativen Forschung Gütekriterien wie Objektivität und Reliabilität als Merkmale hochwertiger Wissenschaft gelten, wird an die qualitative Forschung der Anspruch gestellt, die subjektiven Faktoren des Forschers – wie etwa das Erkenntnisinteresse, das Verstehen aus Perspektive des Forschers, Vorannahmen (Präkonzepte) und Vorurteile – anzuerkennen und zu reflektieren, und diesen Reflexionsprozess transparent zu machen.
In der qualitativen Forschung werden verschiedene Quellen genutzt, um Material über den Forschungsgegenstand zu sammeln. Eine beliebte Quelle ist das Interview. Bei einer solchen Kommunikations-Situation lässt sich der Forscher auf eine Begegnung mit dem zu beforschenden Subjekt ein, wobei es unweigerlich zu komplexen Dynamiken zwischen den Gesprächspartnern kommt. Typische Charakteristika menschlicher Kommunikation kommen zur Geltung, Möglichkeiten und Grenzen des Fremdverstehens treten zutage, zu dem gesprochenen Wort gesellen sich nonverbale Signale, wie Intonation, Pausen oder Körpersprache, die sich unweigerlich in einen Gesamteindruck des Interviewten einreihen. Während menschliche Wahrnehmung und Kommunikation nie ganz frei sein können von Erwartung und vorgefertigten Verstehensmustern gilt das erklärte Ziel der qualitativen Interviewforschung, sich im Gespräch offen zu machen, um Neues zu entdecken.
In der vorliegenden Arbeit werden grundlegende Konzepte der qualitativen Forschung allgemein und der Interviewforschung im Besonderen dargelegt. Erkenntnistheoretische Probleme werden vertiefend erfasst, um schließlich einige in der qualitativen Forschung bekannte und angewandte Lösungsversuche für diese Probleme zu erläutern. Ein Schwerpunkt wird dabei auf das Konzept der theoretischen Sensibilität nach der Grounded Theory gelegt.
Es wird gezeigt werden, dass die qualitative Interviewforschung ganz besondere Anforderungen an die Haltung des Forschers stellt, aus denen sich letztlich auch spezifische Gütekriterien für eine ‚gute Forschung‘ ableiten lassen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Qualitative Forschung allgemein
- 2.1. Erkenntnistheoretische Grundlagen qualitativer Forschung
- 2.1.1. Phänomenologische Lebensweltanalyse
- 2.1.2. Ethnomethodologie
- 2.1.3. Symbolischer Interaktionismus
- 2.1.4. Konstruktivismus
- 3. Erkenntnistheoretische Probleme methodische Herausforderungen
- 3.1. Grundprobleme
- 3.1.1. Fremdverstehen
- 3.1.2. Indexikalität der Sprache
- 3.2. Deduktion - Induktion - Abduktion - Komplexität der Erkenntnis
- 4. Lösungsversuche und Bewältigungsstrategien
- 4.1. Das Prinzip Offenheit
- 4.2. Theoretische Sensibilität
- 4.2.1. Theoretische Sensibilität à la Strauss/ Corbin
- 4.2.2. Die,Theoretische Sensibilität in der Grounded Theory
- 5. Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit setzt sich zum Ziel, die methodischen Herausforderungen der qualitativen Interviewforschung zu beleuchten. Sie analysiert die epistemologischen Grundlagen qualitativer Forschung, beleuchtet die spezifischen Probleme des Fremdverstehens und der Indexikalität der Sprache in Interviews, und präsentiert Lösungsansätze wie das Prinzip der Offenheit und die theoretische Sensibilität.
- Erkenntnistheoretische Grundlagen qualitativer Forschung
- Methodische Herausforderungen in der Interviewforschung
- Das Problem des Fremdverstehens
- Indexikalität der Sprache
- Lösungsansätze und Bewältigungsstrategien
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1: Die Einleitung stellt die Grundidee der Arbeit dar, die sich mit der Haltung des Forschers in der qualitativen Interviewforschung befasst. Sie hebt die Notwendigkeit der Reflexion subjektiver Faktoren des Forschers und die komplexen Dynamiken in der Interviewsituation hervor.
- Kapitel 2: Dieses Kapitel gibt einen Überblick über die qualitative Forschung allgemein und erklärt die erkenntnistheoretischen Grundlagen, die hinter den verschiedenen qualitativen Ansätzen stehen. Hier werden Konzepte wie die Phänomenologische Lebensweltanalyse, die Ethnomethodologie, der symbolische Interaktionismus und der Konstruktivismus vorgestellt.
- Kapitel 3: Das Kapitel befasst sich mit den besonderen Problemen, die in der qualitativen Interviewforschung auftreten. Es beleuchtet die Schwierigkeiten des Fremdverstehens und die Indexikalität der Sprache, die das Verständnis des Interviewten erschweren.
- Kapitel 4: Hier werden verschiedene Lösungsversuche und Bewältigungsstrategien für die in Kapitel 3 dargestellten Probleme vorgestellt. Der Schwerpunkt liegt dabei auf dem Konzept der theoretischen Sensibilität, das in der Grounded Theory Anwendung findet.
Schlüsselwörter
Qualitative Forschung, Interviewforschung, Erkenntnistheorie, Fremdverstehen, Indexikalität, theoretische Sensibilität, Grounded Theory, Haltung des Forschers, methodische Herausforderungen
Häufig gestellte Fragen
Wie unterscheidet sich qualitative von quantitativer Forschung?
Qualitative Forschung versucht nicht, Subjektivität auszuschalten, sondern erkennt Faktoren wie Vorannahmen und das Verstehen des Forschers als Teil des Prozesses an und reflektiert diese.
Was ist "theoretische Sensibilität" in der Grounded Theory?
Es ist die Fähigkeit des Forschers, Einsichten in Daten zu gewinnen, deren Bedeutung zu erkennen und die Relevanz von Beobachtungen im Forschungsprozess zu verstehen.
Welche Probleme treten beim "Fremdverstehen" in Interviews auf?
Die Herausforderung liegt darin, dass menschliche Kommunikation nie ganz frei von Erwartungen ist und nonverbale Signale sowie die Indexikalität der Sprache die Interpretation erschweren.
Was bedeutet die "Indexikalität der Sprache"?
Sie beschreibt, dass die Bedeutung von Äußerungen stark vom jeweiligen Kontext und der Situation abhängt, in der sie getätigt werden.
Welche Haltung sollte ein Forscher in einem qualitativen Interview einnehmen?
Der Forscher sollte sich durch das "Prinzip der Offenheit" auszeichnen, um Neues zu entdecken, anstatt nur bestehende Hypothesen zu bestätigen.
- Quote paper
- Johanna Stumm (Author), 2011, Die Haltung des Forschers in der qualitativen Interviewforschung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/173037