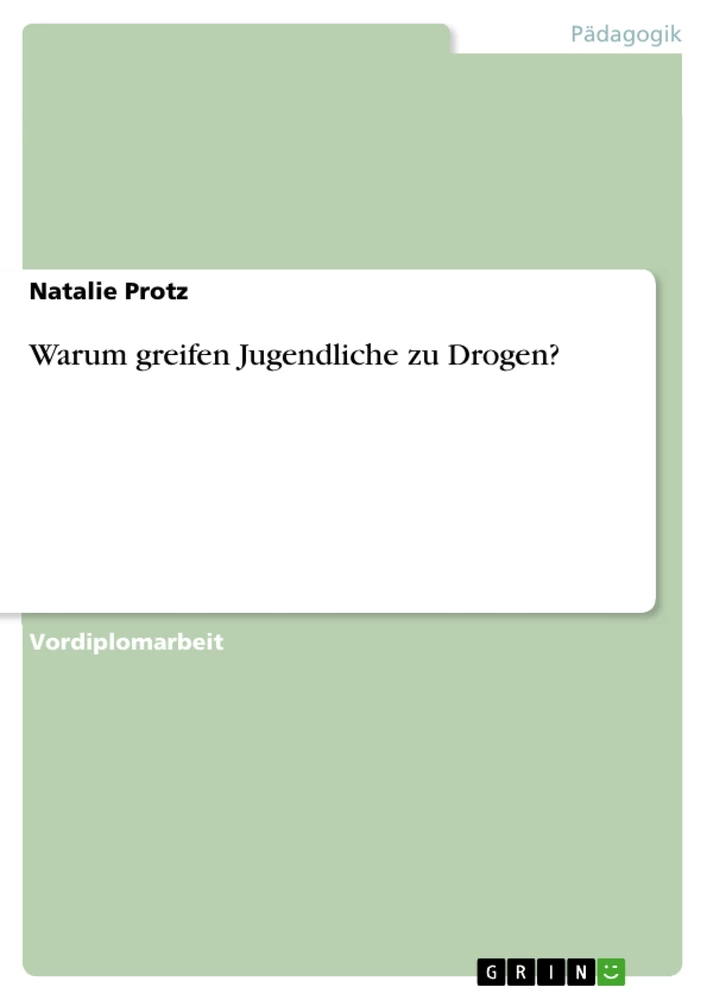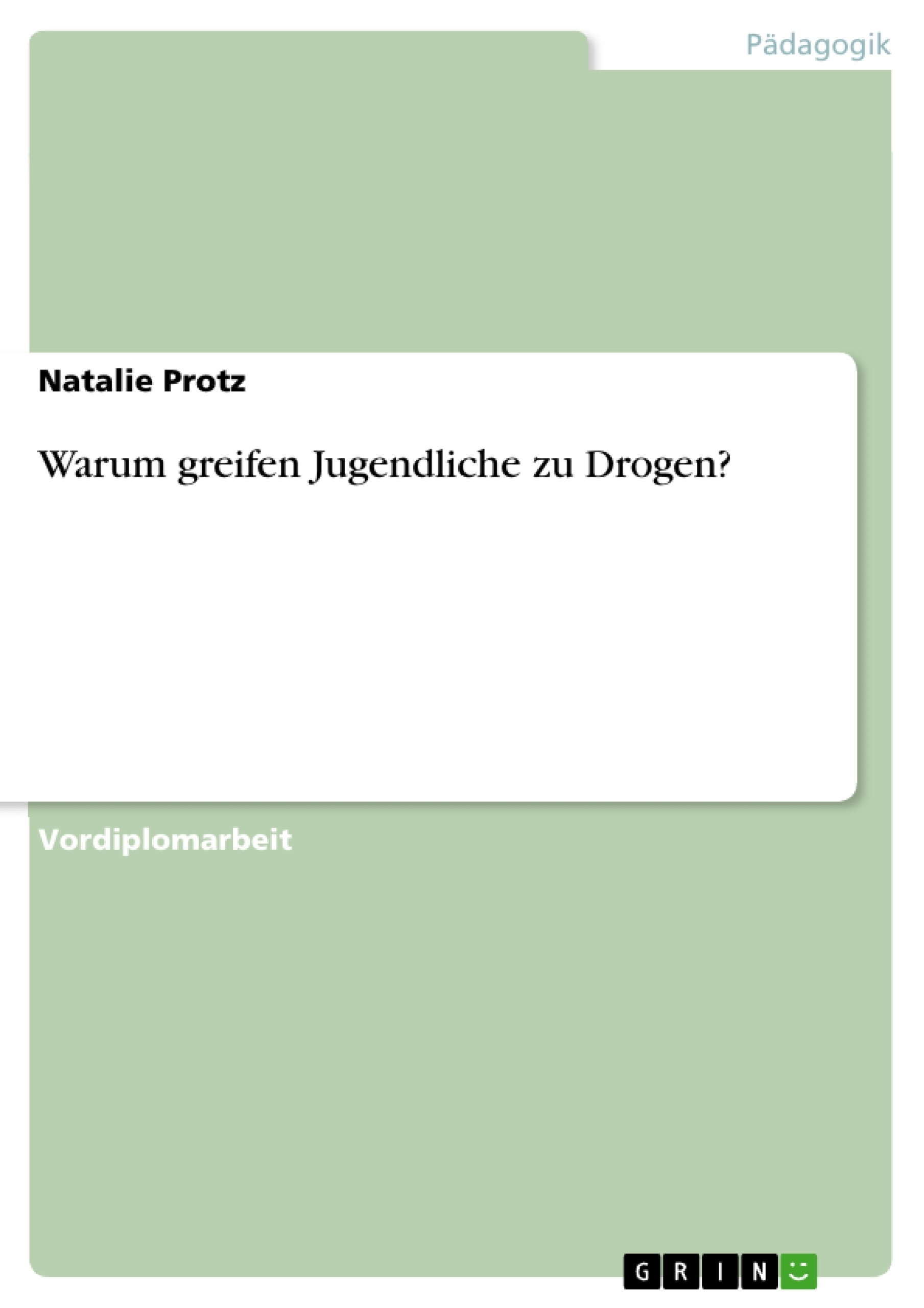Der Konsum von Rauschmitteln hat eine lange Vergangenheit und lässt sich bis in die Steinzeit zurückverfolgen. Damals wurden Drogen als Heil- und Schlafmittel sowie als Rauschstoff genutzt und meist bei kultischen oder religiösen Ereignissen eingesetzt. Die wichtigsten Drogen waren die pflanzlichen Stoffe Meskalin und Psilocybin, die von dem Peyotl-Kaktus und den psychotropen Pilzen gewonnen wurden. Diese spezifischen Pflanzen mit halluzinogener Wirkung (Veränderungen der visuellen und akustischen Wahrnehmung, genannt: Halluzinogene) wurden speziell von Schamanen auf ihrer „magischen“ Reise in die Geisterwelt verwendet. Im 19./20. Jahrhundert hielten die Rauschdrogen dann Einzug in die Malerei, Literatur und Musik. Mit dem „Psychedelismus“, am Beginn der Moderne, kamen noch weitere Halluzinogene hinzu wie LSD und Cannabis, die Künstler zu einer spirituellen Reise ins Unterbewusste nutzten, um ihr Bewusstsein aufgrund von intensiven ästhetischen Wahrnehmungen zu verändern und zu erweitern. (vgl. Schmidbauer/Vom Scheidt 1989)
Als Drogen bezeichnet man psychotrope Stoffe, die durch ihre chemische Zusammensetzung auf das Zentralnervensystem einwirken und somit Wahrnehmungen, Emotionen und das Verhalten verändern. (vgl. Freitag/Hurrelmann 1999)
Gegenwärtig wird unterschieden unter gesellschaftlich anerkannten Drogen wie Alkohol, Nikotin und Koffein sowie illegalen Drogen, wie Halluzinogene (LSD, Pilze), Cannabis, Kokain, Opiate (Opium, Heroin usw.), Amphetamine (Speed, Ecstasy) und anderen Substanzen. Neben Alkohol und Zigaretten gehören auch illegale Substanzen zur Alltagserfahrung vieler Jugendlicher und junger Heranwachsender. Infolgedessen nimmt das Drogenproblem weite Ausmaße an, da sich Angebotspalette und Nachfrage kontinuierlich erweitern. Neueste Ergebnisse der Drogenaffinitätsstudie der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) aus dem Jahre 2004 zeigen auf, dass etwa jeder zweite Befragte der Jugendlichen und jungen Heranwachsenden zwischen 12 und 25 Jahren schon einmal mit Drogen experimentiert hat. (vgl. Schille/Arnold 2002)
Als Konsummuster findet man am häufigsten den Probier- oder Erstkonsum. Eine der fatalsten Folgen von Rauschmittelkonsum ist die (chronische) Abhängigkeit. Auf die Frage „Warum greifen Jugendliche zu illegalen Drogen?“ möchte ich in dieser Arbeit nachgehen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- I) Definitionen
- 1.1 Begriffserklärung Sucht
- 1.1.1 Was ist Sucht?
- 1.2 Illegale Drogenarten und Drogenerleben
- II) Suchttheorie
- 2.1 Die Entwicklung der Suchttheorie
- 2.2 Suchttheorien
- 2.2.1 Neurobiologisch orientierte Erklärungsansätze
- 2.2.2 Psychologisch orientierte Erklärungsansätze
- 2.2.3 Soziokulturell orientierte Erklärungsansätze
- III) Drogengebrauch im Jugendalter
- 3.1 Drogengebrauch in der Peer-group
- 3.2 Drogengebrauch und Familie
- 3.3 Drogengebrauch und Schule
- IV) Abhängigkeit
- 4.1 Abhängigkeitssyndrom
- 4.1.1 Entzugssymptom
- V) Drogenprävention
- 5.1 Primäre Prävention
- 5.1.1 Primärprävention in der Familie
- 5.1.2 Schulische Primärprävention
- 5.1.3 Primärpräventive Aufklärung
- 5.2 Sekundäre Prävention
- 5.3 Tertiäre Prävention
- 5.1 Primäre Prävention
- VI) Resümee
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Frage, warum Jugendliche zu illegalen Drogen greifen. Sie beleuchtet die Definition von Sucht, verschiedene Suchttheorien und den Drogenkonsum im Jugendalter unter Berücksichtigung sozialer Faktoren wie Peergroup, Familie und Schule. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf den verschiedenen Arten illegaler Drogen und deren Auswirkungen.
- Definition und Verständnis von Sucht
- Theorien zur Entstehung und Entwicklung von Sucht
- Drogenkonsum im Jugendalter und seine sozialen Kontexte
- Auswirkungen des Konsums verschiedener illegaler Drogen
- Präventionsstrategien im Umgang mit Drogenmissbrauch
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung bietet einen historischen Überblick über den Rauschmittelkonsum, von der Steinzeit bis zur Moderne, und hebt die zunehmende Bedeutung des Drogenproblems im Jugendalter hervor. Sie führt in die Thematik ein und formuliert die zentrale Forschungsfrage der Arbeit.
I) Definitionen: Dieses Kapitel klärt den Begriff „Sucht“ und seine Entwicklung, von der ursprünglichen Bedeutung bis zur aktuellen Definition der WHO. Es beschreibt die verschiedenen Arten illegaler Drogen, darunter Cannabis, Kokain und LSD, und deren Auswirkungen auf den Konsumenten. Die Beschreibungen umfassen Wirkungsweisen, Rauscherfahrungen und mögliche langfristige Folgen des Konsums.
II) Suchttheorie: Dieses Kapitel befasst sich mit der Entwicklung verschiedener Suchttheorien, einschliesslich neurobiologischer, psychologischer und soziokultureller Erklärungsansätze. Es werden die verschiedenen Perspektiven auf die Entstehung und Aufrechterhaltung von Suchtverhalten vorgestellt und kritisch beleuchtet. Die Interaktion zwischen biologischen, psychischen und sozialen Faktoren wird dabei besonders hervorgehoben.
III) Drogengebrauch im Jugendalter: Dieses Kapitel analysiert den Drogenkonsum im Jugendalter, wobei die Einflüsse von Peergroups, Familie und Schule im Detail untersucht werden. Es beleuchtet die sozialen Dynamiken und Druckfaktoren, die zum Drogenkonsum beitragen, und die Rolle der jeweiligen Umgebungen. Der Fokus liegt auf der komplexen Interaktion zwischen individueller Vulnerabilität und sozialen Umgebungseinflüssen.
IV) Abhängigkeit: Kapitel IV definiert das Abhängigkeitssyndrom und beschreibt die damit verbundenen körperlichen und psychischen Symptome, insbesondere Entzugssymptome, die nach dem Absetzen der Substanz auftreten können. Der Abschnitt unterstreicht die Schwere der Abhängigkeit und deren Auswirkungen auf den Einzelnen.
V) Drogenprävention: Dieses Kapitel befasst sich mit verschiedenen Strategien der Drogenprävention, unterteilt in primäre, sekundäre und tertiäre Prävention. Es werden verschiedene präventive Maßnahmen in Familie, Schule und im öffentlichen Raum erläutert und deren jeweilige Wirksamkeit diskutiert. Der Fokus liegt auf der Entwicklung von umfassenden Präventionsstrategien.
Schlüsselwörter
Sucht, Suchttheorien, Drogenkonsum, Jugendlicher, illegale Drogen, Cannabis, Kokain, LSD, Abhängigkeit, Prävention, Peergroup, Familie, Schule, neurobiologische Faktoren, psychosoziale Faktoren.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Drogenkonsum im Jugendalter
Was ist der Inhalt dieses Dokuments?
Dieses Dokument bietet einen umfassenden Überblick über den Drogenkonsum im Jugendalter. Es beinhaltet eine Einleitung, Definitionen von Sucht und illegalen Drogen, verschiedene Suchttheorien, eine Analyse des Drogengebrauchs im Kontext von Peergroup, Familie und Schule, eine Beschreibung des Abhängigkeitssyndroms und verschiedene Strategien der Drogenprävention. Es enthält zudem ein Inhaltsverzeichnis, die Zielsetzung und Themenschwerpunkte, Zusammenfassungen der einzelnen Kapitel und Schlüsselwörter.
Welche Arten von Drogen werden behandelt?
Das Dokument nennt explizit Cannabis, Kokain und LSD als Beispiele für illegale Drogen und beschreibt deren Auswirkungen. Es geht aber auch allgemein auf verschiedene Arten illegaler Drogen ein.
Welche Suchttheorien werden behandelt?
Das Dokument behandelt neurobiologisch, psychologisch und soziokulturell orientierte Erklärungsansätze zur Sucht. Es werden verschiedene Perspektiven auf die Entstehung und Aufrechterhaltung von Suchtverhalten vorgestellt und kritisch beleuchtet. Die Interaktion zwischen biologischen, psychischen und sozialen Faktoren wird hervorgehoben.
Welche Rolle spielen soziale Faktoren im Drogenkonsum von Jugendlichen?
Der Einfluss von Peergroups, Familie und Schule auf den Drogenkonsum von Jugendlichen wird detailliert untersucht. Das Dokument beleuchtet die sozialen Dynamiken und Druckfaktoren, die zum Drogenkonsum beitragen, und die Rolle der jeweiligen Umgebungen. Die komplexe Interaktion zwischen individueller Vulnerabilität und sozialen Umgebungseinflüssen steht im Fokus.
Was ist das Abhängigkeitssyndrom und welche Symptome werden beschrieben?
Das Dokument definiert das Abhängigkeitssyndrom und beschreibt die damit verbundenen körperlichen und psychischen Symptome, insbesondere Entzugssymptome. Die Schwere der Abhängigkeit und deren Auswirkungen auf den Einzelnen werden unterstrichen.
Welche Präventionsstrategien werden vorgestellt?
Das Dokument beschreibt verschiedene Strategien der Drogenprävention, unterteilt in primäre, sekundäre und tertiäre Prävention. Es werden präventive Maßnahmen in Familie, Schule und im öffentlichen Raum erläutert und deren Wirksamkeit diskutiert. Der Fokus liegt auf der Entwicklung von umfassenden Präventionsstrategien.
Wie ist das Dokument strukturiert?
Das Dokument ist in Kapitel unterteilt, beginnend mit einer Einleitung und Definitionen. Es folgen Kapitel zu Suchttheorien, Drogengebrauch im Jugendalter, Abhängigkeit und Drogenprävention. Es schließt mit einem Resümee.
Für wen ist dieses Dokument gedacht?
Das Dokument ist für akademische Zwecke konzipiert und dient der Analyse von Themen im Zusammenhang mit Drogenkonsum im Jugendalter. Es eignet sich für Studierende, Wissenschaftler und alle, die sich professionell mit diesem Thema auseinandersetzen.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt?
Schlüsselwörter umfassen: Sucht, Suchttheorien, Drogenkonsum, Jugendlicher, illegale Drogen, Cannabis, Kokain, LSD, Abhängigkeit, Prävention, Peergroup, Familie, Schule, neurobiologische Faktoren, psychosoziale Faktoren.
- Citation du texte
- Natalie Protz (Auteur), 2011, Warum greifen Jugendliche zu Drogen?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/173042