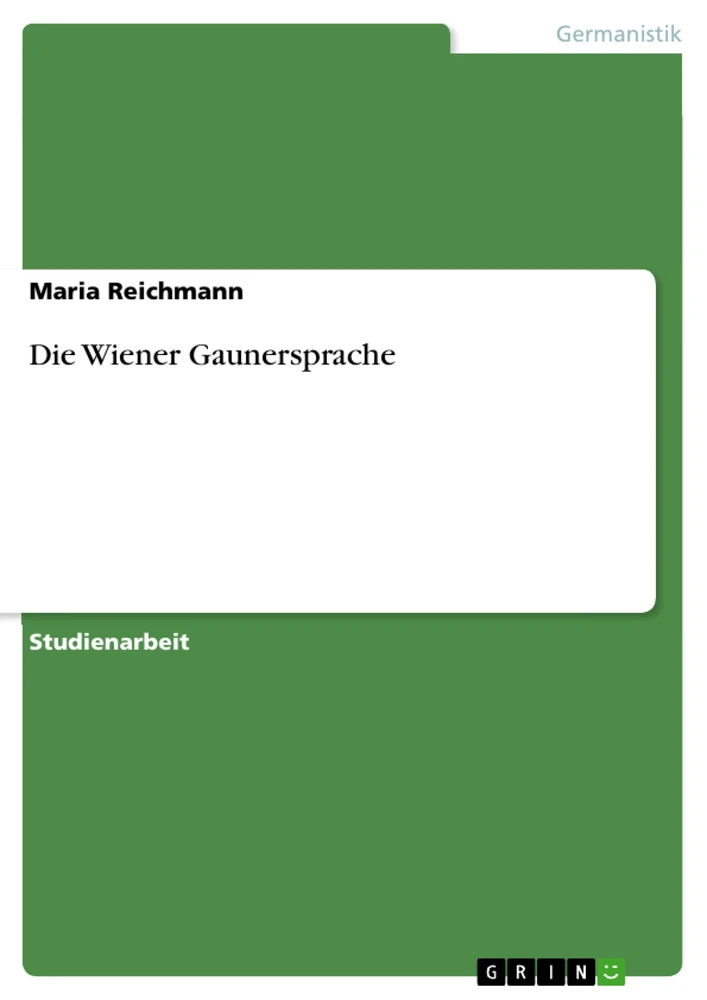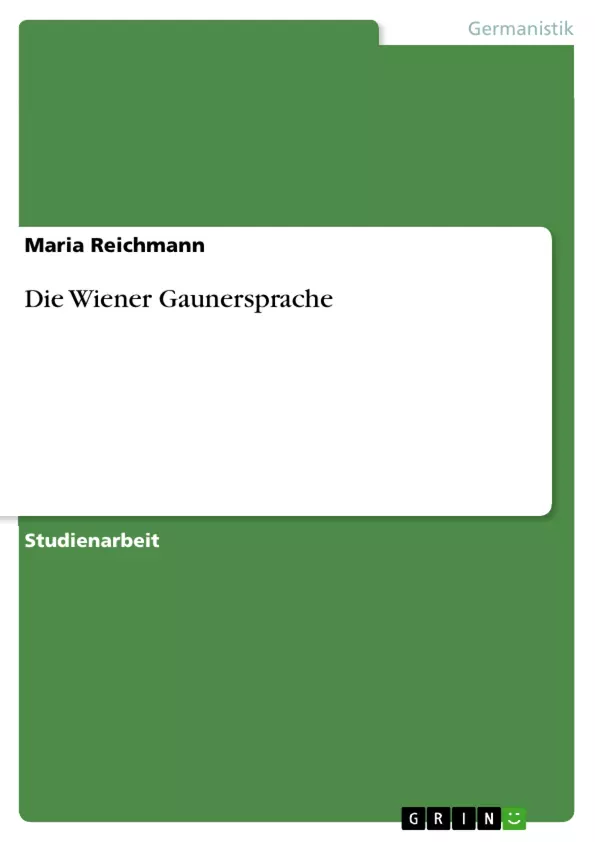Aus der Einleitung: Die Sondersprachenforschung befasst sich mit den sprachlichen Varietäten sozialer (Rand-)Gruppen, wozu auch die Geheimsprachen gehören. Die Wiener Gaunersprache – mit der sich meine Hausarbeit beschäftigt – ist eine solche Geheimsprache. Es liegt nahe, dass besonders bei kriminellen Aktivitäten höchste Geheimhaltung geboten ist. Dies geht folglich mit der Verschlüsselung der Sprache einher, um gewisse Nachrichten für Außenstehende unverständlich zu machen. Doch schon früh versuchte besonders die Obrigkeit, diese Geheimsprache zu entschlüsseln. So erstellte man so genannte Gaunerwörterbücher. Dies waren, wie der Name schon besagt, Wörterbücher mit Gaunerfachausdrücken. Diese verfolgten den Zweck, auf frischer Tat ertappte kleine Gauner besser zu verstehen und so der Tat zu überführen. Es diente den Polizisten also dazu, die Unterhaltungen und vor allem die Korrespondenzen von Strafhäftlingen nachzuvollziehen. So erklärt zum Beispiel Rudolph Fröhlich in seinem Buch „Die Gefährlichen Klassen Wiens“ wo der Ausdruck müllisieren (verhaftet werden) wahrscheinlich seinen Ursprung hat: „In den Gefängnissen ist das hauptsächliche Unterhaltungsspiel der lange Puff, auch Mühle ziehen genannt.“ So hat man, nachdem man müllisiert wurde also wieder viel Zeit, sich mit ‚Mühle ziehen’ zu beschäftigen.
Die Quellen der Gaunerwörterbücher speisten sich aus Verhören und Gesprächen der Kriminalbeamten mit Verbrechern, Zuhältern und Dirnen, Kerkerinschriften (beispielsweise Graffiti in Gefängnissen) sowie aus Briefen und Notizen von Verbrechern und bereits aufgezeichneten Wortsammlungen seit 1805.
Es gibt aber immer noch Fragen, die sich mir stellen: Wieso heißen die Gauner in Wien „Wiener Galerie“? Was beeinflusst und beeinflusste sie? Wie sieht die Zukunft der Gaunersprache aus und welche Auswüchse hat diese Sprache? Diese Fragen versuche ich in meiner Arbeit zu beantworten.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Wiener Galerie
- Die Sprache der Wiener Galerie
- Einführendes
- Einflüsse und Besonderheiten
- Einfluss der Sinti und Roma
- Deutscher Einfluss
- Politische Einflüsse
- Fachsprachen
- Die Paragraphensprache
- Bedeutungswandel
- Endsilbe
- Polysemie (Bedeutungsvielfalt)
- Die O-Sprache
- Gaunerwörterschwund
- Gaunerzinken
- Das Verständigen in Gefängnissen
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Wiener Gaunersprache, eine Geheimsprache krimineller Gruppen. Die Zielsetzung besteht darin, die Entstehung, Entwicklung und die sprachlichen Besonderheiten dieser Sondersprache zu beleuchten. Dabei werden die Einflüsse verschiedener Quellen und die aktuelle Situation der Sprache betrachtet.
- Entstehung und Entwicklung der Wiener Gaunersprache
- Sprachliche Besonderheiten und Einflüsse (z.B. Rotwelsch, Jiddisch, Mundart)
- Der Begriff "Wiener Galerie" und seine Bedeutung
- Veränderungen und der Einfluss von sozialen und politischen Faktoren
- Der gegenwärtige Zustand der Sprache und ihre Zukunftsaussichten
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema der Sondersprachenforschung und die Wiener Gaunersprache ein. Sie erläutert die Notwendigkeit von Geheimsprachen im kriminellen Kontext und die Bemühungen der Obrigkeit, diese zu entschlüsseln, beispielsweise durch die Erstellung von Gaunerwörterbüchern. Die Einleitung stellt zentrale Forschungsfragen, die im weiteren Verlauf der Arbeit beantwortet werden sollen, beispielsweise die Herkunft des Begriffs "Wiener Galerie" und die Einflüsse auf die Sprache.
Die Wiener Galerie: Dieses Kapitel befasst sich mit der Frage, warum sich Wiener Gauner selbst als "Galeristen" bezeichnen. Es werden verschiedene Theorien präsentiert, die auf historischen Beobachtungen des Opernpublikums und der Praxis von Gaunern basieren. Eine Theorie verknüpft den Begriff mit den "Parias" des Opernhauses, während eine andere die Anordnung von "Zündgebern" um einen Kartentisch beschreibt. Eine weitere Theorie verbindet den Begriff mit Polizeifotos von Kriminellen, die als "Galerie" bezeichnet wurden.
Die Sprache der Wiener Galerie: Dieses Kapitel analysiert die sprachlichen Besonderheiten der Wiener Gaunersprache. Es beschreibt die Zusammensetzung aus rotwelsch-jiddischen Elementen, Lehnwörtern und lokalen Mundartausdrücken, die oft abweichende Bedeutungen im Vergleich zum gängigen Wiener Dialekt aufweisen. Der grammatikalische und syntaktische Aufbau wird in Relation zur Wiener Alltagssprache gestellt. Es werden einzelne Einflüsse näher beleuchtet.
Gaunerwörterschwund: (Dieser Kapitelzusammenfassung fehlt der Text, daher kann keine Zusammenfassung erstellt werden.)
Gaunerzinken: (Dieser Kapitelzusammenfassung fehlt der Text, daher kann keine Zusammenfassung erstellt werden.)
Das Verständigen in Gefängnissen: (Dieser Kapitelzusammenfassung fehlt der Text, daher kann keine Zusammenfassung erstellt werden.)
Schlüsselwörter
Wiener Gaunersprache, Geheimsprache, Sondersprache, Rotwelsch, Jiddisch, Wiener Dialekt, "Wiener Galerie", kriminelle Sprache, Sprachwandel, Soziolinguistik.
Häufig gestellte Fragen zur Wiener Gaunersprache
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Wiener Gaunersprache, eine Geheimsprache krimineller Gruppen in Wien. Sie beleuchtet die Entstehung, Entwicklung und sprachlichen Besonderheiten dieser Sondersprache, berücksichtigt verschiedene Einflüsse und analysiert den aktuellen Zustand der Sprache.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Entstehung und Entwicklung der Wiener Gaunersprache, ihre sprachlichen Besonderheiten und Einflüsse (Rotwelsch, Jiddisch, Mundart), die Bedeutung des Begriffs "Wiener Galerie", den Einfluss sozialer und politischer Faktoren auf den Sprachwandel und den gegenwärtigen Zustand der Sprache mit Zukunftsaussichten.
Was ist die "Wiener Galerie"?
Die Arbeit untersucht verschiedene Theorien zur Bedeutung des Begriffs "Wiener Galerie" als Selbstbezeichnung Wiener Gauner. Theorien reichen von einer Verbindung zum Opernpublikum ("Parias") über die Anordnung von Gaunern um einen Spieltisch bis hin zu Polizeifotos von Kriminellen.
Welche sprachlichen Besonderheiten werden analysiert?
Die Analyse konzentriert sich auf die Zusammensetzung der Wiener Gaunersprache aus rotwelsch-jiddischen Elementen, Lehnwörtern und lokalen Mundartausdrücken. Es werden abweichende Bedeutungen im Vergleich zum gängigen Wiener Dialekt, der grammatikalische und syntaktische Aufbau sowie einzelne Einflüsse näher beleuchtet (z.B. Sinti und Roma, Deutsch, Politik, Fachsprachen).
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in Kapitel zu Einleitung, der Wiener Galerie, der Sprache der Wiener Galerie (inkl. detaillierter Unterkapitel zu Einflüssen und Besonderheiten), Gaunerwörterschwund, Gaunerzinken, dem Verständigen in Gefängnissen und einem Fazit. Leider sind die Zusammenfassungen zu den Kapiteln "Gaunerwörterschwund", "Gaunerzinken" und "Das Verständigen in Gefängnissen" unvollständig.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Wiener Gaunersprache, Geheimsprache, Sondersprache, Rotwelsch, Jiddisch, Wiener Dialekt, "Wiener Galerie", kriminelle Sprache, Sprachwandel, Soziolinguistik.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, die Entstehung, Entwicklung und sprachlichen Besonderheiten der Wiener Gaunersprache zu untersuchen und die Einflüsse verschiedener Quellen sowie die aktuelle Situation der Sprache zu beleuchten.
- Quote paper
- Maria Reichmann (Author), 2007, Die Wiener Gaunersprache, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/173063