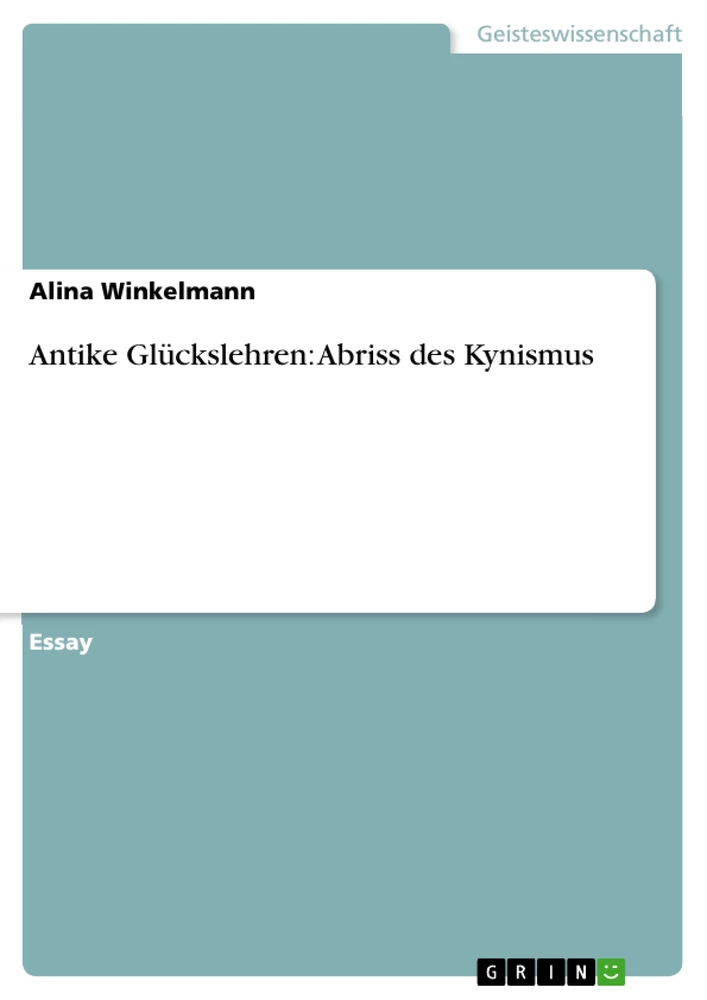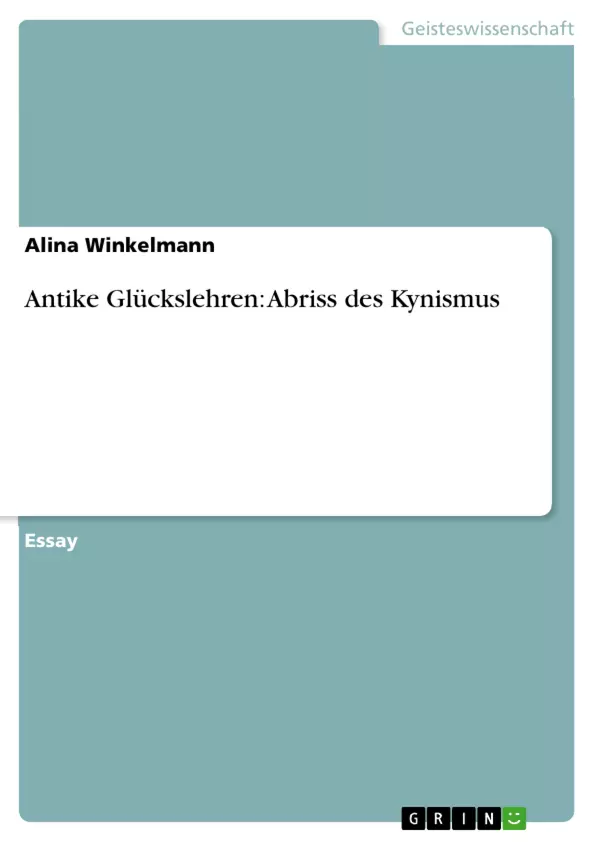„Der Weise ist sich selbst genug […].“1) – So lautet eine der zentralen Grundsätze der kynischen Philosophie. Doch wie begründet sich diese These? Durch was wird sie gestützt? Ist ein Leben ohne jeglichen materiellen Besitz möglich? Wenn ja, wie?
Diese und weitere Fragen sollen Gegenstand der vorliegenden Hausarbeit sein. Um die Grundzüge des Kynismus zu verstehen, werde ich zunächst die Lehren und Inhalte deutlich machen, die der Kynismus hervorbrachte und lehrte. Welche Einstellungen haben Kyniker im Hinblick auf die Philosophie selbst, Sozialität, Politik und vermeintlichen Gütern wie Lust und Reichtum? Wie gelangt man zur Glückseligkeit? Wie verhält es sich mit Tugenden und Lastern?
Hierbei werde ich mich vor allem bereits auf die Einstellungen und Lehren von Antisthenes von Athen beziehen.
Danach folgt die Darstellung zweier bedeutender Philosophen dieser Schule: den bereits genannten Anthistenes von Athen, dem Begründer des Kynismus, und Diogenes von Sinope, dem wohl bekanntesten Philosophen jener Schule, der durch sein bedürfnisloses Leben in einer Tonne populär wurde. Zusätzlich werde ich deren Hinwenden zum Kynismus skizzieren, persönliche Lebensanschauungen und -weisen einbeziehen und dabei auch ihre Bedeutung für die kynische Philosophie erläutern.
Im Anschluss an die Darstellung von Diogenes von Sinope folgt ein kurzer Überblick, wie sich der Kynismus zum Zynismus entwickelte, der uns heute auch noch ein Begriff ist: mit negativer semantischer Besetzung und nicht mehr der gleichen inhaltlichen Bedeutung wie noch im 5. Jahrhundert vor Christus.
Im letzten Teil der vorliegenden Arbeit reflektiere ich abschließend kurz, worin die richtige Lebensweise – anhand des Kynismus - besteht und fasse die wichtigsten Antworten der oben genannten Problemfragen zusammen.
Inhaltsverzeichnis
- Vorwort
- Lehren und Inhalte
- Antisthenes von Athen
- Diogenes von Sinope
- Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Hausarbeit befasst sich mit dem Kynismus, einer antiken philosophischen Schule, die sich durch ihren Fokus auf ein tugendhaftes und unabhängiges Leben auszeichnete. Ziel der Arbeit ist es, die Grundzüge des Kynismus zu verstehen und die Lehren der wichtigsten Vertreter, Antisthenes von Athen und Diogenes von Sinope, darzustellen.
- Das Streben nach Glückseligkeit als zentrales Thema des Kynismus
- Die Bedeutung der Tugendlehre und die Betonung von Unabhängigkeit und Autarkie
- Die Kritik an Lust, Reichtum und gesellschaftlichen Konventionen
- Die Rolle von Staat und Politik in der kynischen Philosophie
- Die Besonderheiten des Umgangs mit Menschen und die Ablehnung von Lob und Anerkennung
Zusammenfassung der Kapitel
Vorwort
Die Einleitung stellt die zentralen Fragen der Hausarbeit vor und erläutert den Ansatz der Untersuchung. Sie erklärt die Bedeutung von Unabhängigkeit und Autarkie im Kynismus sowie die Frage nach der Möglichkeit eines Lebens ohne materiellen Besitz. Die Einleitung führt in die wichtigsten Themenbereiche der Arbeit ein und zeigt auf, welche Aspekte im Einzelnen behandelt werden sollen.
Lehren und Inhalte
Dieses Kapitel behandelt die grundlegenden Lehren und Inhalte des Kynismus. Es wird erläutert, wie die Kyniker das Glück erreichen wollten und welche Rolle die Tugendlehre dabei spielte. Die Kritik an Lust, Reichtum und gesellschaftlichen Konventionen sowie die besondere Sichtweise auf Staat und Politik werden ebenfalls beleuchtet.
Antisthenes von Athen
Dieses Kapitel befasst sich mit Antisthenes von Athen, dem Begründer der kynischen Philosophie. Es werden seine Lebensgeschichte, seine philosophischen Ansichten und seine Bedeutung für die Entwicklung des Kynismus dargestellt.
Diogenes von Sinope
Dieses Kapitel widmet sich Diogenes von Sinope, einem der bekanntesten Vertreter des Kynismus. Es wird sein Leben, seine Philosophie und sein Einfluss auf die kynische Tradition beleuchtet.
Schlüsselwörter
Die zentralen Schlüsselwörter des Textes sind: Kynismus, Glückseligkeit, Tugend, Unabhängigkeit, Autarkie, Bedürfnislosigkeit, Antisthenes von Athen, Diogenes von Sinope, Lust, Reichtum, Staat, Politik, Selbstbewusstsein, Lob, Anerkennung.
- Quote paper
- Alina Winkelmann (Author), 2011, Antike Glückslehren: Abriss des Kynismus, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/173157