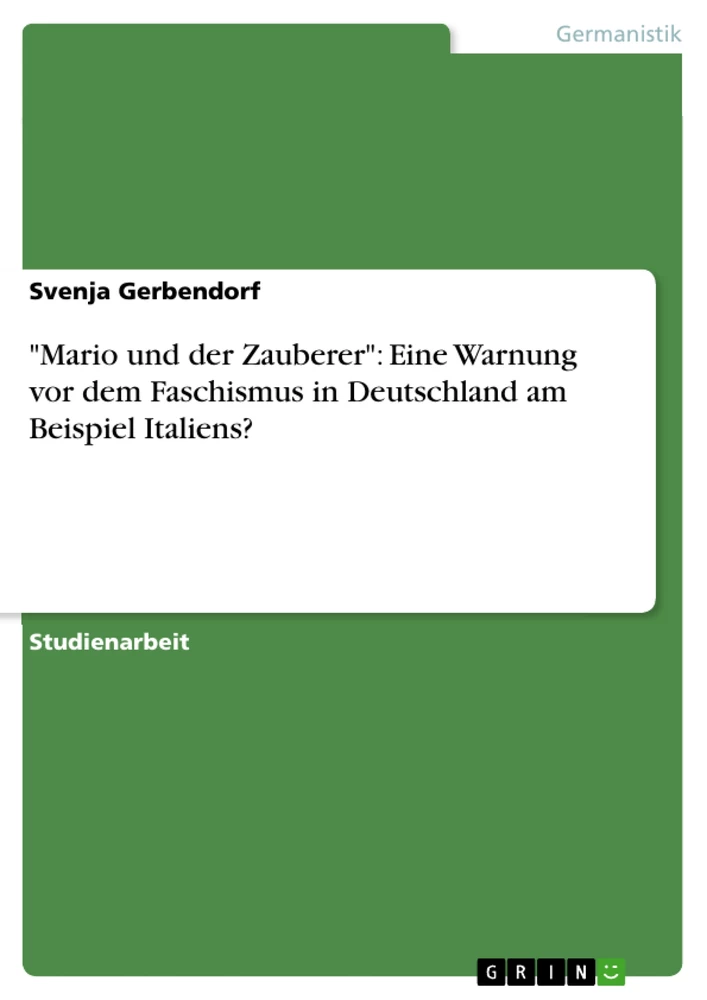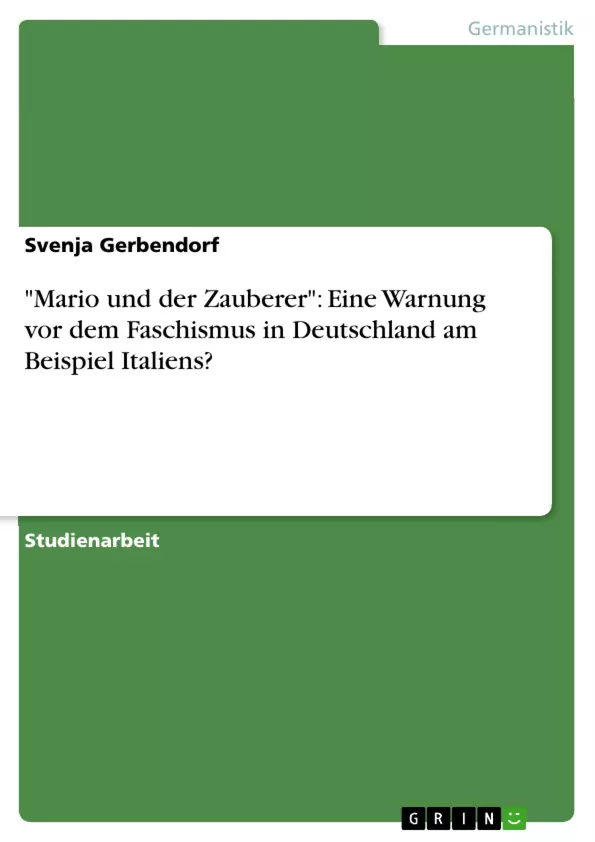Eines der bekanntesten Werke Thomas Manns ist die Novelle „Mario und der Zauberer. Ein tragisches Reiseerlebnis“, welches er 1929 während eines Aufenthaltes an der Ostsee schrieb und das im Jahr 1930 erschien. Es ist gleichzeitig eines der meistanalysierten Werke Manns. In der Forschung sind sehr viele und sehr verschiedene Interpretationen und Interpretationsansätze vertreten. Dies liegt wohl hauptsächlich an den unterschiedlichen Aussagen, die der Autor im Laufe der Zeit zu der Novelle getätigt hat, beruhend auf seinen wechselnden politischen Ansichten.
Die Novelle beruht auf einem zweiwöchigen Badeurlaub, den Thomas Mann mit seiner Familie im September 1926 nach Forte dei Marmi unternahm. Einige der erzählten Vorfälle hat die Familie tatsächlich so erlebt. So wird denn auch über einen wachsenden Nationalismus und Fremdenfeindlichkeit berichtet. Aber war der einzige Zweck, zu dem Thomas Mann die Novelle schrieb, der, einen Reisebericht abzuliefern? Oder wollte er noch mehr? Er sah, wie sich die faschistische Diktatur in Italien immer mehr etablierte. Sah er auch Gleiches in Deutschland herannahen und wollte davor warnen?
Dies zu klären ist das Ziel der vorliegenden Arbeit. Daraus resultierend wird als erstes der italienische Faschismus behandelt um einen Überblick über den geschichtlichen Kontext zu gewinnen. Anschließend wird auf Thomas Manns Verhältnis zu Italien und später auch zur Politik eingegangen. Danach wird der Inhalt der Novelle kurz geklärt, um schließlich die Warnungen in „Mario und der Zauberer“ herauszuarbeiten.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2.1 Italienischer Faschismus
- 2.2 Thomas Manns Verhältnis zu Italien
- 2.3 Thomas Mann und die Politik
- 3. Inhaltsangabe
- 4. Die faschistischen Bezüge in „Marion und der Zauberer“
- 5. Schlussbetrachtung
- 6. Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit analysiert Thomas Manns Novelle „Mario und der Zauberer“ und untersucht, ob sie als Warnung vor dem aufkommenden Faschismus in Deutschland, am Beispiel Italiens, zu verstehen ist. Ziel der Arbeit ist es, den geschichtlichen Kontext des italienischen Faschismus zu beleuchten, Thomas Manns Verhältnis zu Italien und zur Politik zu erörtern und schließlich die Warnungen in „Mario und der Zauberer“ herauszuarbeiten.
- Der Italienische Faschismus als historischer Hintergrund
- Thomas Manns Verhältnis zu Italien und die Ambivalenz seiner Sichtweise
- Thomas Manns politische Ansichten und ihre Einwirkung auf sein Werk
- Die Warnungen in „Mario und der Zauberer“ vor faschistischen Tendenzen
- Die Interpretation der Novelle im Kontext des damaligen Zeitgeschehens
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik der Novelle „Mario und der Zauberer“ ein und stellt die Zielsetzung der Arbeit vor. Sie beleuchtet die vielfältigen Interpretationen des Werkes und den Einfluss von Thomas Manns wechselnden politischen Ansichten. Im ersten Kapitel wird der Italienische Faschismus als geschichtlicher Kontext vorgestellt, wobei insbesondere die Rolle Benito Mussolinis und die Entstehung der faschistischen Bewegung im Fokus stehen. Das zweite Kapitel befasst sich mit Thomas Manns Beziehung zu Italien und seiner ambivalenten Sicht auf das Land. Das dritte Kapitel untersucht Thomas Manns politische Ansichten im Laufe seines Lebens und die Auswirkungen seiner politischen Entwicklung auf sein Werk.
Schlüsselwörter
Die vorliegenden Arbeit beschäftigt sich mit der Novelle „Mario und der Zauberer“ von Thomas Mann, dem Italienischen Faschismus, Thomas Manns Verhältnis zu Italien und der Politik sowie den Warnungen vor faschistischen Tendenzen in der Novelle. Weitere Schlüsselbegriffe sind Benito Mussolini, die „fasci di combattimento“, die „privilegierte Schicht“ und die „Verstümmelung des Sieges“.
Häufig gestellte Fragen
Ist Thomas Manns „Mario und der Zauberer“ eine Warnung vor dem Faschismus?
Ja, die Arbeit untersucht, wie Mann die Erlebnisse in Italien nutzte, um vor den herannahenden faschistischen Tendenzen in Deutschland zu warnen.
Welchen realen Hintergrund hat die Novelle?
Die Erzählung beruht auf einem Familienurlaub der Manns im Jahr 1926 in Forte dei Marmi, bei dem sie Nationalismus und Fremdenfeindlichkeit erlebten.
Wer ist die historische Vorlage für die faschistischen Bezüge?
Der italienische Faschismus unter Benito Mussolini dient als direkter geschichtlicher Kontext für die Erzählung.
Wie veränderte sich Thomas Manns politische Haltung?
Mann entwickelte sich von einem eher unpolitischen Autor zu einem scharfen Kritiker des Nationalsozialismus, was seine späteren Werkinterpretationen beeinflusste.
Was symbolisiert der Zauberer Cipolla in der Geschichte?
Cipolla wird oft als Verkörperung des Demagogen und der hypnotischen Kraft faschistischer Führer interpretiert, die den Willen des Volkes brechen.
- Citation du texte
- Svenja Gerbendorf (Auteur), 2011, "Mario und der Zauberer": Eine Warnung vor dem Faschismus in Deutschland am Beispiel Italiens?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/173176