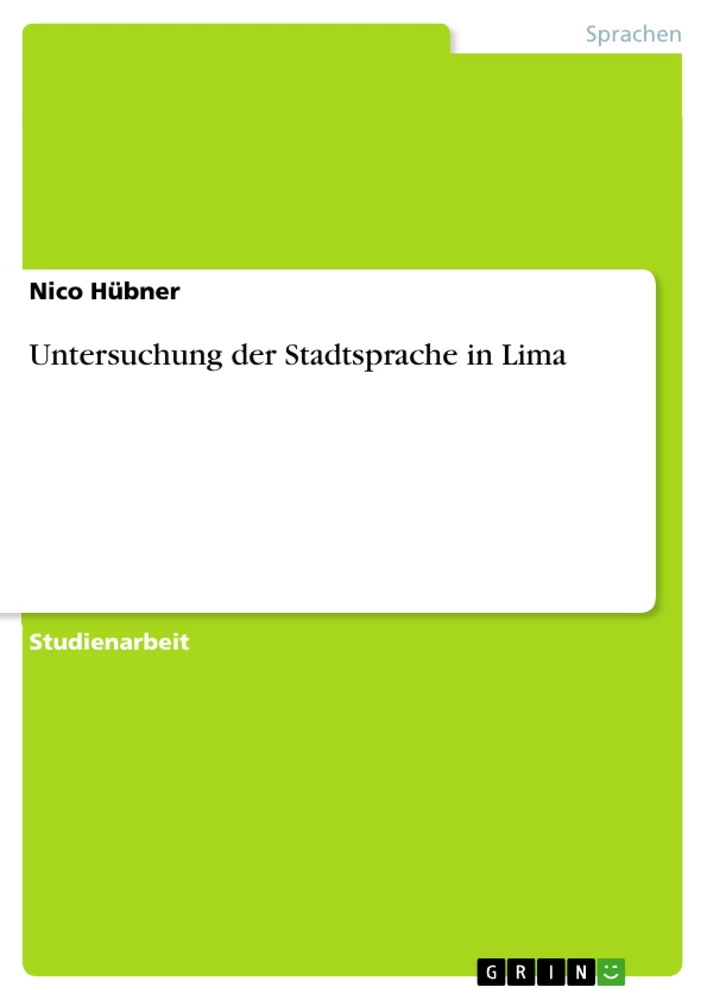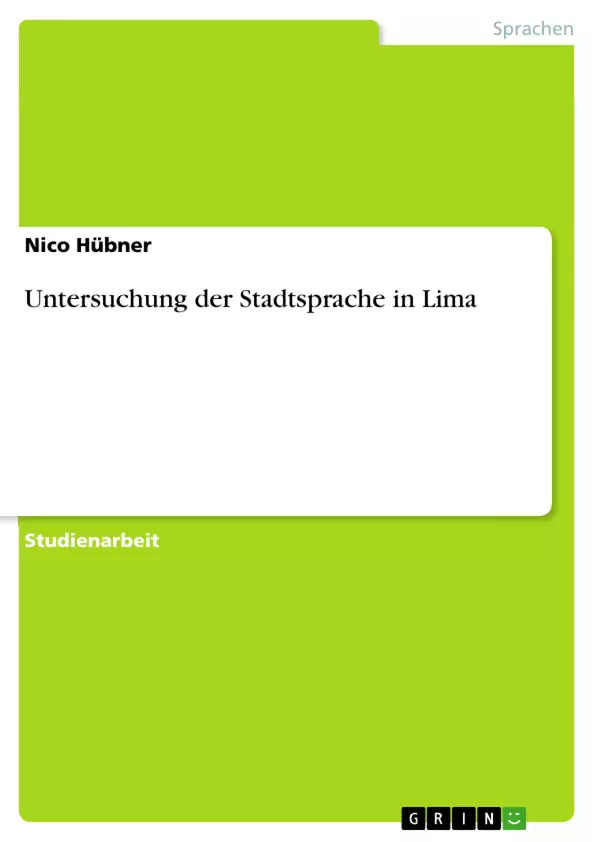Dank der großen Migrationsbewegungen im 20. und 21. Jahrhundert ist die Hauptstadt Perus zu einer der größten Metropolen Lateinamerikas angewachsen. Durch einen „proceso que envuelve, en gran medida, a mundos culturales distintos“ [, se enlazó] un universo rural […] con un mundo urbano (Caravedo 1990: 18). Im Zuge dessen hat sich in Lima ein heterogenes Stadtbild herausgebildet, dessen kulturelle und sprachliche Divergenz im Interesse zahlreicher Studien stehen und auch Teil dieser Arbeit sein sollen.
Wie wir im Folgenden sehen werden, geht diese „diversificación cultural [einher mit einem] contacto y [..] conflicto de lenguas diversas, tipológicamente muy distintas, como lo son el español y el quechua“ (ebd. 18). Neuere Studien, wie u.a. Godenzzi (2008), beschäftigen sich in diesem Zusammenhang mit den sozio-linguistischen Auswirkungen dieses Sprachkontaktes in den verschiedenen sozialen Schichten Limas und zeigen, dass sich Sprache hier zum Identifikations- und Distinktionsmerkmal entwickelt hat.
Ziel dieser Arbeit ist es, die verschiedenen Faktoren, die für diese Entwicklung ausschlaggebend waren, aufzuzeigen. Dazu wird zuerst ein Blick auf die Geschichte der Kolonialzeit Perus geworfen, die durch einen „contacto lingüístico [entre] hablantes monolingües del español [y] quechuahablantes de la zona andina“ (Fernández 2008: 34) gekennzeichnet war. Dabei soll Lima als Zentrum dieses Kontaktes charakterisiert werden, wobei hier das Augenmerk auf der demografischen Entwicklung liegt.
Im weiteren Verlauf sollen dann die unterschiedlichen Gründe für die Urbanisierung im 20. Jahrhundert aufgezeigt werden, um danach einen erneuten Blick auf Lima als primäres Ziel dieser Landflucht zu werfen. Im engeren Interesse stehen hier die neu gegründeten Stadtviertel, in denen sich die Migranten vorwiegend ansiedelten. Damit einhergehend wird jetzt das Thema ihrer Integration aufgegriffen, aus der sich schnell Konflikte im Zusammenleben der einzelnen Bevölkerungsgruppen ergaben. Diese Differenzen machten in kurzer Zeit „la forma de hablar español [zu einem] elemento importante […] para identificar y diferenciar a los limeños“ (Smith 2008: 79).
Um hier eine Unterscheidung vornehmen zu können, widmet sich der nächste Abschnitt der Entstehung des Castellano Andino. Dafür soll abermals ein Blick auf die frühe Kolonialzeit geworfen werden, wobei nun der Fokus auf dem Quechua als die prominenteste beeinflussende Sprache liegt. Danach sollen Anhand ausgewählter Beispiel...
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Geschichte
- 2.1. Sprachkontakt während der Kolonialzeit
- 2.2. Lima in der Kolonialzeit
- 3. Urbanisierung
- 3.1. Urbanisierung im 20. Jahrhundert
- 3.2. Lima heute
- 4. Entstehung des Castellano Andino
- 4.1. Frühe Andinisierung des Spanischen
- 4.2. Merkmale des Quechua im Castellano Andino
- 4.2.1. Phonetik - Phonologie
- 4.2.2. Morphosyntax
- 4.2.3. Lexik
- 5. Lima im 21. Jahrhundert
- 5.1. Der Migrant erster Generation
- 5.2. Der Neo-Limeño
- 5.3. Der Alt-Limeño
- 6. Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Entwicklung der Stadtsprache Limas unter dem Einfluss von Migration und Sprachkontakt. Sie analysiert die Faktoren, die zur sprachlichen Vielfalt und der Herausbildung des Castellano Andino beigetragen haben. Der Fokus liegt auf der soziolinguistischen Entwicklung und der Rolle der Sprache als Identifikations- und Distinktionsmerkmal.
- Sprachkontakt zwischen Spanisch und Quechua während der Kolonialzeit
- Urbanisierung und Migration als Triebkräfte sprachlicher Veränderung
- Entstehung und Merkmale des Castellano Andino
- Soziolinguistische Auswirkungen des Sprachkontakts in Lima
- Sprache als Identifikations- und Distinktionsmerkmal in den verschiedenen sozialen Schichten Limas
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung beschreibt die sprachliche und kulturelle Heterogenität Limas als Folge von Migration und Sprachkontakt. Sie benennt das Ziel der Arbeit: die Analyse der Faktoren, die zu dieser Entwicklung geführt haben, unter besonderer Berücksichtigung der Kolonialzeit, der Urbanisierung und der Entstehung des Castellano Andino. Die Einleitung betont die Bedeutung der Sprache als Identifikationsmerkmal und stellt den soziolinguistischen Ansatz der Arbeit heraus.
2. Geschichte: Dieses Kapitel behandelt den Sprachkontakt zwischen Spanisch und Quechua während der Kolonialzeit. Es beschreibt, wie die Notwendigkeit des Quechua-Erlernens durch die Kolonialherren zur Evangelisierung der indigenen Bevölkerung erkannt wurde. Die Institutionalisierung des Quechua an den Universitäten von Mexiko und Lima wird hervorgehoben, ebenso wie die besondere Rolle des Quechua im Vergleich zu anderen Kolonisationskontexten. Die Entwicklung von der königlichen Anordnung zum Erlernen von Quechua hin zu einer stärkeren Durchsetzung des Spanischen wird ebenfalls beleuchtet, zusammen mit den Argumenten, die dafür verwendet wurden.
3. Urbanisierung: Dieses Kapitel beleuchtet die Urbanisierungsprozesse im 20. Jahrhundert und deren Auswirkungen auf die Stadtsprache Limas. Es analysiert die Gründe für die Landflucht und die Entstehung neuer Stadtviertel, die von Migranten bewohnt wurden. Der Schwerpunkt liegt auf den Integrations- und Konfliktprozessen zwischen den verschiedenen Bevölkerungsgruppen und wie die Sprache als Mittel der Identifikation und Differenzierung fungierte.
4. Entstehung des Castellano Andino: Dieses Kapitel befasst sich mit der Entstehung des Castellano Andino, beginnend mit der frühen Kolonialzeit und dem Einfluss des Quechua. Es analysiert anhand von Beispielen die wichtigsten Merkmale des vom Quechua beeinflussten Spanisch, auf phonetischer, morphosyntaktischer und lexikalischer Ebene.
5. Lima im 21. Jahrhundert: Dieses Kapitel beschreibt die soziolinguistische Situation Limas im 21. Jahrhundert und differenziert zwischen den verschiedenen Bevölkerungsgruppen (Migranten der ersten Generation, Neo-Limeños, Alt-Limeños). Es analysiert die Rolle des Soziolekts als Unterscheidungskriterium und den ständigen Adaptionsprozess der Sprache im Kontext des Zusammenlebens der verschiedenen Gruppen. Die „soziale Bewertung“, bei der das Andinische den letzten Platz einnimmt, wird thematisiert.
Schlüsselwörter
Limas Stadtsprache, Sprachkontakt, Quechua, Spanisch, Castellano Andino, Urbanisierung, Migration, Soziolinguistik, Identifikation, Differenzierung, Kolonialzeit, Soziolekt.
Häufig gestellte Fragen zur Entwicklung der Stadtsprache Limas
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Entwicklung der Stadtsprache Limas unter dem Einfluss von Migration und Sprachkontakt. Sie analysiert die Faktoren, die zur sprachlichen Vielfalt und der Herausbildung des Castellano Andino beigetragen haben, mit Fokus auf soziolinguistische Entwicklung und die Rolle der Sprache als Identifikations- und Distinktionsmerkmal.
Welche Zeiträume werden betrachtet?
Die Arbeit betrachtet verschiedene Zeiträume, beginnend mit der Kolonialzeit und dem damit verbundenen Sprachkontakt zwischen Spanisch und Quechua, über die Urbanisierungsprozesse des 20. Jahrhunderts bis hin zur soziolinguistischen Situation Limas im 21. Jahrhundert.
Welche Schlüsselthemen werden behandelt?
Schlüsselthemen sind der Sprachkontakt zwischen Spanisch und Quechua während der Kolonialzeit, Urbanisierung und Migration als Triebkräfte sprachlicher Veränderung, die Entstehung und Merkmale des Castellano Andino, soziolinguistische Auswirkungen des Sprachkontakts in Lima und die Sprache als Identifikations- und Distinktionsmerkmal in den verschiedenen sozialen Schichten Limas.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in Kapitel zu Einleitung, Geschichte (Sprachkontakt in der Kolonialzeit, Lima in der Kolonialzeit), Urbanisierung (20. Jahrhundert, Lima heute), Entstehung des Castellano Andino (frühe Andinisierung, Merkmale des Quechua im Castellano Andino: Phonetik-Phonologie, Morphosyntax, Lexik), Lima im 21. Jahrhundert (Migranten der ersten Generation, Neo-Limeños, Alt-Limeños) und Zusammenfassung. Jedes Kapitel behandelt spezifische Aspekte der Sprachentwicklung Limas.
Was ist der Castellano Andino und wie ist er entstanden?
Der Castellano Andino ist eine vom Quechua beeinflusste Variante des Spanischen. Seine Entstehung wird in der Arbeit von der frühen Kolonialzeit und dem Einfluss des Quechua auf phonetischer, morphosyntaktischer und lexikalischer Ebene analysiert.
Welche Rolle spielt die Migration?
Migration, insbesondere die Landflucht und die Entstehung neuer Stadtviertel durch Migranten, wird als zentrale Triebkraft der sprachlichen Veränderung in Lima hervorgehoben. Die Integrations- und Konfliktprozesse zwischen den verschiedenen Bevölkerungsgruppen und die Rolle der Sprache als Mittel der Identifikation und Differenzierung werden analysiert.
Welche sozialen Gruppen werden unterschieden?
Die Arbeit differenziert zwischen Migranten der ersten Generation, Neo-Limeños (Neu-Limeños) und Alt-Limeños (alteingesessene Limeños) und analysiert die Rolle des Soziolekts als Unterscheidungskriterium und den ständigen Adaptionsprozess der Sprache im Kontext des Zusammenlebens der verschiedenen Gruppen. Die „soziale Bewertung“ der verschiedenen Sprachvarianten wird ebenfalls thematisiert.
Welche Methoden werden angewendet?
Die Arbeit verwendet einen soziolinguistischen Ansatz, um die sprachliche Entwicklung Limas zu analysieren. Die Analyse der Faktoren, die zu dieser Entwicklung geführt haben, steht im Vordergrund. Die Bedeutung der Sprache als Identifikationsmerkmal wird betont.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Limas Stadtsprache, Sprachkontakt, Quechua, Spanisch, Castellano Andino, Urbanisierung, Migration, Soziolinguistik, Identifikation, Differenzierung, Kolonialzeit, Soziolekt.
Wo finde ich weitere Informationen?
Weitere Informationen finden sich im vollständigen Text der Arbeit (nicht hier enthalten).
- Quote paper
- Nico Hübner (Author), 2011, Untersuchung der Stadtsprache in Lima, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/173216