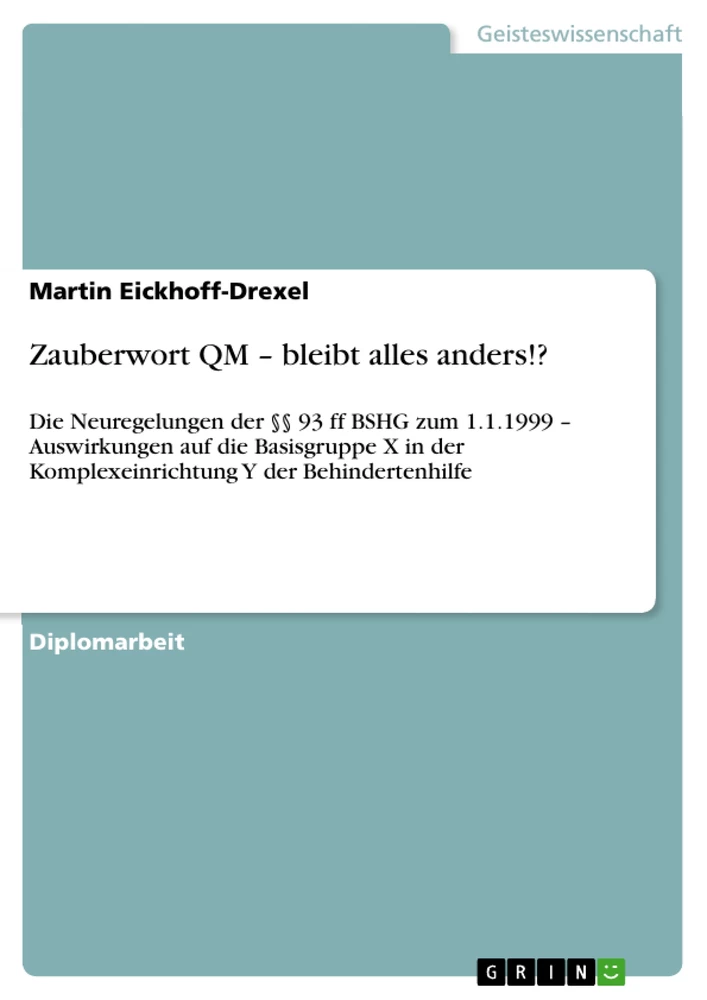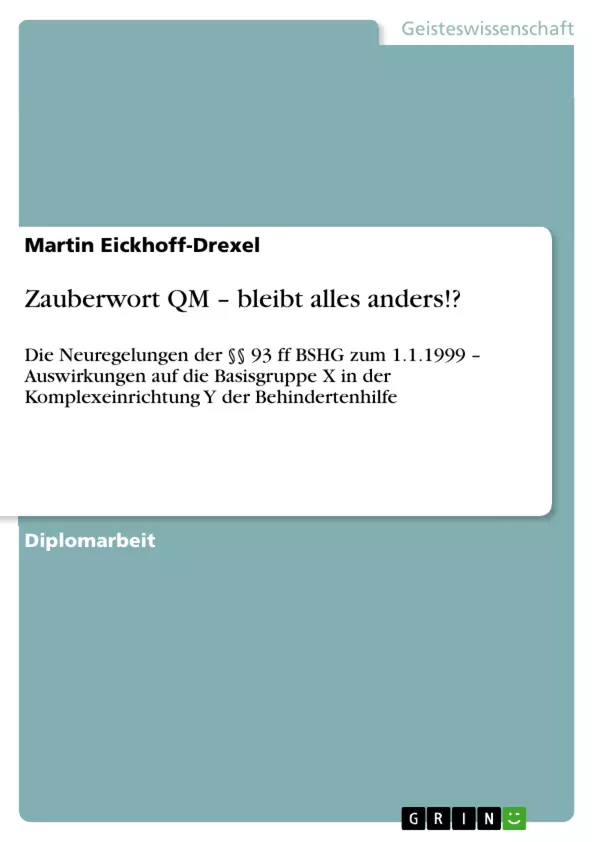Sagen Sie: „Im Interesse des Wohlbefindens des Klienten spreche ich meinen Kollegen auf sein Verhalten an.“ – Oder: „Im Interesse des Wohlbefindens des Klienten spreche ich meinen Kollegen auf dessen Verhalten an.“?
Bleibt alles? Ziel und Aufgabe der Eingliederungshilfe bleiben auch bei weiteren Veränderungen bestehen! - Bleibt alles anders? Methoden und Steuerungsprozesse müssen sich verändern, um weiterhin dem Ziel und der Aufgabe gerecht zu werden! Ich will Mut machen QM (Qualitätsmanagement) als Methode der reflektierten Zuneigung zu den Menschen zu begreifen.
Um>>denken: ... Wir haben verstanden! So etwa lautet der Werbespruch einer deutschen Automarke. Dieses Leitbild würde auch Einrichtungen der Behindertenhilfe gut zu Gesicht stehen. Das Zitat am Anfang weist auf das Umdenken hin, verweist damit auf die veränderte
Bedarfslage von Menschen mit sogenannten Behinderungen.
Im offenen Markt für soziale Dienstleistungen sind Veränderungen notwendig, um dem veränderten Bedarf zu entsprechen. Dabei handelt es sich weniger um einen Wertewandel, weil die Werte und Ideen der Eingliederungshilfe bestehen bleiben, sondern um einen Rollenwechsel
oder Bildwechsel: Nicht mehr das Geld folgt der Leistung nach dem Subsidiaritätsprinzip, sondern das Geld folgt der Leistung nach Bedingungen der in den §§ 93 ff. BSHG benannten prospektiven Refinanzierung. Das bisherige Denken sagte: erst muss ich den Bedarf bestimmen, dann kann ich nach dem Preis fragen. Die einfache Umkehrung (erst den Preis bestimmen, dann nach dem Bedarf fragen) hilft nicht bei dem Umdenken und würde die Sozialarbeit zum Abhängigen der Ökonomie machen. Heute ist gefordert, erst die Erwartungen der Kunden zu erfragen, ein leistungsfähiges Angebot zu machen und dann den Preis zu bestimmen. Ohne mit der ökonomischen Komponente argumentieren zu können, wird es nicht mehr möglich sein, Leistungsvereinbarungen mit den Geldgebern abzuschließen.
In der Entwicklung des Helferbildes wird die Zielrichtung der Veränderungen zur weiteren ambulanten Betreuung benannt. Mit diesem Leitbild ist die Auswahl eines Qualitätsmanagementkonzeptes möglich, welches nachhaltig Orientierung für Kunden und Mitarbeiter bietet und dadurch einen wertschöpfenden Beitrag zur gesellschaftlichen Entwicklung gestaltbar macht. Am Beispiel einer Basisgruppe der Behindertenhilfe werden Elemente des Qualitätskonzeptes diskutiert und Ausblicke auf kurz- und mittelfristig umzusetzende Aufgaben vermittelt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Neuregelungen der §§ 93 ff BSHG
- Leistung folgt Geld ?
- Die Reform der Sozialpolitik nach der Wiedervereinigung"
- Das Gesetz zur Reform des Sozialhilferechtes vom 23. Juli 1996 und die Gültigkeitsstufen zum 1. August 1996 und zum 1. Januar 1999
- Die Landesrahmenverträge nach § 93 d BSHG n.F.
- Von der Armenfürsorge zum Sozialdienstleister
- Die Institutionalisierung der Ausgrenzung
- Geld folgt Leistung !
- Grundgesetz und Bundessozialhilfegesetz
- Entwicklungen der 90er Jahre
- Leistungskatalog oder persönliches Budget?
- - und wie geht's weiter?
- Der Begriff der Behinderung – Eine Neuorientierung
- Was darf Behinderung kosten?
- Die Ökonomisierung des Sozialen
- Controlling
- Was erwarten die Leistungsgeber?
- Kundenrecht = Wahlrecht?
- Der Paradigmenwechsel: Vom WAS zum WIE
- Das medizinisch-psychiatrische Modell
- Das rehabilitative Modell
- Das Assistenz-Modell
- Der Rollenwechsel
- Die SIVUS-Methode
- Enthospitalisierung und Deinstitutionalisierung
- Ende der Ver-Anstaltung
- Qualitätsmanagement
- Definition und Ursprung
- Festlegung von Qualitäts-Standards
- Qualitätsmanagement als Prozessgestaltung
- Methoden der Prozessgestaltung
- Der Qualitäts-Begriff
- Definition
- Problematik
- Das Qualitäts-Konzept
- Qualitätsmanagement im industriellen Bereich
- Qualitätsmanagement im Bereich sozialer Dienstleister
- Vergleich und Kritik der Modelle
- QM in der Komplexeinrichtung Y der Behindertenhilfe:
- Konzept, Prozessgestaltung und Ressourcennutzung.
- Elemente des normativen und strategischen Managements
- Elemente der Struktur, der Aufbau- und Ablauforganisation
- Elemente der Gemeinwesenorientierung
- Dienstleistungsbezogene Elemente
- Die Praxis auf der Basisebene
- Betreuungsplanung und Dokumentationssystem
- Bezugspersonensystem
- DOKU, BZPS und jetzt auch noch QM?
- Bewertung und Weiterführung
- Kurz- und mittelfristig umzusetzende Aufgaben
- Zukünftige Anforderungen an die Einrichtungen und ihre Mitarbeiter
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Diplomarbeit von Martin Eickhoff befasst sich mit den Auswirkungen der Neuregelungen der §§ 93 ff BSHG zum 1. Januar 1999 auf die Basisgruppe X in der Komplexeinrichtung Y der Behindertenhilfe. Der Schwerpunkt liegt auf der Analyse der Auswirkungen des Qualitätsmanagements (QM) auf die Arbeit der Einrichtung und die Betreuung der Menschen mit Behinderung.
- Einführung des Qualitätsmanagements in der Behindertenhilfe
- Die Folgen der Ökonomisierung des Sozialen
- Der Paradigmenwechsel von einem medizinisch-psychiatrischen Modell hin zu einem Assistenz-Modell
- Die Auswirkungen der Neuregelungen der §§ 93 ff BSHG auf die Praxis
- Die Rolle des Qualitätsmanagements in der Betreuung von Menschen mit Behinderung
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Diese Einleitung stellt das Thema der Diplomarbeit vor und erläutert die Relevanz der Neuregelungen der §§ 93 ff BSHG im Kontext der Behindertenhilfe.
- Die Neuregelungen der §§ 93 ff BSHG: Dieses Kapitel analysiert die Reform der Sozialpolitik nach der Wiedervereinigung und die damit einhergehenden Neuregelungen des Sozialhilferechts. Es werden die Landesrahmenverträge nach § 93 d BSHG n.F. und die Auswirkungen auf die Finanzierung von Leistungen in der Behindertenhilfe beleuchtet.
- Von der Armenfürsorge zum Sozialdienstleister: Dieses Kapitel untersucht die Transformation der Behindertenhilfe von einem Modell der Armenfürsorge hin zu einem sozialdienstlichen Ansatz. Es werden die Institutionalisierung der Ausgrenzung und die Rolle des Geldes in der Finanzierung von Leistungen in der Behindertenhilfe diskutiert.
- - und wie geht's weiter?: In diesem Kapitel wird der Begriff der Behinderung neu definiert und der Fokus auf die Ökonomisierung des Sozialen gelegt. Es werden die Auswirkungen von Controlling und Kundenrecht in der Behindertenhilfe diskutiert.
- Die Ökonomisierung des Sozialen: Dieses Kapitel analysiert den Einfluss von Controlling und Kundenrecht auf die Behindertenhilfe. Es wird die Frage nach der finanziellen Belastung durch Behinderung und die damit einhergehende Forderung nach Wirtschaftlichkeit untersucht.
- Der Paradigmenwechsel: Vom WAS zum WIE: Dieses Kapitel beleuchtet den Wandel vom medizinisch-psychiatrischen Modell hin zu einem rehabilitativen und assistierenden Modell der Behindertenhilfe. Es wird die Rolle des individuellen Assistenzbedarfs und die Abkehr von einer institutionellen Betreuung diskutiert.
- Der Rollenwechsel: Dieses Kapitel analysiert den veränderten Rollenwechsel zwischen Menschen mit Behinderung und den professionellen Betreuern. Es werden die Möglichkeiten der Enthospitalisierung und Deinstitutionalisierung und die damit verbundenen Herausforderungen in der Praxis beleuchtet.
- Das Zauberwort: QM (Qualitätsmanagement): Dieses Kapitel definiert und erläutert das Konzept des Qualitätsmanagements und seine Relevanz in der Behindertenhilfe. Es werden die verschiedenen Methoden der Prozessgestaltung und die Anwendung von Qualitätsstandards in der Betreuung von Menschen mit Behinderung vorgestellt.
- Auswirkungen auf die Basisgruppe X: Dieses Kapitel analysiert die konkrete Umsetzung des Qualitätsmanagements in der Komplexeinrichtung Y der Behindertenhilfe. Es werden die Auswirkungen auf die Basisgruppe X und die einzelnen Elemente des Qualitätsmanagements, wie z.B. die Betreuungsplanung und das Bezugspersonensystem, beschrieben.
Schlüsselwörter
Die Diplomarbeit von Martin Eickhoff befasst sich mit zentralen Themen der Behindertenhilfe, wie der Ökonomisierung des Sozialen, dem Paradigmenwechsel in der Betreuung von Menschen mit Behinderung und dem Einsatz von Qualitätsmanagement. Weitere wichtige Schlagworte sind die §§ 93 ff BSHG, Landesrahmenverträge, Controlling, Kundenrecht, Enthospitalisierung, Deinstitutionalisierung und das Assistenz-Modell.
Häufig gestellte Fragen
Was bedeutet Qualitätsmanagement (QM) in der Behindertenhilfe?
QM ist eine Methode zur systematischen Sicherung und Verbesserung der Betreuungsqualität, die sowohl die Bedürfnisse der Klienten als auch ökonomische Anforderungen berücksichtigt.
Was ist der Paradigmenwechsel zum Assistenz-Modell?
Weg von einer rein medizinisch-psychiatrischen "Verwahrung" hin zur individuellen Assistenz, die Menschen mit Behinderung ein selbstbestimmtes Leben ermöglicht.
Welche Rolle spielen die §§ 93 ff. BSHG?
Diese gesetzlichen Neuregelungen führten zu einer Ökonomisierung des Sozialen, bei der Leistungen prospektiv vereinbart und finanziert werden.
Was bedeutet Deinstitutionalisierung?
Der Abbau großer stationärer Einrichtungen zugunsten ambulanter und gemeindenaher Wohn- und Betreuungsformen.
Wie wirkt sich QM auf die tägliche Arbeit der Betreuer aus?
Es erfordert eine präzisere Dokumentation, die Arbeit nach festen Standards und eine stärkere Reflexion des eigenen Handelns gegenüber dem Klienten.
- Arbeit zitieren
- Martin Eickhoff-Drexel (Autor:in), 2000, Zauberwort QM – bleibt alles anders!?, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/173245