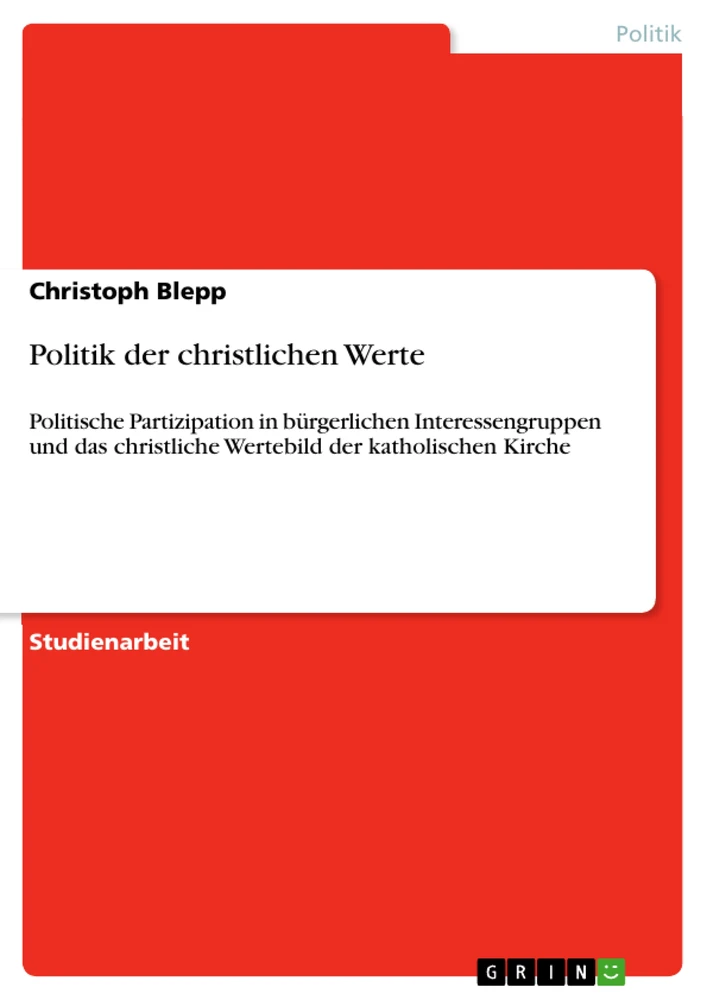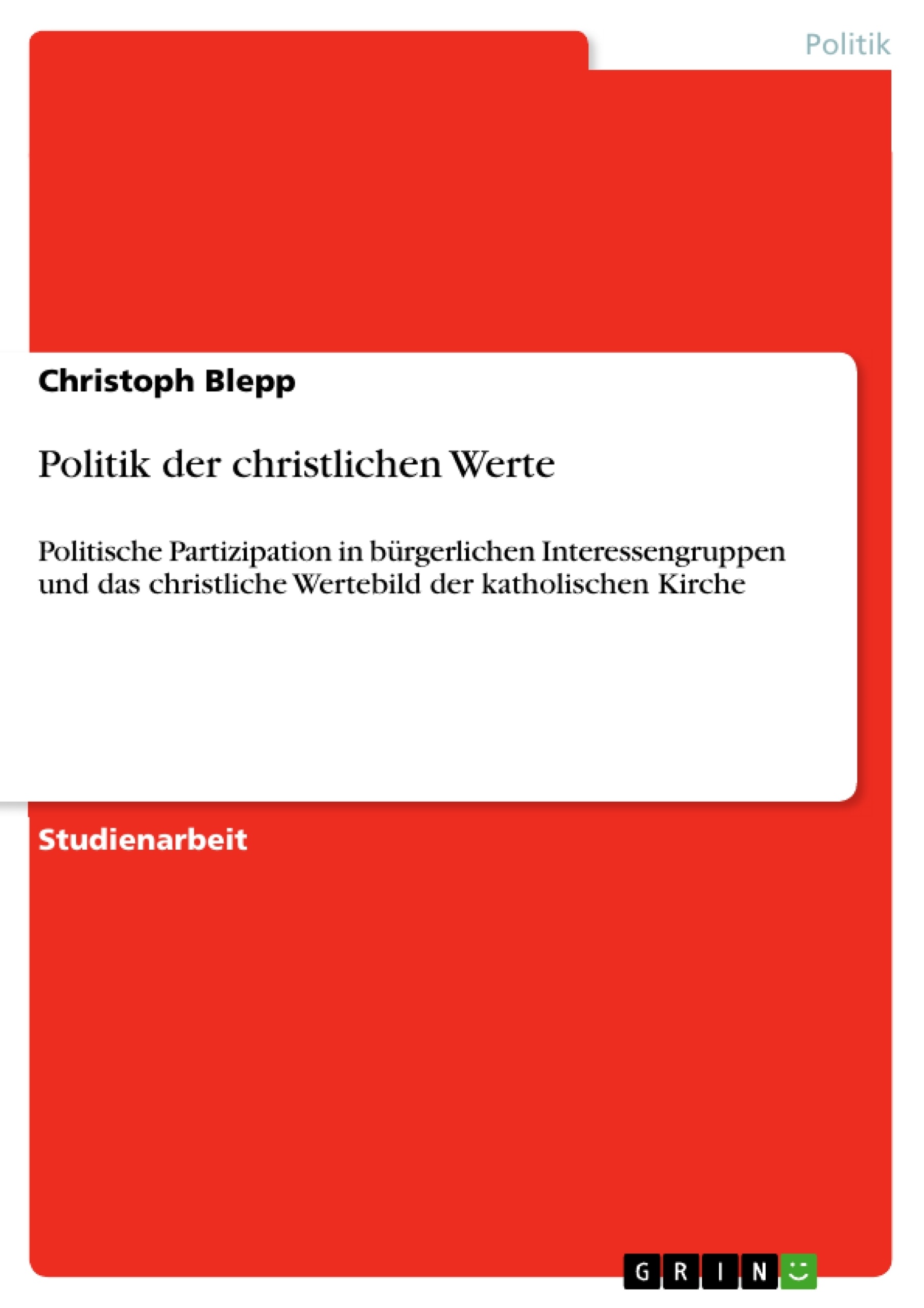Wozu also noch Religion? Wir leben in einem säkularisierten Staat - hat der heilige Stuhl
noch Einfluss auf die deutsche Politik und wenn ja, ist diese Einflussnahme überhaupt
notwendig? Sei es Abtreibung, Umweltschutz, Gentechnik, Erziehung oder Ethik: Überall
scheint sich die Kirche in das politische Leben einzumischen. In Zeiten der offenbar
religiös motivierten Konflikte und rückgängigen Mitgliederzahlen der katholischen und
evangelischen Kirche in Deutschland wirft sich die Frage nach der vollständigen
Säkularisierung von Politik und Religion auf. Ob politische Herrschaft noch auf religiöse
Überlieferungen angewiesen ist und ein pluralistisches Gemeinwesen über einen bloßen
modus vivendi hinaus zu stabilisieren ist, ist die Frage, die sich vielen Menschen
heutzutage stellt.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Forschungsstand
- 3. Begriffe, Kriterien und Instrumente
- 3.1. Säkularisierung
- 3.2. Religion und Politik
- 3.3. Der Religionsmonitor
- 4. Methodische Vorgehensweise
- 5. Der Katholische Katechismus
- 5.1. Geschichte des Katechismus
- 5.2. Der Katholische Katechismus von 1992 und 2005
- 6. Bürgerliche Interessengruppen und christliche Werte
- 6.1. Bürgerliche Interessengruppen und ihre Inhalte
- 6.1.1. BUND. Freunde der Erde
- 6.1.2. Amnesty International Deutschland
- 6.1.3. Verein für Sozialarbeit München
- 6.2. Korrelation zwischen Katholischem Katechismus und Bürgerlichen Interessengruppen
- 6.1. Bürgerliche Interessengruppen und ihre Inhalte
- 7. Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht die Verbindung zwischen christlichem Glauben und der politischen Partizipation in bürgerlichen Interessengruppen. Sie analysiert, inwiefern das christliche Wertesystem der katholischen Kirche die Inhalte und Aktivitäten dieser Gruppen beeinflusst und ob Politik ohne Religion überhaupt denkbar ist.
- Der Einfluss des katholischen Katechismus auf politische Entscheidungen und Debatten
- Die Rolle von Religion in einem säkularisierten Staat
- Die Bedeutung von christlichen Werten für die bürgerliche Gesellschaft
- Die Frage nach dem Zusammenhang zwischen Politik und Religion in der heutigen Zeit
- Die Analyse von Bürgerlichen Interessengruppen und ihrer Ausrichtung im Kontext christlicher Werte
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung beleuchtet die steigende Bedeutung der Zivilgesellschaft und die Rolle von Bürgerlichen Interessengruppen in der modernen Politik. Die Arbeit stellt die zentrale These auf, dass die Inhalte und die Beteiligung von Bürgerlichen Interessengruppen in westlichen Gesellschaften maßgeblich vom christlichen Wertesystem geprägt sind.
Der Forschungsstand diskutiert den historischen Blick auf die Beziehung zwischen Religion und Moderne und beleuchtet die Einwände gegen die klassische Säkularisierungstheorie. Die Bedeutung von Religion im Kontext der Zivilreligion, Individualisierungsthese und Sozialkapitalforschung wird hervorgehoben.
Das dritte Kapitel definiert wichtige Begriffe wie Säkularisierung und das Verhältnis von Politik und Religion. Es erläutert den Religionsmonitor als Instrument zur Analyse von Religion in der Gesellschaft.
Kapitel 5 widmet sich dem Katholischen Katechismus und seiner Bedeutung als Leitwerk des katholischen Glaubens. Es betrachtet die historische Entwicklung des Katechismus und beleuchtet den aktuellen Katechismus von 1992.
Kapitel 6 analysiert verschiedene Bürgerliche Interessengruppen und ihre Inhalte im Hinblick auf ihre Korrelation mit dem Katholischen Katechismus. Die Beispiele BUND, Amnesty International Deutschland und der Verein für Sozialarbeit München dienen der Illustration.
Schlüsselwörter
Säkularisierung, Religion und Politik, Katholischer Katechismus, Bürgerliche Interessengruppen, christliche Werte, Zivilgesellschaft, Religionsmonitor, politische Partizipation, westliche Gesellschaften.
Häufig gestellte Fragen
Welchen Einfluss hat die Kirche heute noch auf die deutsche Politik?
Trotz Säkularisierung beeinflussen kirchliche Werte weiterhin Debatten über Ethik, Gentechnik, Umweltschutz und soziale Gerechtigkeit.
Inwiefern prägt der katholische Katechismus bürgerliche Interessengruppen?
Die Arbeit untersucht Korrelationen zwischen den Inhalten des Katechismus und den Zielen von Gruppen wie Amnesty International oder dem BUND.
Ist Politik in einem säkularisierten Staat ohne Religion denkbar?
Die Arbeit hinterfragt, ob politische Herrschaft noch auf religiöse Überlieferungen angewiesen ist, um ein pluralistisches Gemeinwesen zu stabilisieren.
Was ist der Religionsmonitor?
Es ist ein Instrument zur Analyse von Religiosität in der Gesellschaft, das in dieser Arbeit zur methodischen Untersuchung genutzt wird.
Welche Rolle spielen christliche Werte für die Zivilgesellschaft?
Christliche Werte dienen oft als moralisches Fundament für bürgerschaftliches Engagement und die Ausrichtung sozialer Interessengruppen.
- Arbeit zitieren
- Christoph Blepp (Autor:in), 2010, Politik der christlichen Werte, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/173265