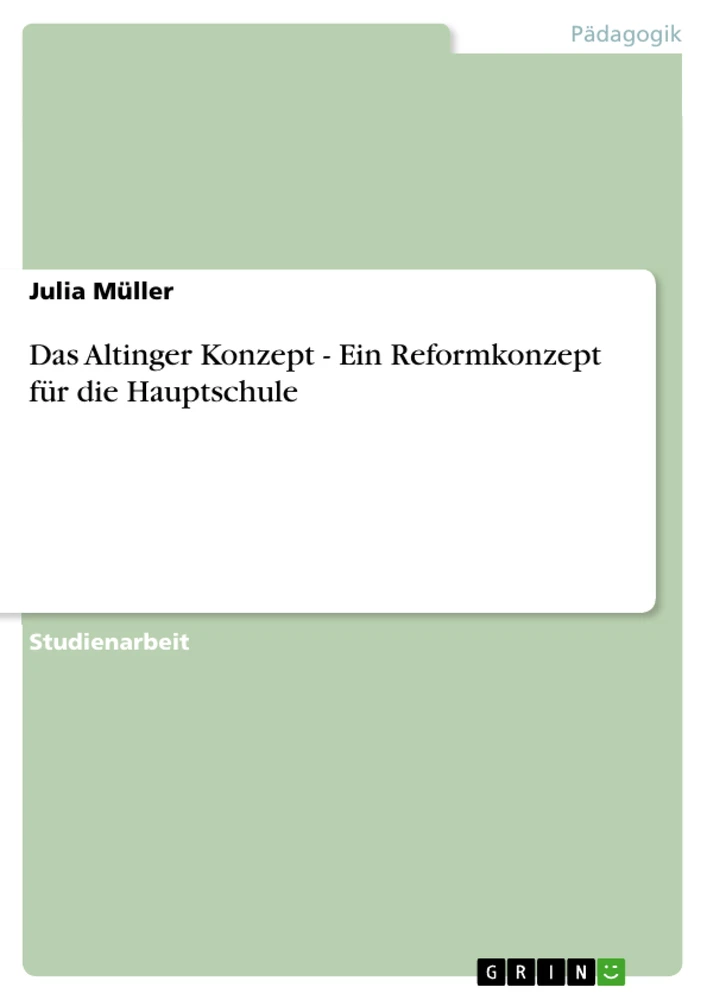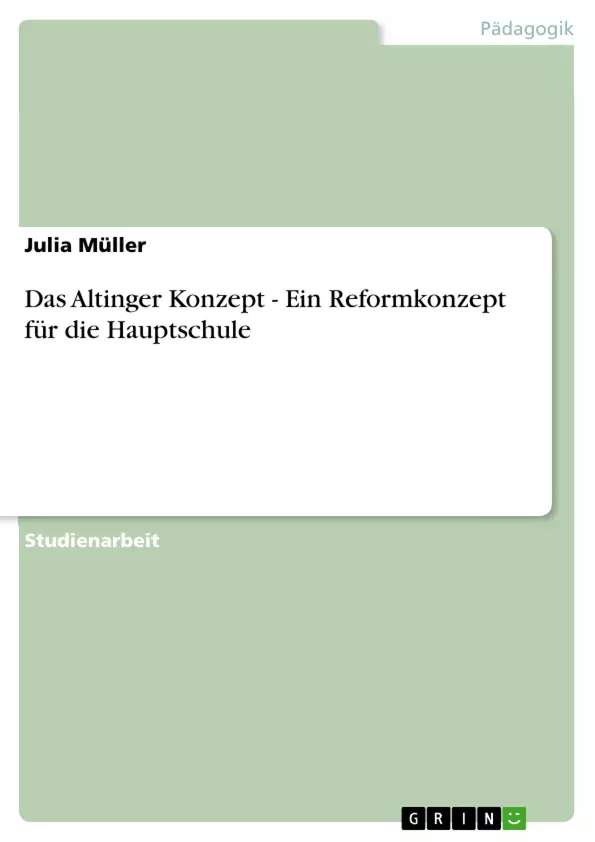Die Hauptschule befindet sich in einer Sackgasse, wie beispielsweise der Vorfall in Berlin-Neuköln im März 2006 zeigte. Lehrer der dort ansässigen Rütli-Schule forderten die Auflösung der Hauptschule, da sie der Gewalt der Schüler nicht mehr standhalten konnten. Ein anspruchsvoller und schülergerechter Lern- und Lebensraum ist dort, wie in vielen anderen Hauptschulen, nicht vorhanden.
Die Grund- und Hauptschule mit Werkrealschule Altingen hat jedoch die Möglichkeit für einen solchen Lern- und Lebensraum geschaffen. Ihr Konzept wurde schon Anfang der 80er Jahre an der Eduard-Mörike-Schule in Kirchheim/Teck-Ötlingen auf Klassenebene entwickelt. Schule sollte neu strukturiert werden, sie sollte demokratischer, kindgerechter und menschlicher werden. 1987 wurde das Konzept auf Schulebene in Altingen umgesetzt und ist in die Fachsprache als „Altinger Konzept“ eingegangen. Im Folgenden wird dieses Konzept vorgestellt.
Inhaltsverzeichnis
- I. Probleme der Hauptschule
- II. Das Altinger Konzept
- 1. Gestaltung der Lernumgebung
- 1.1. Gestaltung des Klassenzimmers
- 1.2. Gestaltung des Schulhofes
- 2. Demokratisierung von Schule
- 2.1. Streitschlichtung
- 2.2. Schüler- und Schulversammlung
- 3. Zeit- und Organisationsstruktur
- 3.1. Klassenlehrerprinzip
- 3.2. Veränderte Zeitstruktur
- 3.3. Jahresplan
- 3.4. Integrierter Stoffverteilungsplan
- 3.5. Lernplan
- 3.6. Wochen- und Arbeitsplan
- 4. Lernformen
- 4.1. Spiele/Übungen
- 4.2. Kurse
- 4.3. Lektionen
- 4.4. Projekte
- 1. Gestaltung der Lernumgebung
- III. Das Altinger Konzept als Vorbild für Reformen der Hauptschule
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit analysiert das Altinger Konzept, ein Reformkonzept für die Hauptschule, das an der Eduard-Mörike-Schule in Kirchheim/Teck-Ötlingen entwickelt wurde. Sie untersucht die Problematik der Hauptschule, die Notwendigkeit von Reformen und stellt die verschiedenen Elemente des Altinger Konzepts vor. Darüber hinaus beleuchtet sie die Relevanz des Konzepts als Vorbild für die Reformierung der Hauptschule.
- Die Problematik der Hauptschule als „Restschule“
- Die Gestaltung einer kindgerechten Lernumgebung
- Die Demokratisierung von Schule durch Schülerbeteiligung
- Die Bedeutung der Zeit- und Organisationsstruktur für erfolgreiches Lernen
- Die Anwendung verschiedener Lernformen zur Förderung der Schüler
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel beleuchtet die schwierige Situation der Hauptschule, die mit dem Stigma der „Restschule“ kämpft und unter dem Problem sinkender Schülerzahlen und schlechter beruflicher Chancen leidet. Im zweiten Kapitel wird das Altinger Konzept vorgestellt. Es beschreibt, wie die Schule durch die Gestaltung der Lernumgebung, die Förderung von Schülerbeteiligung und die Entwicklung einer optimierten Zeit- und Organisationsstruktur ein positives Lernumfeld schafft. Es werden die wichtigsten Elemente des Konzepts, wie die Umgestaltung der Klassenzimmer, die Einbindung des Schulhofes in den Lernprozess und die Anwendung vielfältiger Lernformen, detailliert dargestellt. Das dritte Kapitel befasst sich mit der Relevanz des Altinger Konzepts als Vorbild für die Reformierung der Hauptschule. Es argumentiert, dass die Prinzipien des Konzepts, wie eine kindgerechte Lernumgebung, Schülerbeteiligung und eine flexible Lernorganisation, eine wichtige Grundlage für die Verbesserung der Hauptschule darstellen.
Schlüsselwörter
Das Altinger Konzept, Hauptschule, Reform, Lernumgebung, Demokratisierung, Schülerbeteiligung, Zeit- und Organisationsstruktur, Lernformen, kindgerechte Gestaltung, Schulhof, Klassenzimmer.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das „Altinger Konzept“ für die Hauptschule?
Das Altinger Konzept ist ein Reformmodell, das die Hauptschule zu einem demokratischeren, kindgerechteren und menschlicheren Lern- und Lebensraum umgestalten will. Es wurde in Altingen (Baden-Württemberg) implementiert.
Wie wird die Lernumgebung im Altinger Konzept gestaltet?
Ein Schwerpunkt liegt auf der Gestaltung der Klassenzimmer und des Schulhofes als aktive Lernorte. Ziel ist es, eine Umgebung zu schaffen, in der sich Schüler wohlfühlen und die zum selbstständigen Lernen anregt.
Welche Rolle spielt die Demokratisierung der Schule?
Durch Instrumente wie Schüler- und Schulversammlungen sowie Streitschlichtungsprogramme werden die Schüler aktiv in die Gestaltung und Verwaltung ihres Schullebens einbezogen.
Was ändert sich an der Zeit- und Organisationsstruktur?
Das Konzept setzt auf das Klassenlehrerprinzip, veränderte Zeitstrukturen (z.B. Rhythmisierung des Tages) sowie individuelle Wochen- und Lernpläne, um den Schülern mehr Struktur und Eigenverantwortung zu geben.
Warum benötigt die Hauptschule solche Reformen?
Die Hauptschule wird oft als „Restschule“ wahrgenommen und kämpft mit Gewaltproblemen und sinkenden Schülerzahlen. Konzepte wie das Altinger Modell sollen die Qualität und das Ansehen dieser Schulform durch pädagogische Innovationen steigern.
- Arbeit zitieren
- Julia Müller (Autor:in), 2009, Das Altinger Konzept - Ein Reformkonzept für die Hauptschule, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/173411