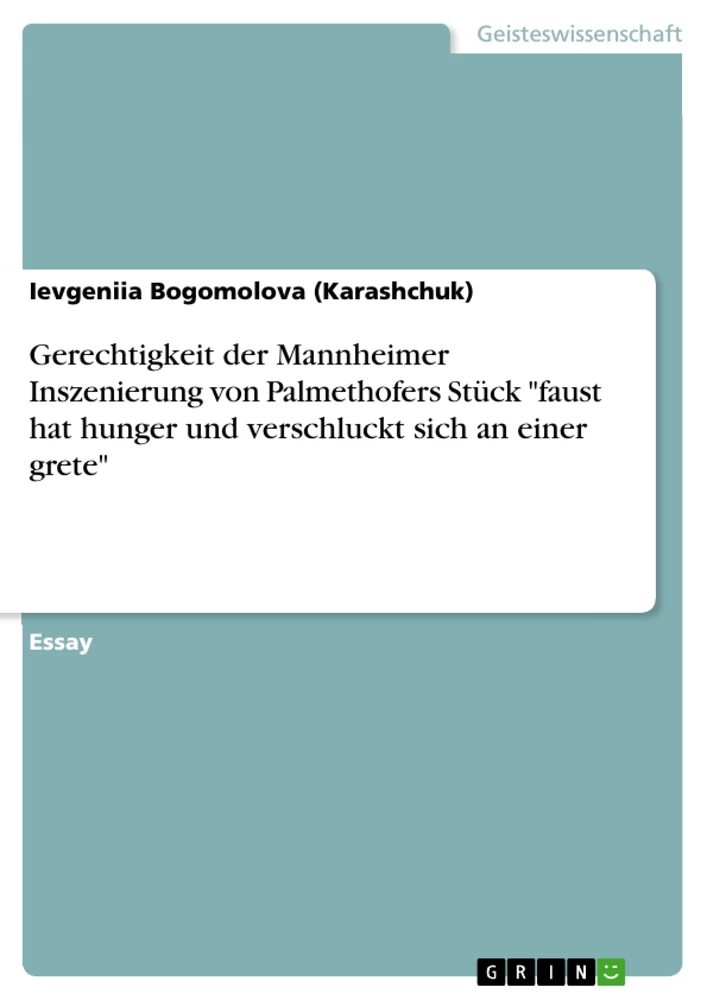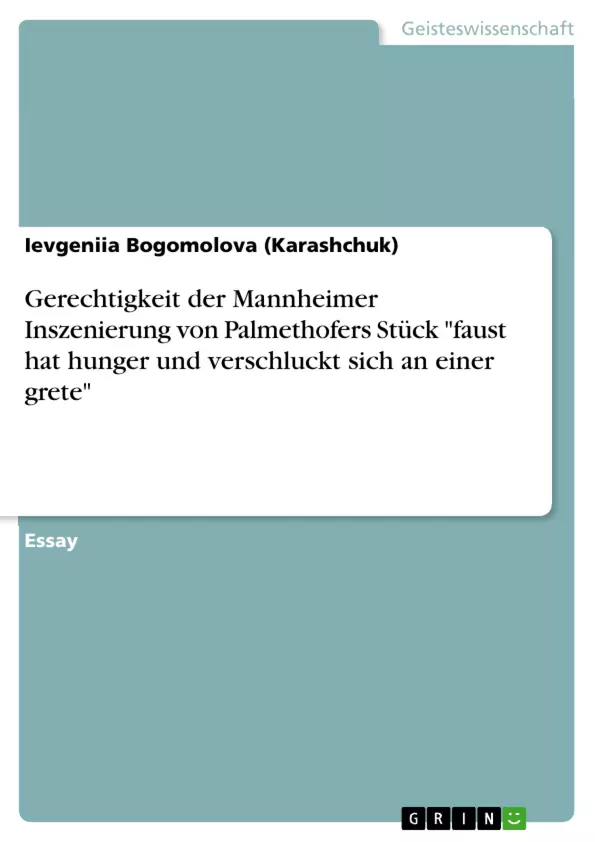Faust hat hunger und verschluckt sich an einer grete ist ein Stück von Ewald Palmetshofer, einem Nachwuchsdramatiker aus Österreich. Im Folgenden möchte ich das Stück selbst sowie dessen Inszenierung betrachten. Die Frage, die ich hier in den Mittelpunkt stelle ist, wie nahe die Inszenierung unter der Regie von Dieter Boyer vom 29. Januar, die ich am Nationaltheater Mannheim gesehen habe, am dramatischen Text von Ewald Palmetshofer ist.
Inhaltsverzeichnis
- Werktreue
- Formaler Aufbau des Stückes
- Sprache und Dialoge
- Die Inszenierung von Dieter Boyer
- Inhalt des Stückes
- Heinrich und Grete
- Die Inszenierung der Inszenierung
- Die zwei Ebenen der Geschichte
- Kostüme und Farben
- Das schwarze Loch
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Dieser Text analysiert das Stück „Faust hat hunger und verschluckt sich an einer grete“ von Ewald Palmetshofer und dessen Inszenierung am Nationaltheater Mannheim unter der Regie von Dieter Boyer. Das Hauptaugenmerk liegt auf der Frage der Werktreue und der Frage, wie weit die Inszenierung vom Text abweicht.
- Werktreue als komplexer Begriff
- Analyse des formalen Aufbaus des Stückes
- Die Sprache und Dialoge als Mittel der Charakterisierung
- Die Inszenierung von Dieter Boyer im Kontext des Textes
- Die Themen Glückssuche, Individualität und Universalität
Zusammenfassung der Kapitel
- Das erste Kapitel beschäftigt sich mit dem Begriff der Werktreue und seinen problematischen Aspekten. Der Text analysiert die Überlegungen von Erika Fischer-Lichte zum Thema.
- Das zweite Kapitel beleuchtet den formalen Aufbau des Stückes. Es werden die 23 Passagen, die dialogische Form und die epischen Elemente des Stückes besprochen.
- Das dritte Kapitel fokussiert sich auf die Sprache und Dialoge im Stück. Die charakteristische Umgangssprache, die Trivialität und Fragmentarität der Dialoge werden beleuchtet.
- Das vierte Kapitel analysiert die Inszenierung von Dieter Boyer am Nationaltheater Mannheim im Hinblick auf den Text von Palmetshofer. Die Rezeption des Stückes durch Lesen und durch die Inszenierung wird verglichen.
- Das fünfte Kapitel geht auf den Inhalt des Stückes ein. Die Geschichte von drei Paaren und von Heinrich und Grete, sowie das zentrale Thema der Glückssuche werden vorgestellt.
- Das sechste Kapitel betrachtet die beiden zentralen Figuren Heinrich und Grete und deren Abwesenheit auf der Bühne. Die Inszenierung der Inszenierung und die Verbindung zwischen Vergangenheit und Gegenwart werden erörtert.
- Das siebte Kapitel behandelt die zwei Ebenen der Geschichte und die Herausforderung der Inszenierung dieser Ebenen. Die Rolle der Kostüme im Prozess des Übergangs zwischen den Ebenen wird hervorgehoben.
- Das achte Kapitel analysiert die Bedeutung der Kostüme und Farben in der Inszenierung. Die Ähnlichkeiten in der Kleidung der Paare und der Kontrast zwischen Farben und Bühnenbild werden beleuchtet.
- Das neunte Kapitel beschreibt das schwarze Loch auf der Bühne, dessen symbolische Bedeutung und seine Veränderung im Verlauf des Stückes.
Schlüsselwörter
Die zentralen Schlüsselwörter und Themenschwerpunkte des Textes sind Werktreue, Inszenierung, dramatischer Text, faustische Themen, Glückssuche, Individualität, Universalität, Performativität, Sprache, Dialoge und Bühnenbild. Die Analyse bezieht sich auf die Inszenierung des Stückes „Faust hat hunger und verschluckt sich an einer grete“ von Ewald Palmetshofer am Nationaltheater Mannheim unter der Regie von Dieter Boyer.
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in Ewald Palmetshofers Stück?
Das Stück „faust hat hunger und verschluckt sich an einer grete“ thematisiert die Glückssuche und Individualität anhand der Geschichte von drei Paaren sowie Heinrich und Grete.
Was bedeutet „Werktreue“ in dieser Analyse?
Die Arbeit untersucht, wie nahe die Mannheimer Inszenierung von Dieter Boyer am ursprünglichen dramatischen Text von Palmetshofer bleibt und wo sie davon abweicht.
Wie wird die Sprache im Stück charakterisiert?
Die Sprache ist geprägt von Trivialität, Fragmentarität und einer spezifischen Umgangssprache, die zur Charakterisierung der Figuren dient.
Welche Rolle spielen Kostüme und Bühnenbild in der Inszenierung?
Kostüme und Farben werden genutzt, um Übergänge zwischen Bedeutungsebenen zu schaffen; ein „schwarzes Loch“ auf der Bühne dient als zentrales Symbol.
Wie werden Heinrich und Grete auf der Bühne dargestellt?
Die Analyse beleuchtet die Besonderheit der Abwesenheit der zentralen Figuren Heinrich und Grete auf der Bühne und deren Wirkung auf die Inszenierung.
- Quote paper
- Ievgeniia Bogomolova (Karashchuk) (Author), 2010, Gerechtigkeit der Mannheimer Inszenierung von Palmethofers Stück "faust hat hunger und verschluckt sich an einer grete", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/173440