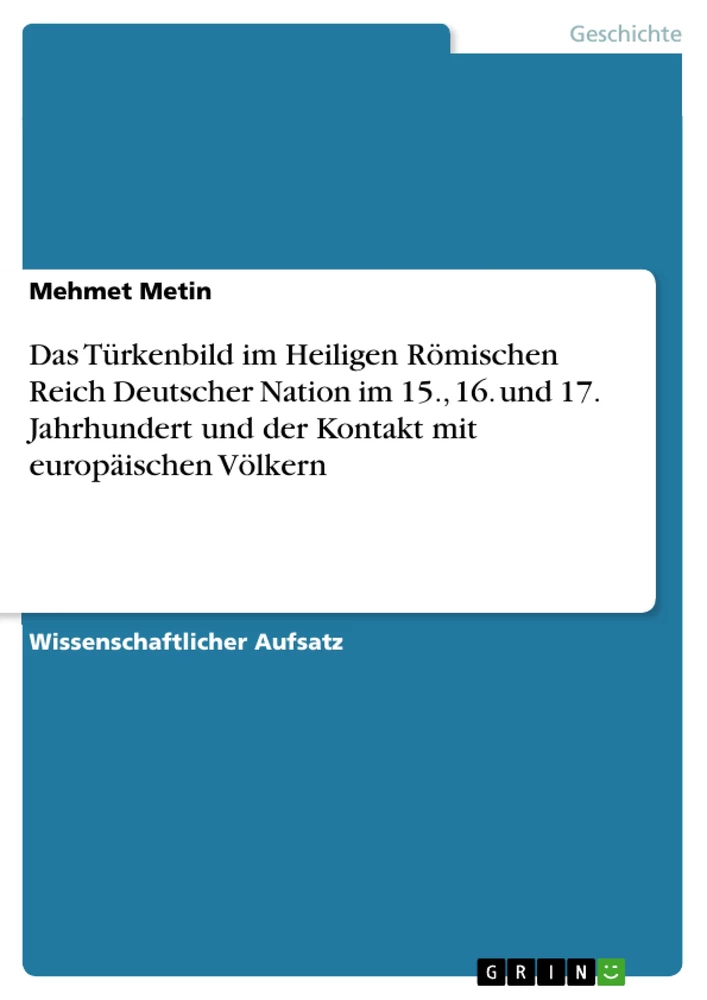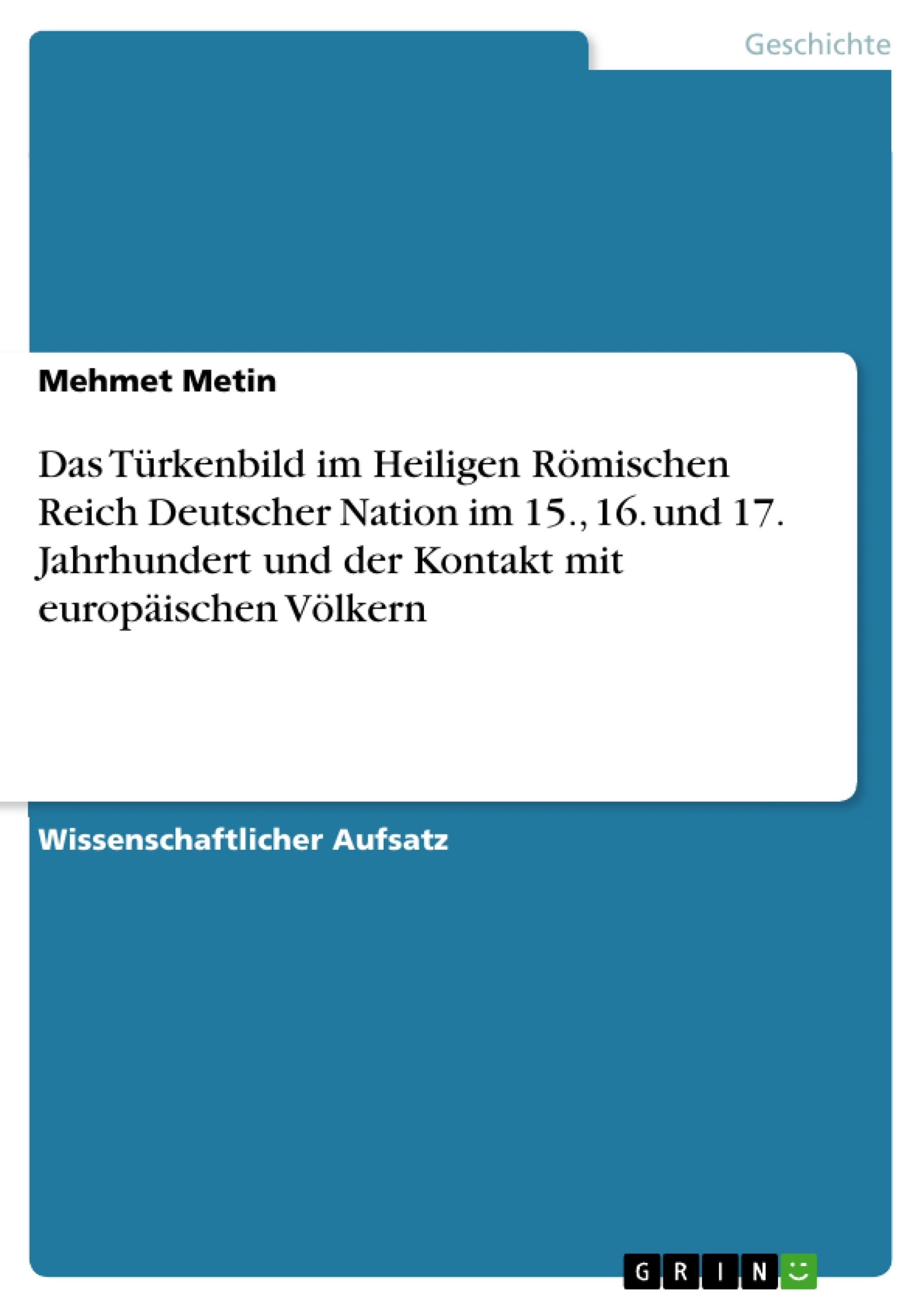Ich möchte mit dem kurzen Artikel einen Überblick geben, wie das Türkenbild im Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation im 16 Jahrhundert und 17 Jahrhundert und bei den europäischen Völkern war? Wie die Begriffe zum Beispiel Türkenbriefe, Türkenpredigten, Türkengebete und Türkenglocke überhaupt entstanden?
Die Geschichte beider Völker lässt sich jedoch bis über 500 Jahre zurückfolgen und es ist davon auszugehen, daß die Nachwirkung an dieser historischen Beziehungen noch heute zu spüren sind. Reisebeschreibungen prägten die abendländischen Vorstellungen von der Türkei / dem Orient nachhaltig.
Die Reiseliteratur ist besonders geeignet, um die damalige westliche Wahrnehmung des Orients zu veranschaulichen. Denn die Fremdenwahrnehmung der Türkei- Reisenden hängt eng mit ihren Möglichkeiten der Selbstwahrnehmung und Selbstdefinition zusammen. Das bedeutet, daß die Erfahrungsmöglichkeiten das Selbst die Erfahrung und Erfassung des Fremden bestimm(t)en.
Die Orientalistik geht in ihren Anfängen bis ins 12. Jahrhundert zurück, als nach der Konfrontation des christlich-lateinischen Abendlandes mit dem islamisch-arabischen Orient (durch die Kreuzzüge und die Reconquista in Spain) eine rege Übersetzungstätigkeit einsetzte. [...]
Inhaltsverzeichnis
- Das Türkenbild im Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation im 15., 16. und 17. Jahrhundert und der Kontakt mit europäischen Völkern
- Das Türkenbild im Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation im 16. und 17. Jahrhundert
- Der Einfluss der römisch-katholischen Kirche auf das Türkenbild des 15., 16. und 17. Jahrhunderts
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Der Artikel befasst sich mit der Darstellung der Türken im Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation im 16. und 17. Jahrhundert. Er analysiert, wie das Türkenbild bei den europäischen Völkern geprägt wurde und die Entstehung von Begriffen wie Türkenbriefe, Türkenpredigten, Türkengebete und Türkenglocke beleuchtet.
- Die historische Entwicklung des westlichen Türkenbildes
- Die Rolle von Reisebeschreibungen in der Fremdwahrnehmung des Orients
- Der Einfluss der Orientalistik auf die westlichen Vorstellungen vom Orient
- Der sozio-ökonomische Kontext der abendländischen türkischen Beziehungen
- Die Rolle der katholischen Kirche in der Konstruktion des Türkenbildes
Zusammenfassung der Kapitel
Das Türkenbild im Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation im 16. und 17. Jahrhundert
Dieses Kapitel untersucht die Entstehung des Türkenbildes im Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation im 16. und 17. Jahrhundert vor dem Hintergrund der osmanischen Expansion und der militärischen Bedrohung des christlichen Abendlandes. Der Artikel beleuchtet auch die soziale Anziehungskraft des Osmanischen Reiches auf Bauern und Soldaten im Heiligen Römischen Reich und die Reaktion Martin Luthers auf diese Entwicklung.
Der Einfluss der römisch-katholischen Kirche auf das Türkenbild des 15., 16. und 17. Jahrhunderts
Dieses Kapitel analysiert die Rolle der katholischen Kirche in der Konstruktion des Türkenbildes während der Reformation. Der Artikel beschreibt, wie die Kirche das Feindbild des Islam und die Kreuzzugsidee wieder aufgriff, um die eigene Macht zu stärken und interne Konflikte zu überdecken. Die Verbreitung von Türkenbriefen, Türkenpredigten, Türkengebeten und Türkenglocken wird als Werkzeug der Kirche zur Verankerung eines negativen Bildes von Türken im Bewusstsein der Bevölkerung dargestellt.
Schlüsselwörter
Türkenbild, Osmanisches Reich, Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation, Orientalistik, Reisebeschreibungen, Fremdwahrnehmung, Reformation, katholische Kirche, Propaganda, Türkenbriefe, Türkenpredigten, Türkengebete, Türkenglocken, Feindbild, Islam, Kreuzzugsidee, soziale Anziehungskraft.
Häufig gestellte Fragen
Wie entstand das Türkenbild im 16. und 17. Jahrhundert?
Es wurde maßgeblich durch die militärische Bedrohung durch das Osmanische Reich sowie durch Reisebeschreibungen und kirchliche Propaganda geprägt.
Was sind Türkenglocken und Türkengebet?
Dies waren von der Kirche eingeführte Maßnahmen, um die Bevölkerung zur Wachsamkeit und zum Gebet gegen die „Türkengefahr“ aufzurufen und ein religiöses Feindbild zu festigen.
Welche Rolle spielte die Reiseliteratur für die Wahrnehmung des Orients?
Reiseberichte waren die Hauptquelle für Informationen über die Türkei. Sie dienten oft der Selbstdefinition des Abendlandes durch die Abgrenzung vom „fremden“ Orient.
Wie nutzte die katholische Kirche das Türkenbild?
Die Kirche griff die Kreuzzugsidee auf, um interne Konflikte (wie die Reformation) zu überdecken und die Gläubigen gegen einen äußeren Feind zu einen.
Gab es auch eine soziale Anziehungskraft des Osmanischen Reiches?
Ja, für manche Bauern und Soldaten im Heiligen Römischen Reich erschien das osmanische System aufgrund geringerer Steuerlasten oder Aufstiegsschancen zeitweise attraktiv, was Martin Luther besorgt kommentierte.
Was versteht man unter „Orientalistik“ in diesem historischen Kontext?
Die Anfänge liegen im 12. Jahrhundert, als durch Übersetzungen arabischer Texte und die Konfrontation während der Kreuzzüge ein erstes wissenschaftliches Interesse am Orient entstand.
- Arbeit zitieren
- Dr. phil. M.A Mehmet Metin (Autor:in), 2011, Das Türkenbild im Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation im 15., 16. und 17. Jahrhundert und der Kontakt mit europäischen Völkern, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/173468