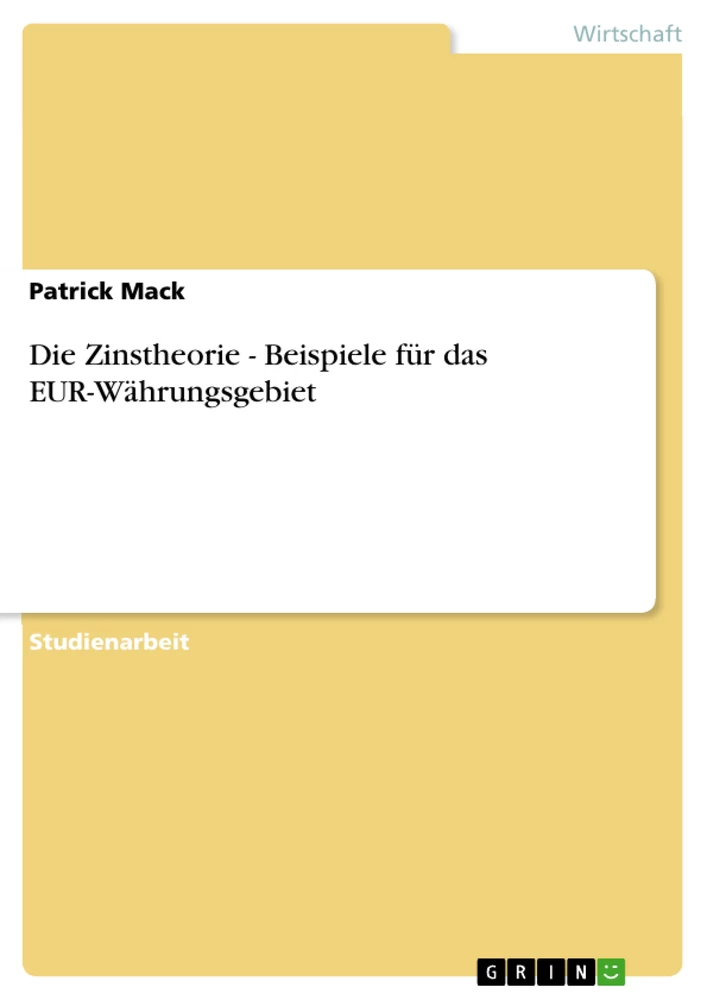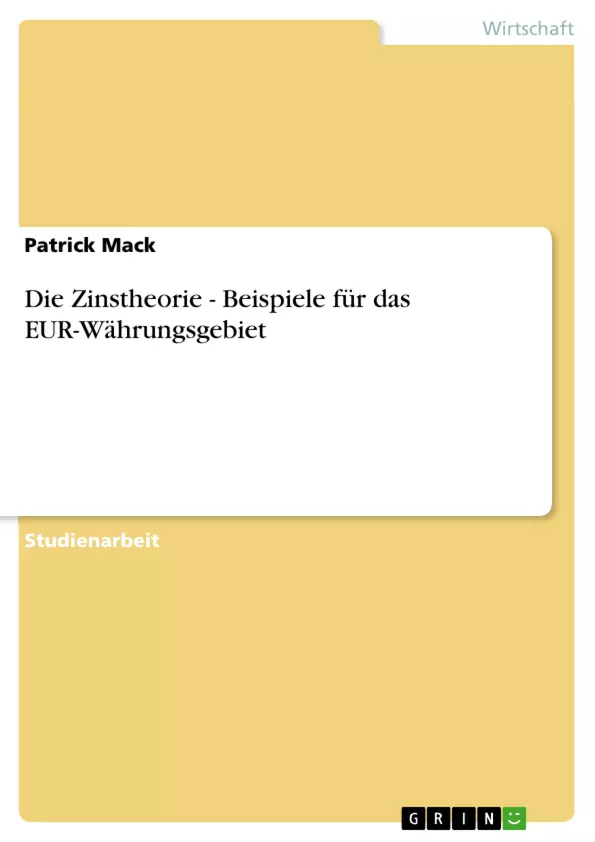Das Ziel der Arbeit ist die Darstellung der Entwicklung der Zinstheorie sowie ihrer
wirtschaftswissenschaftlichen Bedeutung, indem die den jeweilig betrachteten Modellen
unterstellten Annahmen bzw. Rahmenbedingungen aufgezeigt und auf die daraus
übertragbaren Erkenntnisse eingegangen wird. Dabei schließt sich eine Rezension im
Hinblick auf die beobachtbaren Implikationen der beschriebenen Modelle der Zinstheorie,
bezogen auf das EUR-Währungsgebiet an. Zum Ende folgt eine kritische Auseinandersetzung
der gewonnenen Erkenntnisse und Analyse empirischer Daten. Im Hauptaugenmerk stehen
dabei die Neoklassik und der Keynsianismus, sowie die zum Ende gestellte Frage, welche
Implikationen sich für die Geldpolitik aus der Zinstheorie ergeben.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Ziel der Arbeit
- Einordnung der Arbeit
- Die Klassisch Zinstheorie
- Die Neoklassische Zinstheorie
- Erkenntnisse Eugen von Böhm-Bawerks
- Einführung und Prämissen
- Positive Zinstheorie
- Implikation und Kritik
- Die neoklassische Zinstheorie von Knut Wicksell
- Einführung und Prämissen
- Die Zinsspannentheorie
- Implikation und Kritik
- Die keynsianische Zinstheorie
- Liquiditätspräferenztheorie des Zinses
- ISLM Modell
- Erläuterung
- Würdigung und Kritik
- Zinsstrukturtheorie
- Grundidee der Zinstrukturtheorie
- Erwartungshypothese
- Zinsspannentheorem von Malkiel
- Marktsegmentions - Hypothese
- Implikationen und Beobachtungen
- Geldpolitische Implikationen aus der Zinstheorie
- Taylor Zinsregel
- Auswertungen und Erkenntnisse aus E-Views
- Fazit und kritische Auseinandersetzung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit zielt darauf ab, die Entwicklung der Zinstheorie und ihre Bedeutung für die Wirtschaftswissenschaft aufzuzeigen. Sie analysiert die Annahmen und Rahmenbedingungen der jeweiligen Modelle und untersucht die daraus ableitbaren Erkenntnisse. Die Arbeit befasst sich insbesondere mit den Implikationen der Zinstheorie für das EUR-Währungsgebiet und bietet eine kritische Betrachtung der gewonnenen Erkenntnisse und Analyse empirischer Daten. Der Fokus liegt dabei auf der Neoklassik und dem Keynsianismus sowie der Frage, welche Implikationen sich für die Geldpolitik aus der Zinstheorie ergeben.
- Entwicklung der Zinstheorie
- Annahmen und Rahmenbedingungen der Modelle
- Implikationen der Zinstheorie für das EUR-Währungsgebiet
- Kritische Analyse empirischer Daten
- Geldpolitische Implikationen aus der Zinstheorie
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema der Zinstheorie ein und skizziert das Ziel und die Struktur der Arbeit. Kapitel 2 beschäftigt sich mit der Klassischen Zinstheorie, während Kapitel 3 die Neoklassische Zinstheorie mit den Erkenntnissen von Eugen von Böhm-Bawerk und Knut Wicksell beleuchtet. Kapitel 4 widmet sich der Keynsianischen Zinstheorie, inklusive der Liquiditätspräferenztheorie und dem ISLM-Modell. In Kapitel 5 werden verschiedene Aspekte der Zinsstrukturtheorie behandelt, darunter die Erwartungshypothese und das Zinsspannentheorem von Malkiel. Kapitel 6 untersucht die geldpolitischen Implikationen der Zinstheorie, insbesondere im Hinblick auf die Taylor-Zinsregel. Die Arbeit schließt mit einer Auswertung empirischer Daten aus E-Views und einem Fazit, das die gewonnenen Erkenntnisse kritisch reflektiert.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit zentralen Themen der Geldtheorie und -politik, insbesondere mit der Zinstheorie. Wichtige Schlüsselbegriffe sind: Zins, Zinsstruktur, Zinstheorie, Klassische Zinstheorie, Neoklassische Zinstheorie, Keynsianische Zinstheorie, Liquiditätspräferenztheorie, ISLM-Modell, Zinsspannentheorie, Erwartungshypothese, Taylor-Zinsregel, EUR-Währungsgebiet, Geldpolitik, empirische Daten, E-Views.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Ziel der Arbeit zur Zinstheorie?
Das Ziel ist die Darstellung der Entwicklung der Zinstheorie und deren Bedeutung für das EUR-Währungsgebiet unter Berücksichtigung verschiedener Modelle.
Welche ökonomischen Schulen stehen im Fokus?
Die Arbeit konzentriert sich primär auf die Neoklassik (z.B. Böhm-Bawerk, Wicksell) und den Keynesianismus.
Was besagt die Taylor-Zinsregel?
Die Taylor-Regel wird im Kontext der geldpolitischen Implikationen untersucht, um die Zinssetzung durch Zentralbanken zu erklären.
Welche Rolle spielt das ISLM-Modell?
Das ISLM-Modell wird als Teil der keynesianischen Zinstheorie analysiert, um das Gleichgewicht auf Güter- und Geldmärkten darzustellen.
Was wird unter der Zinsstrukturtheorie verstanden?
Sie untersucht den Zusammenhang zwischen Zinssätzen und unterschiedlichen Laufzeiten von Anlagen, inklusive Hypothesen wie der Erwartungshypothese.
- Quote paper
- Patrick Mack (Author), 2010, Die Zinstheorie - Beispiele für das EUR-Währungsgebiet, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/173476