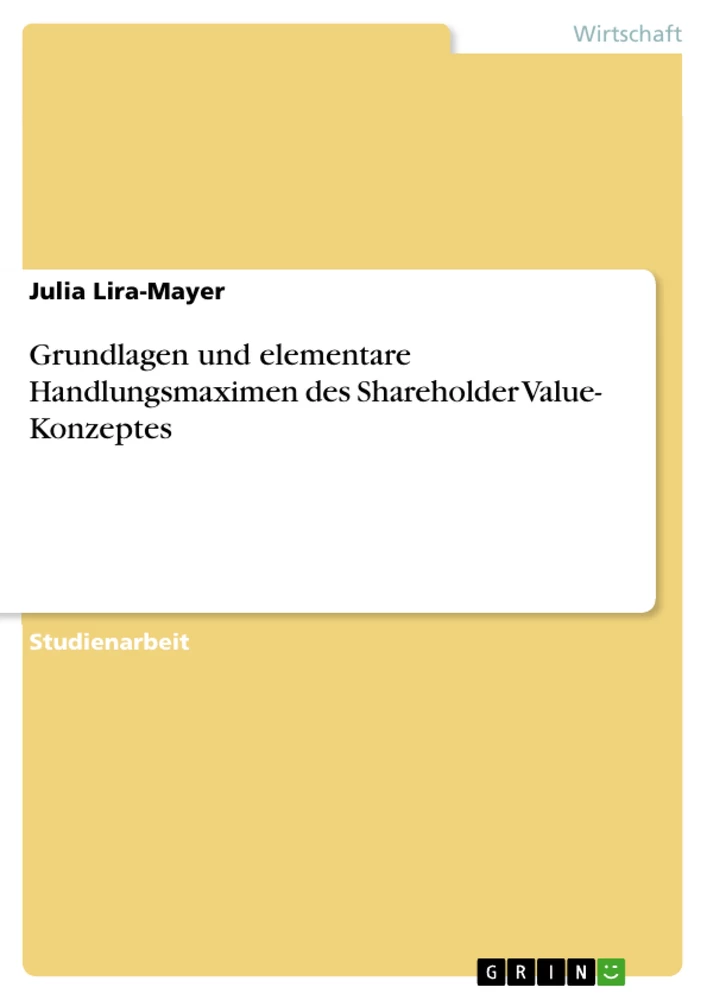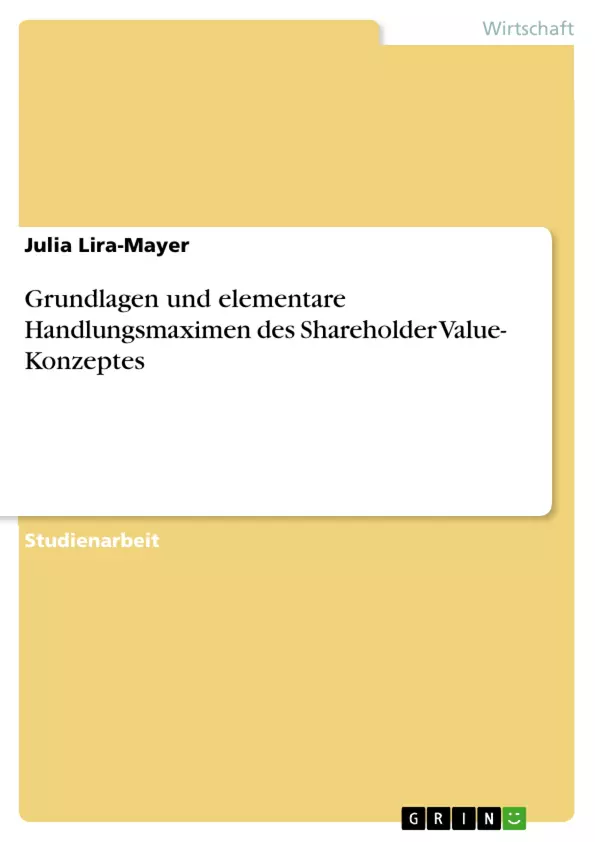Das Shareholder Value-Konzept wurde ursprünglich von Alfred Rappaport in den
USA entwickelt und als neuer Erfolgsmaßstab unternehmerischer Handlungen
angewendet. Seit Beginn der 90er Jahre des letzten Jahrhunderts spielt das
Shareholder Value-Konzept in Europa eine bedeutende Rolle. In den Vordergrund
rückt die Ausrichtung der Unternehmensstrategie auf die Maximierung der
Rendite für Anteilseigner beziehungsweise auf die Steigerung des
Unternehmenswertes. Auch in Deutschland ist eine deutliche Tendenz hin zur
verstärkten Orientierung der Unternehmenssteuerung an den finanziellen Zielen
der Eigenkapitalgeber und eine zunehmende Akzeptanz des Shareholder Value-
Konzeptes zu beobachten.
Trotzdem handelt es sich immer noch um einen der umstrittensten Begriffe,
welcher seit Jahren in der breiten Öffentlichkeit kontrovers diskutiert wird. Dies
wird an der Vielzahl der Publikationen zu dieser Thematik sichtbar. Die Kritik
entzündet sich besonders an einem Teil der Handlungsmaximen, die allein auf die
Interessen der Anteilseigner ausgerichtet sind. Dadurch, so die Kritiker, käme es
zu einer Vernachlässigung anderer Interessengruppen wie Kunden oder
Mitarbeiter.
Inhaltsverzeichnis
- Problemstellung
- Darstellung des Shareholder Value-Konzeptes
- Ursprünge des Shareholder Value-Konzeptes
- Das Shareholder Value-Konzept
- Grundidee und Ziele des Shareholder Value-Konzeptes
- Konzeptionelle Grundlagen
- Shareholder Value-Konzept in der Praxis
- Shareholder Value-Konzept als Handlungsmaxime
- Implementierung des Shareholder Value-Konzeptes
- Unternehmensinterne Implementierungsaspekte
- Unternehmensexterne Implementierungsaspekte
- Implementierungsprobleme
- Kritische Würdigung des Shareholder Value-Konzeptes
- Problembereiche des Shareholder Value-Konzeptes
- Vorzüge des Shareholder Value-Konzeptes
- Thesenförmige Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Seminararbeit befasst sich mit den Grundlagen und elementaren Handlungsmaximen des Shareholder Value-Konzeptes. Ziel ist es, die Entstehung und Entwicklung des Konzeptes sowie seine Implementierung in der Praxis zu analysieren, um schließlich zu einer kritischen Würdigung zu gelangen.
- Ursprünge und Entwicklung des Shareholder Value-Konzeptes
- Ziele und Grundidee des Shareholder Value-Konzeptes
- Praktische Implementierung des Shareholder Value-Konzeptes
- Kritikpunkte und Vorzüge des Shareholder Value-Konzeptes
- Die Bedeutung des Shareholder Value-Konzeptes im deutschen Corporate Governance-System
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Darstellung der Problemstellung und der Relevanz des Shareholder Value-Konzeptes im Kontext der deutschen Unternehmensführung. Im zweiten Kapitel werden die Ursprünge und die konzeptionellen Grundlagen des Shareholder Value-Konzeptes beleuchtet. Im dritten Kapitel wird die praktische Implementierung des Shareholder Value-Konzeptes im Unternehmen sowie die damit verbundenen Probleme behandelt. Schließlich wird im vierten Kapitel eine kritische Würdigung des Shareholder Value-Konzeptes durchgeführt, die die Vor- und Nachteile des Konzeptes beleuchtet.
Schlüsselwörter
Shareholder Value, Unternehmensführung, Renditemaximierung, Unternehmenswert, Corporate Governance, Stakeholder, Implementierung, Kritik, Unternehmenskultur, Aktie, Kapitalmarkt, Aktionär, Management, Finanzkennzahlen, Rechnungslegung, Wertorientierte Unternehmensführung, Corporate Raider
Häufig gestellte Fragen
Was ist die Grundidee des Shareholder Value-Konzeptes?
Die Ausrichtung der Unternehmensstrategie auf die Maximierung der Rendite für die Anteilseigner (Aktionäre) und die Steigerung des Unternehmenswertes.
Wer entwickelte das Shareholder Value-Konzept ursprünglich?
Das Konzept wurde von Alfred Rappaport in den USA entwickelt und breitete sich ab den 1990er Jahren auch in Europa aus.
Warum wird das Shareholder Value-Konzept oft kritisiert?
Kritiker bemängeln, dass andere Interessengruppen wie Mitarbeiter oder Kunden vernachlässigt werden und eine kurzfristige Gewinnmaximierung langfristigen Zielen schaden kann.
Was ist der Unterschied zwischen Shareholder und Stakeholder?
Shareholder sind die Eigentümer (Aktionäre), während Stakeholder alle Gruppen umfassen, die ein Interesse am Unternehmen haben (z.B. Lieferanten, Staat, Belegschaft).
Welche Rolle spielen Finanzkennzahlen in diesem Konzept?
Finanzkennzahlen und eine wertorientierte Rechnungslegung sind zentral, um den Erfolg der Unternehmenssteuerung messbar zu machen.
- Citation du texte
- Julia Lira-Mayer (Auteur), 2009, Grundlagen und elementare Handlungsmaximen des Shareholder Value- Konzeptes, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/173590