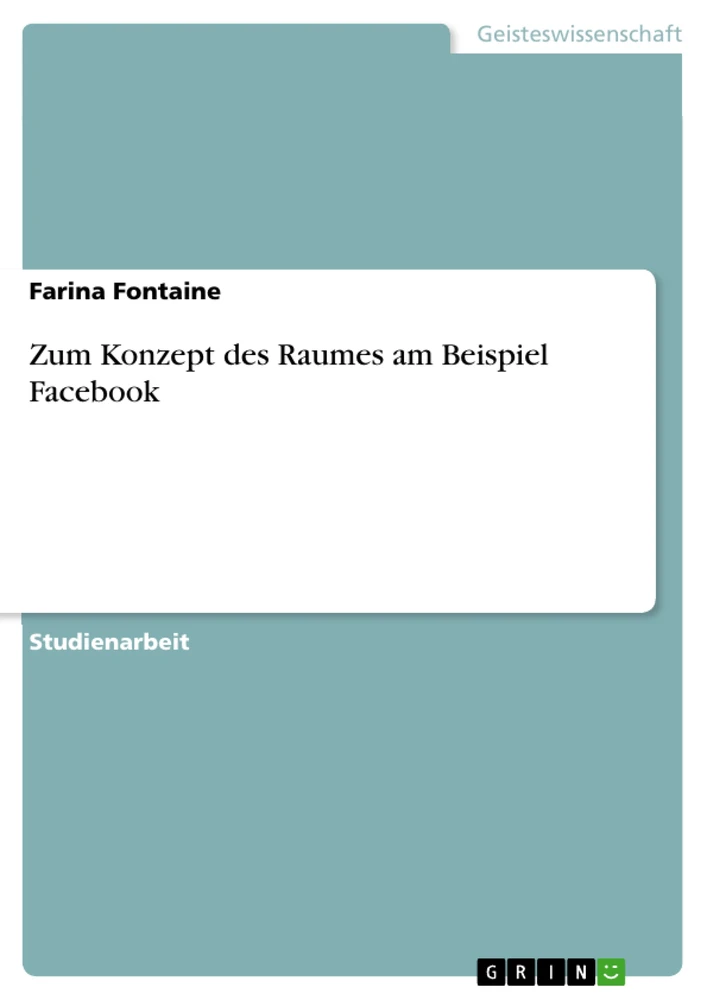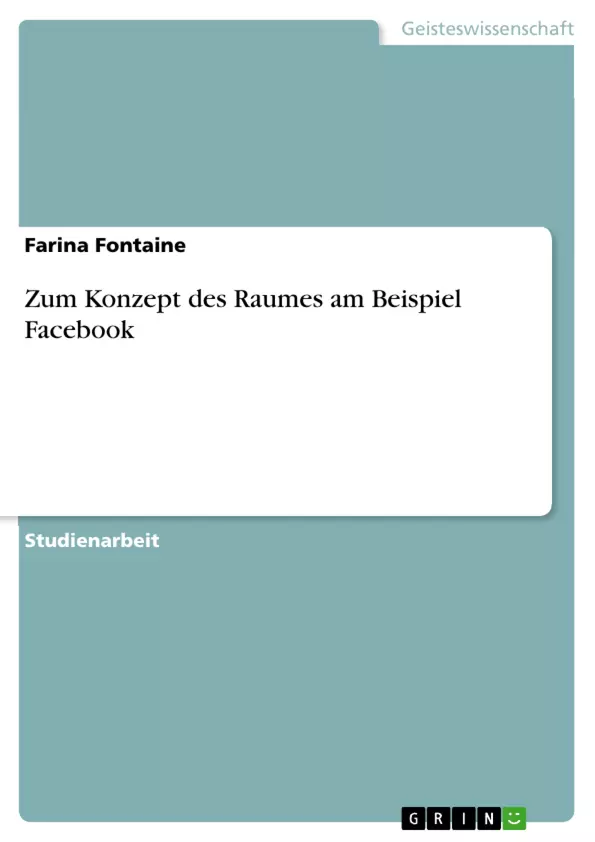„And the Oscar goes to…The Social Network“. Acht Nominierungen hatte der Film erhalten, in drei Kategorien hat der Film tatsächlich am 27. Februar 2011 die begehrte Auszeichnung in Los Angeles verliehen bekommen. Inhalt des Films ist die Entstehungsgeschichte des sozialen Online-Netzwerkes Facebook, rund um Gründer Mark Zuckerberg. Die Handlung des Films beschreibt, wie der Harvard-Student Mark Zuckerberg im Jahr 2003 FaceMash entwickelt, eine Website, die Fotos von Studentinnen des Campus zeigt. Nutzer können per Mausklick deren Attraktivität bewerten und vergleichen. Aus dieser Idee entwickelt sich erst www.thefacebook.com, ein Uni-internes Online Netzwerk, das alle Studenten der Universität Harvard miteinander verbinden soll, recht bald aber weite Kreise zieht und als Facebook in den vergangenen Jahren zum erfolgreichsten Sozialen Netzwerk der Welt geworden ist.
Im Januar 2011 wurde Facebook zum Austragungsort öffentlicher Aktionen und Demonstrationen. Während der Unruhen in Ägypten hatten sich über das Soziale Netzwerk Massen zusammengefunden und untereinander zu Demonstrationen verabredet. Nutzer hatten in Facebook-Gruppen zu Protesten aufgefordert, politisch mobilisierten sie sich erst online, dann auf der Straße. Der strauchelnde ägyptische Präsident Husni Mubarak versuchte, den Zugang zu Sozialen Netzwerken zu blockieren und die Kommunikation unter den Demonstranten so zu erschweren. Die Rolle der Sozialen Netzwerke in diesen Kontexten besteht in ihrer Funktion als Raum für Massenkommunikation. Hier treten bereits zwei zentrale Begriffe dieser Arbeit auf: Raum und Kommunikation.
Ziel der Arbeit ist es, aufzuzeigen inwieweit Facebook als ein Raum definiert werden kann. Zu diesem Zweck werden Raumtheorien diskutiert, der Fokus liegt dabei auf dem für diese Arbeit notwendigen relationalen Raumbegriff. Es wird gezeigt, wie theoretische Kriterien auf die Internetplattform Facebook angewendet werden können. Zuerst werden in Kapitel 2 die für diese Arbeit nötigen Begriffe spatial turn, virtueller Raum und Kommunikation definiert und verschiedene Ansätze zum Begriff Raum und besonders zum relationalen Raumbegriff vorgestellt. In Kapitel 3 werden dann allgemeine Informationen zu Facebook aufgeführt und Aufbau und Funktionen charakterisiert. Die Zusammenführung der Theorien und Ihre Anwendung an der Internetplattform Facebook erfolgt in Kapitel 4. Die entscheidende Fragestellung ist, wie Facebook als ein Raumkonzept beschrieben werden kann.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 1.1 Ausgangssituation
- 1.2 Aufbau und Zielsetzung der Arbeit
- 1.3 Verortung in der Kulturwissenschaft/Volkskunde
- 1.4 Forschungsstand
- 1.5 Probleme bei der volkskundlichen Internetforschung
- 2. Begriffsbestimmungen und Definitionen
- 2.1 Raumauffassungen und der spatial turn
- 2.2 Virtuelle Räume
- 2.3 Kommunikation
- 3. Facebook
- 3.1 Allgemeines
- 3.2 Aufbau und Funktionen
- 4. Facebook als Raum
- 4.1 Raum als Repräsentation
- 4.2 Facebook als virtuelles Raumkonzept
- 4.3 Grenzen
- 4.4 Kommunikation bei Facebook
- 4.5 Zugang
- 4.6 Die Überschneidung von Realität und Virtualität
- 4.7 Authentizität
- 5. Fazit und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit der Frage, inwieweit Facebook als ein Raum definiert werden kann. Dabei werden Raumtheorien diskutiert und die Anwendung theoretischer Kriterien auf die Internetplattform Facebook untersucht.
- Der räumliche Aspekt von Facebook im Kontext des spatial turn
- Das Konzept des virtuellen Raums und seine Beziehung zu Facebook
- Die Rolle der Kommunikation in Facebook als Raum
- Die Grenzen und Überschneidungen zwischen Realität und Virtualität im Rahmen von Facebook
- Authentizität und Selbstdarstellung in Facebook
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einführung, die den Kontext der Arbeit anhand des Films "The Social Network" und aktuellen Ereignissen wie den Protesten in Ägypten erläutert. Dabei wird deutlich, dass Facebook als Raum und Kommunikation zentrale Themen der Arbeit sind.
Kapitel 2 behandelt die relevanten Begrifflichkeiten, darunter der spatial turn, virtuelle Räume und Kommunikation. Es werden verschiedene Ansätze zum Raumbegriff und insbesondere zum relationalen Raumbegriff vorgestellt.
Kapitel 3 bietet allgemeine Informationen zu Facebook und beschreibt Aufbau und Funktionen der Plattform.
In Kapitel 4 werden die in Kapitel 2 vorgestellten Theorien auf Facebook angewendet. Die Frage, wie Facebook als Raumkonzept beschrieben werden kann, steht im Mittelpunkt dieses Kapitels.
Schlüsselwörter
Die Arbeit fokussiert auf die Konzepte von Raum und Kommunikation im Kontext von Facebook. Dabei werden insbesondere der spatial turn, virtuelle Räume, die Analyse von Facebook als Raumkonzept und die Relevanz der Plattform für soziale Interaktion und gesellschaftliche Prozesse untersucht.
Häufig gestellte Fragen
Kann Facebook wissenschaftlich als "Raum" definiert werden?
Ja, die Arbeit nutzt relationale Raumtheorien und den "spatial turn", um zu zeigen, dass Facebook als ein virtuelles Raumkonzept für Massenkommunikation fungiert.
Welche Rolle spielte Facebook bei den Unruhen in Ägypten 2011?
Facebook diente als Raum für politische Mobilisierung und Kommunikation, in dem sich Massen zu Demonstrationen verabredeten und organisierten.
Was bedeutet "relationaler Raumbegriff" im Kontext sozialer Netzwerke?
Raum wird nicht als physischer Behälter, sondern durch die Beziehungen und Interaktionen der Nutzer zueinander innerhalb der Plattform konstituiert.
Wie überschneiden sich Realität und Virtualität auf Facebook?
Die Grenzen verschwimmen, da Online-Aktionen reale politische Folgen haben und die digitale Selbstdarstellung (Authentizität) Auswirkungen auf das soziale Leben außerhalb des Netzes hat.
Was sind die Probleme bei der volkskundlichen Internetforschung?
Herausforderungen liegen in der Schnelllebigkeit der Daten, der Anonymität der Nutzer und der Schwierigkeit, authentische kulturelle Praktiken im digitalen Raum zu verifizieren.
- Quote paper
- B.A. Farina Fontaine (Author), 2011, Zum Konzept des Raumes am Beispiel Facebook, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/173607