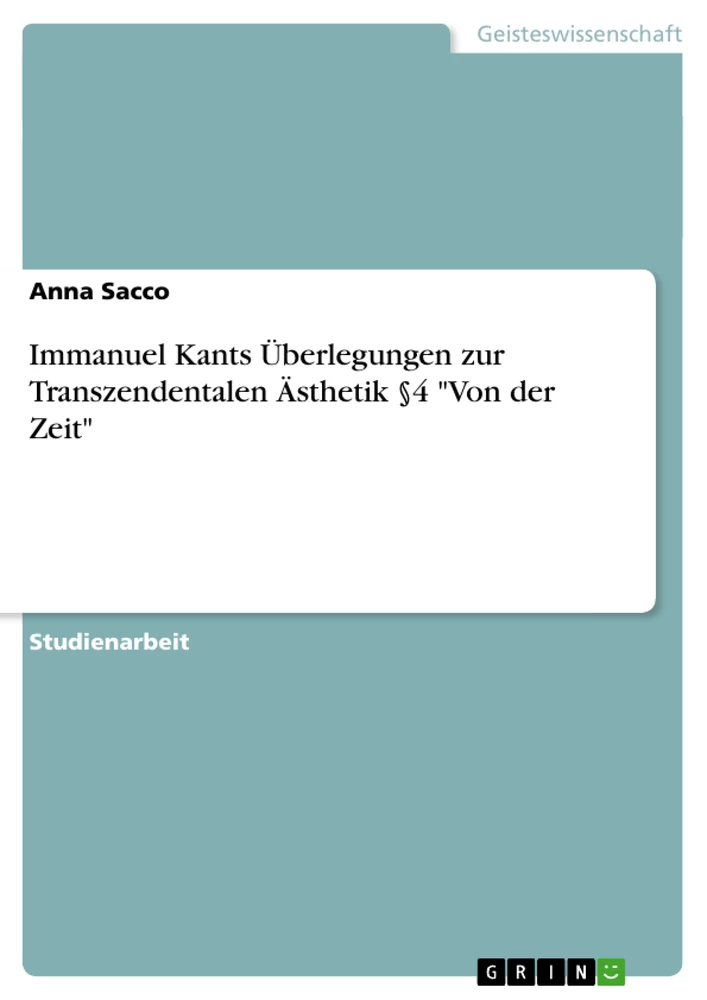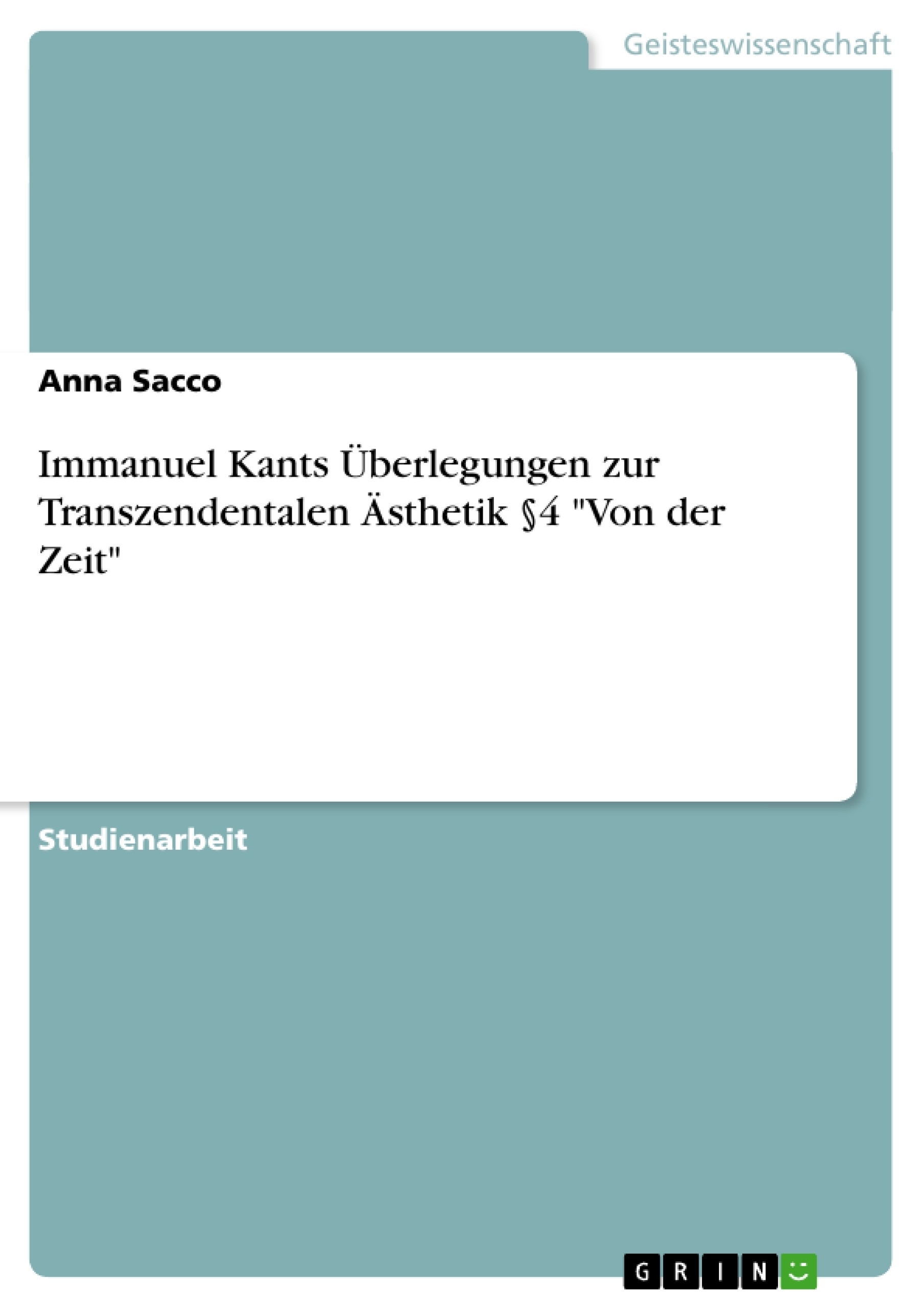Meine Hausarbeit ist der äußerst ausführliche Versuch die `Transzendentale Ästhetik § 4´ aus Immanuel Kants "Kritik der reinen Vernunft" unter Bezugnahme von Kommentaren und Beiträgen anderer Philosophen abzuhandeln.
Kants Abhandlung verfolgt das Ziel, unsere Sinnlichkeit als eine durch Raum und Zeit bestimmte zu enttarnen. Er will beweisen, dass dies die einzige Form ist, durch die wir Dinge wahrnehmen, das heißt anschauen können.
Nur auf diesem Weg kann der Mensch zu Erkenntnis gelangen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Der Transzendentalen Elementarlehre Erster Teil
- Die Transzendentale Ästhetik
- Zweiter Abschnitt: Von der Zeit
- §4 Metaphysische Erörterung des Begriffs der Zeit
- Erstes Zeitargument: Ideas temporis non oritur, sed supponitur a sensibus.
- Zweites Zeitargument: Absolute und relative Notwendigkeit der Zeit.
- Viertes Zeitargument: Idea temporis est singularis, non generalis.
- Fünftes Zeitargument: Unendlichkeit und Kontinuität der Zeit.
- Zweiter Abschnitt: Von der Zeit
- Die Transzendentale Ästhetik
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit Immanuel Kants Überlegungen zur Transzendentalen Ästhetik, genauer gesagt mit §4 „Von der Zeit“ aus seiner Kritik der reinen Vernunft. Ziel der Arbeit ist es, Kants Argumentation in diesem Abschnitt zu analysieren und zu verstehen, wie er die Zeit als apriorische Form der sinnlichen Anschauung darstellt.
- Apriorität der Zeitvorstellung
- Anschauungscharakter der Zeit
- Zeit als Bedingung der Möglichkeit von Erfahrung
- Kants Kritik an der metaphysischen Zeitauffassung
- Die Rolle der Vorstellungskraft in Bezug auf die Zeit
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung gibt einen Überblick über den Aufbau der Arbeit und erläutert die behandelten Abschnitte aus §4 der Transzendentalen Ästhetik. Sie führt kurz die Argumentationslinie Kants in diesem Abschnitt ein und stellt die zentrale Frage nach der Apriorität und dem Anschauungscharakter der Zeitvorstellung in den Mittelpunkt.
Der Transzendentalen Elementarlehre Erster Teil
Dieser Abschnitt stellt den Kontext für Kants Analyse der Zeit dar, indem er die grundlegenden Prinzipien der Transzendentalen Ästhetik erläutert. Er behandelt die Begriffe der Sinnlichkeit, des Verstandes und der Anschauung, sowie die Unterscheidung zwischen empirischer und reiner Anschauung.
Zweiter Abschnitt: Von der Zeit
Der zweite Abschnitt konzentriert sich auf Kants metaphysische Erörterung des Zeitbegriffs. Er analysiert die fünf Argumente, die Kant für die Apriorität und den Anschauungscharakter der Zeitvorstellung vorbringt. Die Argumente befassen sich unter anderem mit der Unabhängigkeit der Zeitvorstellung von den Sinnen, der Notwendigkeit der Zeit für die Ordnung unserer Erfahrungen und der singulären und unendlichen Natur der Zeit.
- Quote paper
- Anna Sacco (Author), 2003, Immanuel Kants Überlegungen zur Transzendentalen Ästhetik §4 "Von der Zeit", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/17375