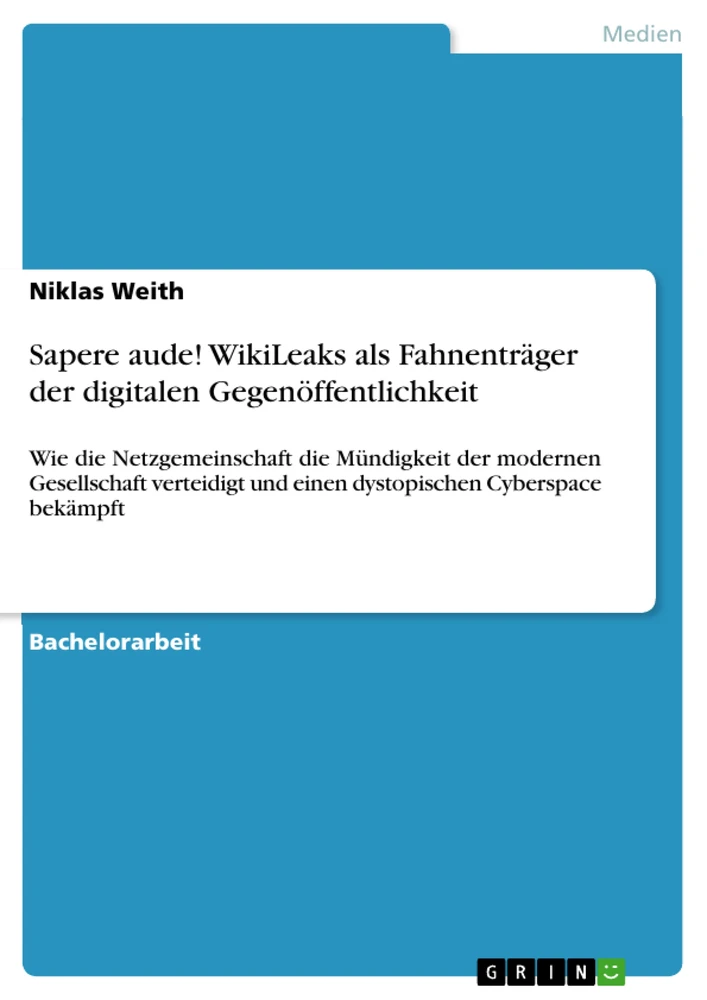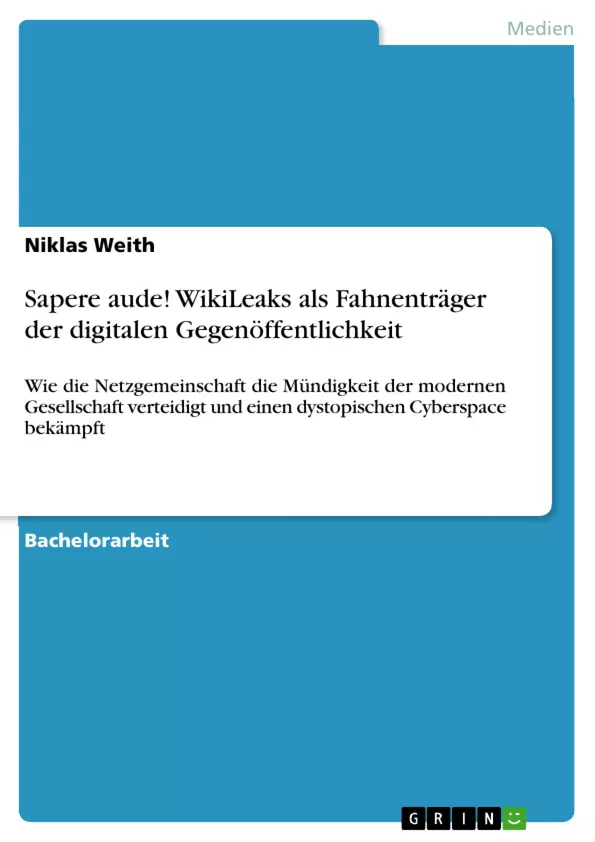Der Fortschrittsoptimismus prägte die Bewegung eines Bürgertums, welches sich auf die Macht einer kritischen Öffentlichkeit stützte, um Emanzipation, Presse- und Religionsfreiheit sowie bürgerliche Grundrechte durchzusetzen. Inzwischen lebt der moderne Mensch in aufgeklärten Industriestaaten, in denen Meinungs- und Pressefreiheit durch Grundgesetze und Menschrechte gesichert sind. Doch kann man trotz der gegebenen Freiheiten von einer mündigen Gesellschaft reden, die ihre Meinungsfreiheit nutzt? Im Grunde sollte dies durch die etablierten Medien wie Presse, Rundfunk und Fernsehen gewährleistet werden, indem sie den politischen Apparat überwachen, der Öffentlichkeit als Informationsquelle dienen und als Katalysator für Diskussionen und Debatten fungieren. Die Realität wird jedoch von vielen Beobachtern anders eingeschätzt und es ist die Rede von einem Versagen der vierten Gewalt und seiner demokratischen Aufsichtspflicht. Verschleierung, Informationszensur und eine politische Verdrossenheit seien die Folgen. Doch wie kann der Mensch aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit austreten und wie kann die Meinungsfreiheit geschützt werden?
Im Informationszeitalter hat wohl der moderne Sturm und Drang als erste Kultur den Nut-zen der digitalen Medien für sich entdeckt. Das Internet gibt der Gegenöffentlichkeit nicht nur eine Plattform für den Diskurs und den Austausch von Informationen, sondern bietet die Möglichkeit Einfluss auf Politik und mediale Agenda zu nehmen. Am deutlichsten zeugt das Bestreben der Whistleblower-Plattform WikiLeaks davon, Einfluss auf die globa-le Politik auszuüben und die Öffentlichkeit für eine Ausübung ihrer Meinungsfreiheit zu sensibilisieren. Im Folgenden sollen die Fragen geklärt werden, welche Auswirkungen eine Enthüllungsplattform wie WikiLeaks auf die Mündigkeit der modernen Gesellschaft hat und welche Motivationen, Normen, Moralen und Ethiken hinter den Aktionen der Netzaktivisten stehen und mit welchen Methoden diese umgesetzt werden. Es wird analysiert, wie sich die digitale Gegenöffentlichkeit konstituiert und mit welchen Mitteln sie versucht ihre eigene Meinungsfreiheit im Cyberspace zu bewahren und wie durch öffentlich wirksame Aktionen auch die Zivilgesellschaft auf politische und ethische Missstände aufmerksam gemacht wird...
Inhaltsverzeichnis
- 1. Sapere aude – der Mut zum eigenen Verstand
- 2. Figuration der Öffentlichkeit
- 2.1 Politikwissenschaftliche Aspekte
- 2.2 Sozialpsychologische Aspekte
- 2.3 Soziologische Aspekte
- 3. Figuration der Gegenöffentlichkeit
- 3.1 Kritische Teilöffentlichkeiten
- 3.2 Autonome Öffentlichkeiten
- 3.3 Anti-institutionelle Diskursöffentlichkeit
- 3.4 Abgrenzung zum Begriff der Öffentlichkeit
- 4. Die digitale Gegenöffentlichkeit
- 4.1 Hackerethik
- 4.2 4chan
- 4.2.1 Entstehung und chronologischer Verlauf
- 4.2.2 Community und interne Kommunikation
- 4.2.3 4chan und die Öffentlichkeit
- 4.3 Anonymous
- 4.3.1 Project Chanology
- 4.3.2 Palin E-Mail Hack
- 4.3.3 Operation Payback
- 4.4 Zwischenfazit
- 5. WikiLeaks und die Renaissance der Aufklärung
- 5.1 Etablierung der Enthüllungsplattform
- 5.1.1 Entstehung und erste Stunden
- 5.1.2 Zur Struktur
- 5.1.3 Die ersten Leaks
- 5.2 Collateral Murder
- 5.2.1 Inhaltsanalyse
- 5.2.2 Detailanalyse
- 5.2.3 Folgenanalyse
- 5.3 Die Kriegstagebücher, Teil I: Afghanistan War Logs
- 5.3.1 Intermediale Kooperation
- 5.3.2 Folgenanalyse
- 5.4 Die Kriegstagebücher, Teil II: Iraq War Logs
- 5.4.1 Inhaltsanalyse
- 5.4.2 Folgenanalyse
- 5.5 Bewertungen der Kriegstagebücher
- 5.6 Cablegate: Die Botschaftsdepeschen
- 5.6.1 Historische Referenz
- 5.6.2 Boulevardesque oder brisant?
- 5.1 Etablierung der Enthüllungsplattform
- 6. Abschließende Analysen
- 6.1 Diskretion oder Information – Eine Alternativfrage?
- 6.2 Help WikiLeaks keep governments open
- 6.3 Der neue Datenjournalismus als digitale Revolution
- 6.4 Transparenz als Synonym für Meinungsfreiheit?
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den Einfluss von WikiLeaks auf die Mündigkeit der modernen Gesellschaft im Kontext der digitalen Gegenöffentlichkeit. Sie analysiert die Entstehung und Funktionsweise von WikiLeaks sowie verwandter Netzaktivitäten, um die dahinterstehenden Motivationen, Methoden und ethischen Implikationen zu beleuchten. Die Arbeit fragt nach der Rolle digitaler Medien bei der Verteidigung der Meinungsfreiheit und der Bekämpfung eines dystopischen Cyberspace.
- Der Begriff der Öffentlichkeit und Gegenöffentlichkeit im digitalen Zeitalter
- Die Rolle von WikiLeaks als Plattform für Enthüllungen und deren Auswirkungen
- Die Funktionsweise und Ethik von Netzaktivisten und Hackerkollektiven
- Der Einfluss digitaler Medien auf die politische Meinungsbildung und die öffentliche Debatte
- Der Zusammenhang zwischen Transparenz und Meinungsfreiheit
Zusammenfassung der Kapitel
1. Sapere aude – der Mut zum eigenen Verstand: Dieses einleitende Kapitel reflektiert Kants Aufklärungsbegriff und stellt die Frage nach der Mündigkeit der modernen Gesellschaft in Zeiten vermeintlicher Meinungsfreiheit. Es argumentiert, dass etablierte Medien in ihrer Aufgabe, die Öffentlichkeit zu informieren und politische Kontrolle auszuüben, versagen könnten. Das Kapitel führt WikiLeaks als Beispiel für eine digitale Gegenöffentlichkeit ein, die versucht, diesem Versagen entgegenzuwirken und die Öffentlichkeit für die Ausübung ihrer Meinungsfreiheit zu sensibilisieren. Die Arbeit wird als Analyse der Auswirkungen von WikiLeaks auf die gesellschaftliche Mündigkeit und der Motivationen hinter den Aktionen der Netzaktivisten vorgestellt.
2. Figuration der Öffentlichkeit: Dieses Kapitel befasst sich mit dem vielschichtigen Begriff der „Öffentlichkeit“. Es analysiert den Begriff unter politikwissenschaftlichen, sozialpsychologischen und soziologischen Aspekten und erweitert die Betrachtung um medienwissenschaftliche Perspektiven, um den Fokus auf die digitale Kommunikation zu legen. Die Analyse legt den Grundstein für das Verständnis der Gegenöffentlichkeit als einem wichtigen Gegenstück zur etablierten, möglicherweise manipulierten, öffentlichen Meinungsbildung.
Schlüsselwörter
WikiLeaks, digitale Gegenöffentlichkeit, Meinungsfreiheit, Mündigkeit, Netzöffentlichkeit, Hackerethik, Enthüllungsjournalismus, Transparenz, Aufklärung, Cyberspace, Informationszeitalter, Whistleblower.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Analyse der digitalen Gegenöffentlichkeit am Beispiel von WikiLeaks
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Die Arbeit untersucht den Einfluss von WikiLeaks auf die Mündigkeit der modernen Gesellschaft im Kontext der digitalen Gegenöffentlichkeit. Sie analysiert die Entstehung und Funktionsweise von WikiLeaks und verwandter Netzaktivitäten, um die Motivationen, Methoden und ethischen Implikationen zu beleuchten. Ein zentraler Punkt ist die Rolle digitaler Medien bei der Verteidigung der Meinungsfreiheit und der Bekämpfung eines dystopischen Cyberspace.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themen: Der Begriff der Öffentlichkeit und Gegenöffentlichkeit im digitalen Zeitalter; die Rolle von WikiLeaks als Plattform für Enthüllungen und deren Auswirkungen; die Funktionsweise und Ethik von Netzaktivisten und Hackerkollektiven; der Einfluss digitaler Medien auf die politische Meinungsbildung und die öffentliche Debatte; und der Zusammenhang zwischen Transparenz und Meinungsfreiheit.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit und worum geht es in ihnen?
Die Arbeit gliedert sich in mehrere Kapitel. Kapitel 1 beleuchtet Kants Aufklärungsbegriff und die Mündigkeit der modernen Gesellschaft. Kapitel 2 analysiert den vielschichtigen Begriff der „Öffentlichkeit“ unter politikwissenschaftlichen, sozialpsychologischen und soziologischen Aspekten. Kapitel 3 und 4 befassen sich mit der Gegenöffentlichkeit, insbesondere der digitalen Gegenöffentlichkeit am Beispiel von 4chan und Anonymous. Kapitel 5 analysiert WikiLeaks, seine Enthüllungen (Collateral Murder, Afghanistan War Logs, Iraq War Logs, Cablegate) und deren Auswirkungen. Kapitel 6 bietet abschließende Analysen zu den Themen Diskretion vs. Information, die Rolle von WikiLeaks, den neuen Datenjournalismus und den Zusammenhang zwischen Transparenz und Meinungsfreiheit.
Welche Schlüsselbegriffe sind relevant?
Wichtige Schlüsselbegriffe sind: WikiLeaks, digitale Gegenöffentlichkeit, Meinungsfreiheit, Mündigkeit, Netzöffentlichkeit, Hackerethik, Enthüllungsjournalismus, Transparenz, Aufklärung, Cyberspace, Informationszeitalter, Whistleblower.
Wie wird der Begriff der Öffentlichkeit definiert und analysiert?
Der Begriff der Öffentlichkeit wird unter politikwissenschaftlichen, sozialpsychologischen und soziologischen Aspekten analysiert. Die Analyse berücksichtigt medienwissenschaftliche Perspektiven, um den Fokus auf digitale Kommunikation zu legen und den Begriff der Gegenöffentlichkeit als Gegenstück zur etablierten öffentlichen Meinungsbildung zu verstehen.
Welche Rolle spielt WikiLeaks in dieser Analyse?
WikiLeaks dient als Fallbeispiel für eine digitale Gegenöffentlichkeit, die versucht, dem möglichen Versagen etablierter Medien bei der Information der Öffentlichkeit entgegenzuwirken. Die Analyse untersucht die Auswirkungen von WikiLeaks auf die gesellschaftliche Mündigkeit und die Motivationen hinter den Aktionen der Netzaktivisten.
Welche konkreten Enthüllungen von WikiLeaks werden untersucht?
Die Arbeit analysiert mehrere Enthüllungen von WikiLeaks, darunter "Collateral Murder", die "Afghanistan War Logs", die "Iraq War Logs" und "Cablegate". Für jede Enthüllung werden Inhaltsanalysen, Detailanalysen und Folgenanalysen durchgeführt.
Welche Schlussfolgerungen zieht die Arbeit?
Die Arbeit zieht Schlussfolgerungen zum Spannungsfeld zwischen Diskretion und Information, zur Rolle von WikiLeaks im Kampf für Transparenz und Meinungsfreiheit, zum Einfluss des neuen Datenjournalismus und zur Frage, inwieweit Transparenz ein Synonym für Meinungsfreiheit ist.
- Arbeit zitieren
- Niklas Weith (Autor:in), 2011, Sapere aude! WikiLeaks als Fahnenträger der digitalen Gegenöffentlichkeit, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/173789