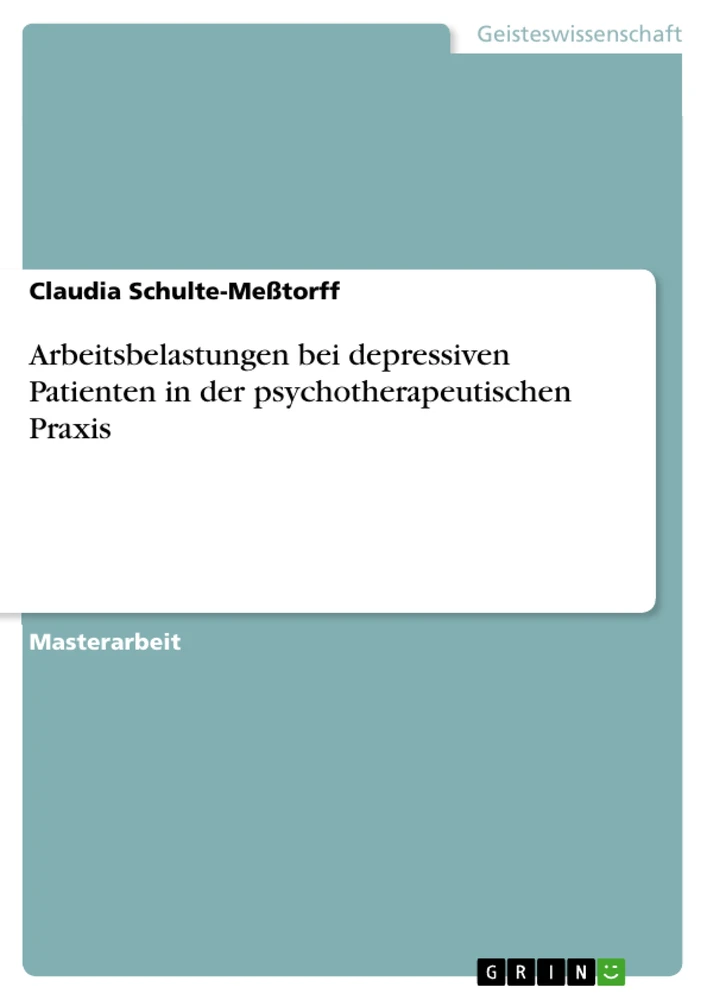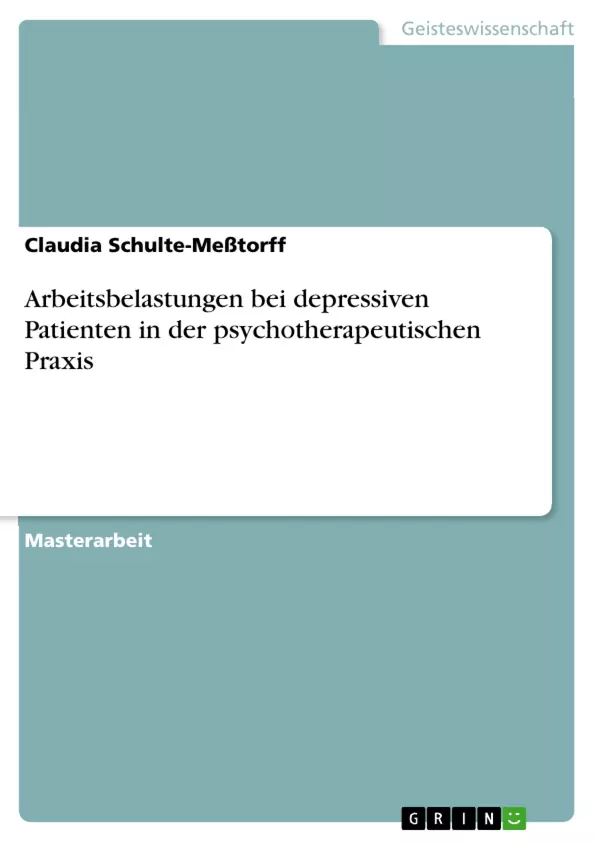Psychische Erkrankungen nehmen in den letzten Jahren in ihrer
Häufigkeit einen beachtlichen Stellenwert in der ambulanten
Versorgung ein. Das gilt insbesondere für Depressionen. Depressionen
führen zu den längsten Arbeitsausfällen, sind eine der häufigsten
Frühberentungsursachen und verursachen einen erheblichen
subjektiven Leidensdruck.
Ein Teil der psychischen Beeinträchtigungen wird auf arbeitsbedingte
Stressoren zurückgeführt. Diesen Ansatz weiter zu verfolgen ist Ziel der
vorliegenden Arbeit. Sie soll der Frage nachgehen, ob sich ein
derartiger Zusammenhang auch an einer klinischen Stichprobe einer
psychotherapeutischen Praxis darstellen lässt und welche Faktoren
möglicherweise einen Teil der Depressivität erklären.
Die Untersuchung wird an einer Patientenstichprobe aus einer Praxis
für psychosomatische Medizin durchgeführt. Befragt werden alle
Patienten, die die diagnostischen Kriterien einer Depression nach der
International Classification of Diseases (ICD 10) erfüllen. Eingesetzt
werden das Beck Depressions Inventar, die Irritationsskalen nach Mohr
und der SALSA-Fragebogen.
Die Auswertung zeigt, dass sich einige der in der Literatur bechriebenen
Zusammenhänge nachweisen lassen, allerdings überwiegend mit
schwach signifikanten Ergebnissen. Belegt wurden u.a. die Einflüsse
sozialer Unterstützung und des Vorgesetztenverhaltens auf das
Ausmaß der Depressivität.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Theoretischer Teil
- Begriffsklärung Depression
- Epidemiologische Daten
- Ursachen
- Theoretische Modelle
- Belastungs-Beanspruchungskonzept
- Stressmodell
- Gratifikationskrisen
- Anforderungs-Kontroll-Modell
- Ressourcenkonzept
- Psychische Belastungen und Ressourcen
- Widersprüchlichkeit und Taylorisierung
- Teamklima
- Vorgesetztenverhalten und soziale Unterstützung
- Arbeitsanforderungen und Handlungsspielraum
- Belohnung
- Fairness
- Restrukturierung
- Emotionsarbeit
- Erfolg
- Zusammenfassung
- Hypothesen
- Empirischer Teil
- Untersuchungsplanung
- Stichprobenauswahl und Instruktion
- Auswahl der Instrumente
- Auswertung
- Beschreibung der Stichprobe
- Korrelationen
- Regressionen
- Diskussion
- Neuigkeitswert der Arbeit
- Methodenkritik
- Ergebnisbewertung
- Praxisrelevanz
- Theoretische Fundierung und weiterführende Gedanken
- Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert den Zusammenhang zwischen Arbeitsbelastungen und depressiven Erkrankungen bei einer klinischen Stichprobe aus einer psychosomatischen Praxis. Die Studie soll aufzeigen, ob sich beobachtete Zusammenhänge zwischen Arbeitsbelastungen und psychischen Störungen objektivieren lassen und welche Faktoren zur Depressivität beitragen.
- Zusammenhang zwischen Arbeitsbelastungen und depressiven Erkrankungen
- Analyse relevanter theoretischer Erklärungsmodelle
- Bedeutung von Faktoren wie sozialer Unterstützung, Vorgesetztenverhalten und Arbeitsanforderungen
- Etablierung von Zusammenhängen an einer klinischen Stichprobe
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die die Motivation für die Studie und den Forschungsfokus darstellt. Im theoretischen Teil werden die Begriffe "Depression" und "Burnout" definiert sowie epidemiologische Daten präsentiert. Es werden verschiedene theoretische Modelle zum Auftreten psychischer Störungen im Rahmen beruflicher Belastungen erläutert, darunter das Belastungs-Beanspruchungskonzept, das Stressmodell, das Gratifikationskrisenmodell, das Anforderungs-Kontroll-Modell und das Ressourcenkonzept. Des Weiteren werden verschiedene psychische Belastungen und Ressourcen diskutiert, wie Widersprüchlichkeit und Taylorisierung, Teamklima, Vorgesetztenverhalten und soziale Unterstützung, Arbeitsanforderungen und Handlungsspielraum, Belohnung, Fairness, Restrukturierung, Emotionsarbeit und Erfolg. Abschließend werden Hypothesen für die empirische Untersuchung aufgestellt.
Der empirische Teil der Arbeit beschreibt die Untersuchungsplanung, Stichprobenauswahl und Instruktion sowie die Auswahl der eingesetzten Instrumente. Die Auswertung umfasst eine Beschreibung der Stichprobe, die Analyse von Korrelationen und Regressionen.
In der Diskussion werden der Neuigkeitswert der Arbeit, die Methodenkritik, die Ergebnisbewertung und die Praxisrelevanz beleuchtet. Schließlich werden die theoretische Fundierung und weiterführende Gedanken in den Fokus gerückt.
Schlüsselwörter
Die Arbeit fokussiert auf die Themen Depression, Burnout, Arbeitsbelastungen, psychosomatische Praxis, theoretische Modelle und empirische Forschung. Die wichtigsten Konzepte umfassen Belastungs-Beanspruchungskonzept, Stressmodell, Gratifikationskrisenmodell, Anforderungs-Kontroll-Modell, Ressourcenkonzept, soziale Unterstützung, Vorgesetztenverhalten, Arbeitsanforderungen, Handlungsspielraum, Belohnung, Fairness, Restrukturierung, Emotionsarbeit und Erfolg.
Häufig gestellte Fragen
Können Arbeitsbelastungen Depressionen verursachen?
Ja, die Studie belegt, dass arbeitsbedingte Stressoren wie Zeitdruck, mangelnde soziale Unterstützung und schlechtes Vorgesetztenverhalten signifikant zur Entstehung von Depressionen beitragen können.
Was ist das Anforderungs-Kontroll-Modell?
Dieses Modell besagt, dass psychische Belastung besonders dann entsteht, wenn hohe Arbeitsanforderungen auf einen geringen Handlungsspielraum (Kontrolle) treffen.
Welche Rolle spielt die soziale Unterstützung am Arbeitsplatz?
Soziale Unterstützung durch Kollegen und Vorgesetzte wirkt als Puffer gegen Stress. Ihr Fehlen erhöht das Risiko für psychische Erkrankungen wie Burnout und Depression erheblich.
Was versteht man unter einer "Gratifikationskrise"?
Eine Gratifikationskrise entsteht, wenn der Arbeitnehmer das Gefühl hat, dass seine erbrachte Leistung nicht angemessen belohnt wird (z.B. durch Gehalt, Anerkennung oder Aufstiegschancen).
Wie wurde die Depressivität in der Studie gemessen?
Eingesetzt wurden standardisierte klinische Instrumente wie das Beck Depressions Inventar (BDI), die Irritationsskalen nach Mohr und der SALSA-Fragebogen zur Erfassung von Arbeitsbelastungen.
- Citar trabajo
- Dr. med. Claudia Schulte-Meßtorff (Autor), 2011, Arbeitsbelastungen bei depressiven Patienten in der psychotherapeutischen Praxis, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/173803