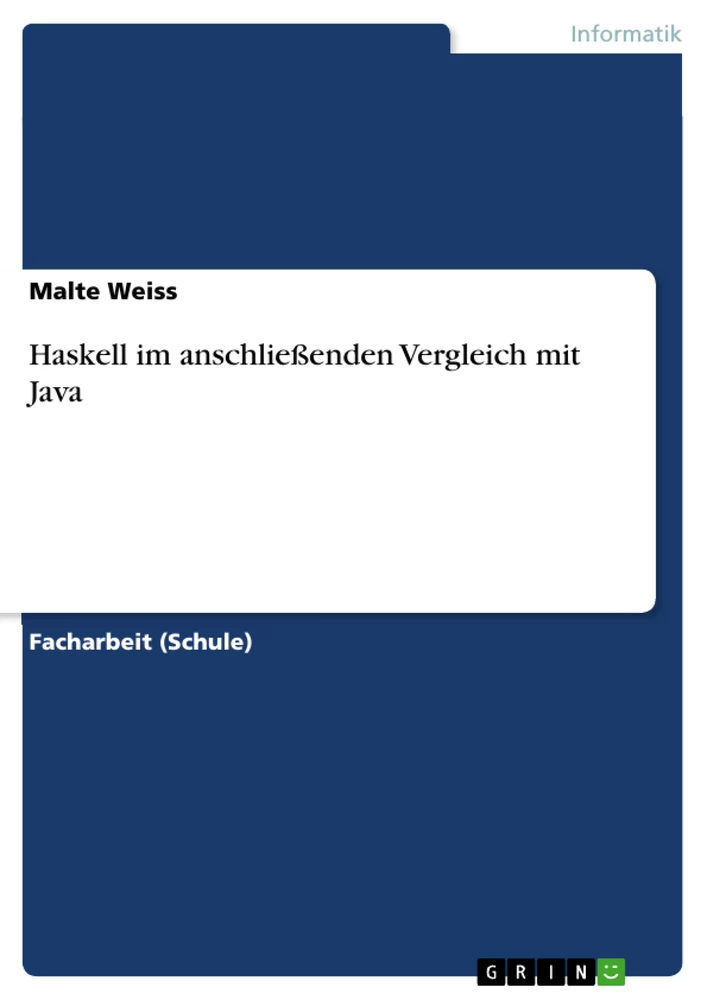In dieser Facharbeit geht der Autor auf die wesentlichen Bestandteile der Programmiersprache Haskell ein und verdeutlicht diese kurz an Beispielen. Dabei zeigt er Ähnlichkeiten mit der Sprache Java auf und stellt beide Sprachen nochmals gezielt am Ende gegenüber.
Inhaltsverzeichnis (Table of Contents)
- Einleitung
- Teil 1: Programmiersprachen
- Haskell
- Allgemeines
- Programmieren in Haskell
- Datentypen
- Typ - Synonyme
- Grundlagen der Funktion
- Typklassen
- Liste
- Bytestring
- Tupel
- If-else, Guards und lokale Funktionen
- Funktionen höherer Ordnung
- Curry
- Pattern Matching
- Rekursion
- Module
- Ein- und Ausgabe
- Exceptions
- Java
- Vergleich
- Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte (Objectives and Key Themes)
Diese Arbeit befasst sich mit den wesentlichen Bestandteilen der Programmiersprache Haskell. Es werden wichtige Konzepte erläutert und mit Beispielen veranschaulicht. Zudem wird ein Vergleich mit der Programmiersprache Java durchgeführt, um die Unterschiede und Gemeinsamkeiten aufzuzeigen.
- Die Funktionsweise und Besonderheiten der funktionalen Programmiersprache Haskell
- Die wichtigsten Datentypen und Kontrollstrukturen in Haskell
- Ein Vergleich der beiden Programmiersprachen Haskell und Java
- Die Anwendung von Konzepten wie Lambda-Kalkül, Typisierung und Rekursion in Haskell
- Der Einsatz von Haskell in verschiedenen Anwendungsgebieten
Zusammenfassung der Kapitel (Chapter Summaries)
- Die Einleitung stellt die Programmiersprache Haskell vor und beschreibt ihren Ursprung und ihre wichtigsten Eigenschaften. Es wird erläutert, dass Haskell eine rein funktionale Programmiersprache ist, die auf dem Lambda-Kalkül basiert. Außerdem werden die Vorteile der statischen Typisierung und die Funktionsweise von Typinferenz erklärt.
- Im ersten Kapitel wird die Sprache Haskell genauer betrachtet. Es werden verschiedene Datentypen wie Int, Integer, Float, Double, Bool, Char und String vorgestellt und mit Beispielen veranschaulicht. Zudem wird die Verwendung von „data“-Deklarationen für die Definition eigener Datentypen erläutert. Das Kapitel behandelt außerdem den Datentyp Maybe, der für die Darstellung von optionalen Werten verwendet wird.
- Das zweite Kapitel beschäftigt sich mit der Funktionsweise von Typ-Synonymen, die es ermöglichen, existierende Typen mit neuen Namen zu versehen. Es wird erklärt, wie diese verwendet werden, um den Code lesbarer zu gestalten. Außerdem werden die Grundlagen der Funktionsdefinition, Funktionssignatur und die Unterschiede zwischen monomorphen und polymorphen Funktionen beschrieben.
- Das Kapitel über Java wird die wichtigen Aspekte dieser Programmiersprache beleuchten und den Vergleich zu Haskell ermöglichen.
Schlüsselwörter (Keywords)
Haskell, funktionale Programmierung, Lambda-Kalkül, statische Typisierung, Typinferenz, Datentypen, Funktionen, Rekursion, Java, Vergleich, Programmiersprachen, Kontrollstrukturen.
Häufig gestellte Fragen
Was zeichnet die Programmiersprache Haskell aus?
Haskell ist eine rein funktionale Programmiersprache, die auf dem Lambda-Kalkül basiert, statisch typisiert ist und Konzepte wie „Lazy Evaluation“ (faule Auswertung) nutzt.
Was ist der Hauptunterschied zwischen Haskell und Java?
Während Java primär objektorientiert und imperativ ist, verfolgt Haskell einen deklarativen, funktionalen Ansatz, bei dem Funktionen im Mittelpunkt stehen und Nebenwirkungen minimiert werden.
Was bedeutet statische Typisierung in Haskell?
Es bedeutet, dass die Datentypen bereits zur Kompilierzeit feststehen, was viele Fehlerquellen ausschließt und durch Typinferenz oft automatisch vom Compiler erkannt wird.
Was versteht man unter Rekursion in Haskell?
Da es in Haskell keine klassischen Schleifen (wie for oder while) gibt, werden Wiederholungen durch Funktionen gelöst, die sich selbst mit veränderten Parametern aufrufen.
Wofür wird der Datentyp „Maybe“ verwendet?
Der Maybe-Typ wird genutzt, um optionale Werte sicher zu handhaben und Fehler durch „Null-Pointer-Exceptions“ (wie in Java bekannt) zu vermeiden.
- Citar trabajo
- Malte Weiss (Autor), 2011, Haskell im anschließenden Vergleich mit Java, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/173817