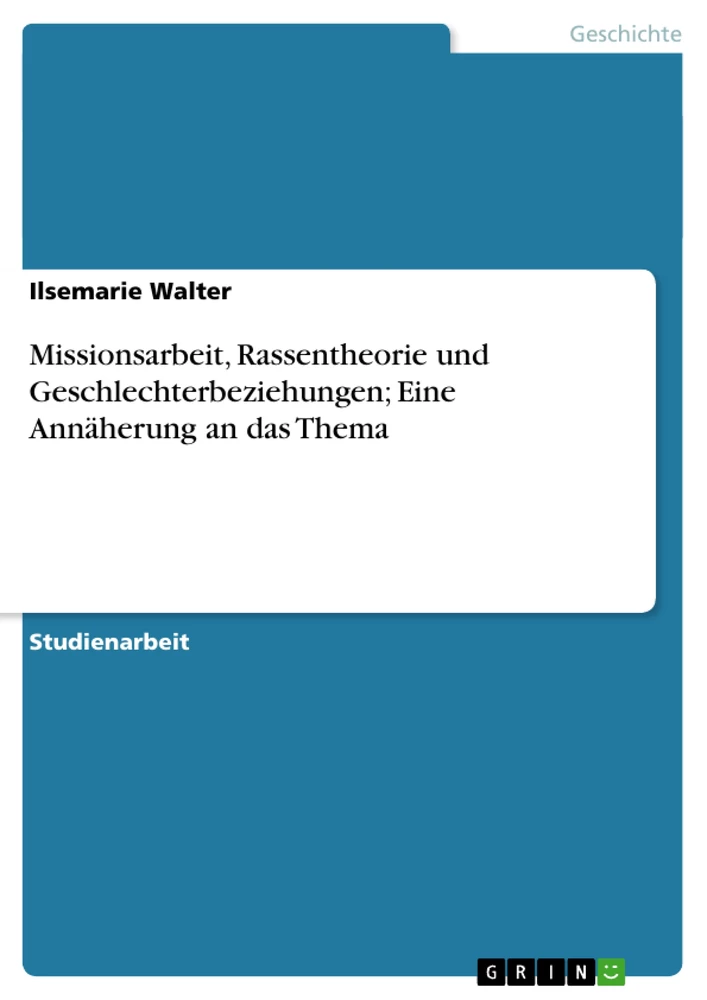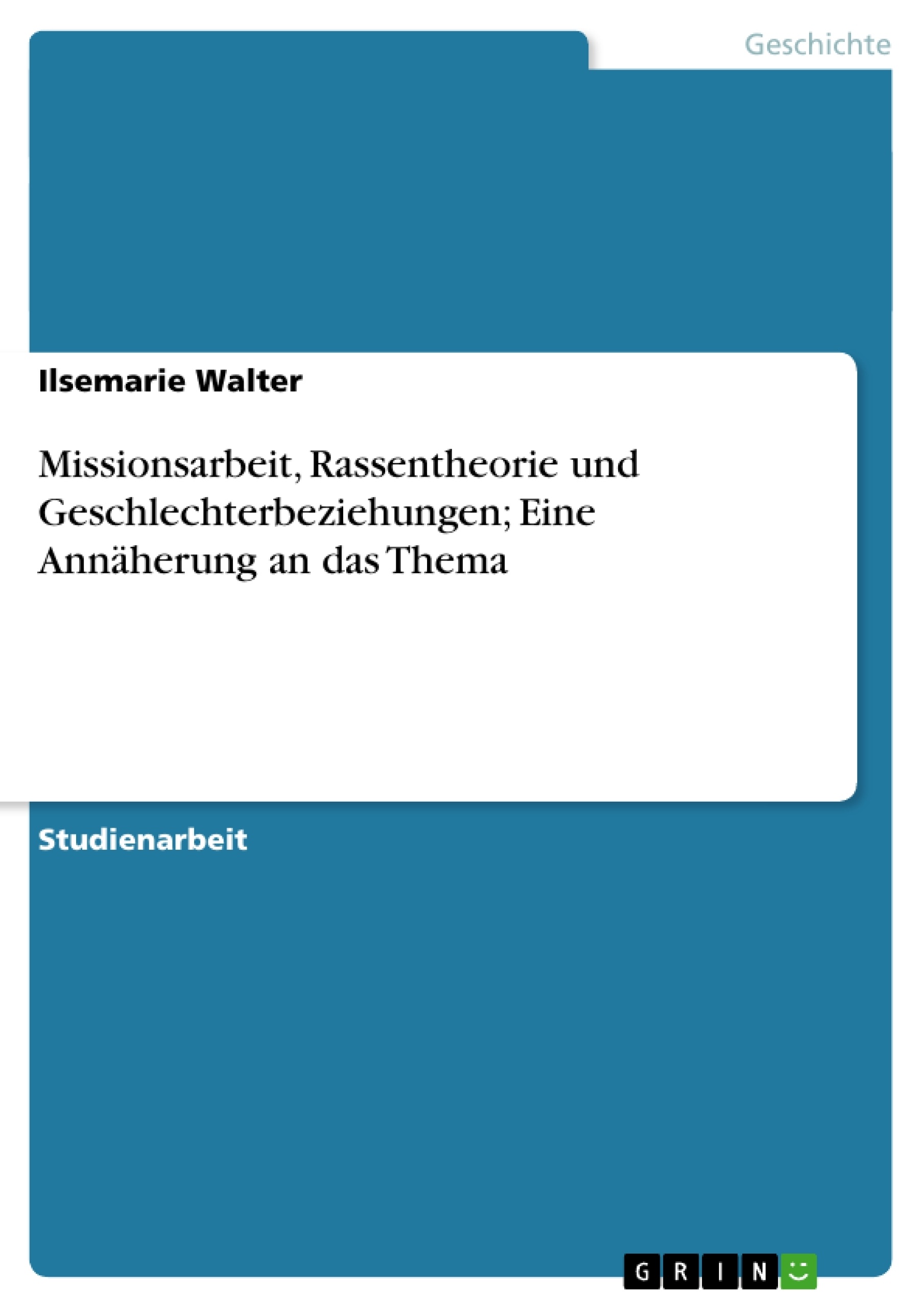Diese Arbeit stellt einen Versuch dar, sich dem komplexen Thema des Verhältnisses zwischen Missionsarbeit, Rassentheorie und Geschlechterbeziehungen anhand der Analyse einiger konkreter Fallbeispiele anzunähern. Dabei wird – nach einem allgemeinen Teil über Rahmenbedingungen der Missionsarbeit – zunächst die theoretische Position dreier Personen aus dem deutschsprachigen Raum untersucht, die im Missionsbereich tätig waren oder ihm nahe standen. Mit einem weiteren Abschnitt ist ein Blick auf die Missionspraxis beabsichtigt, wie sie sich in den Berichten deutschsprachiger Missionsschwestern aus drei verschiedenen Orden widerspiegelt. Bei den Fallbeispielen sowohl aus dem theoretischen wie aus dem praktischen Bereich liegt das Schwergewicht auf dem österreichischen Kon-text.
Weitgehend unbestritten ist, dass enge Zusammenhänge zwischen Missionsarbeit und Kolonialismus existierten und die Missionierung häufig eine verhängnisvolle Rolle spielte, indem sie den Kolonialismus unterstützte. Allerdings dürften die Zusammenhänge weit komplexer sein, als es in einer kurzen Arbeit darzustellen möglich ist.
Die Berichte der Missionsschwestern enthalten eindeutig rassistische Elemente, indem sie je nach Situation deren Bild von der einheimischen Bevölkerung als „Wilde“, „Kinder“ oder „Heiden“ widerspiegeln. Andererseits wird in ihnen auch Hochachtung vor bestimmten (tatsächlichen oder vermeintlichen) guten Eigenschaften dieser Bevölkerung sichtbar wie etwa Freigiebigkeit oder Gastfreundschaft. Die Schwestern beurteilten jedoch die Fremden ausschließlich nach ihren eigenen Kriterien, die sie von Europa mitgebracht hatten. Nach diesen Kriterien wollten sie auch die fremden Völker „erziehen“ und nahmen ihnen dabei oft Unersetzliches. Die Unterdrückung der Frau, die innerhalb der weißen Gesellschaft und insbesondere in der katholischen Kirche verschwiegen und verdrängt wurde, wurde bei den anderen Völkern kritisiert, um stärker als „Heilsbringer“ auftreten zu können.
Eines der Resultate, das sich bei dieser Arbeit gezeigt hat, ist die enge Verknüpfung des Geschehens im Missionsgebiet selbst und in der Heimat der Missionare. Wenn Mission als Beziehungsphänomen zu verstehen ist, wie Faschingeder vorschlägt, mit dem Europa versuchte, sein Verhältnis zum Fremden zu organisieren, dann ist dieser Versuch wohl in erster Linie an seiner Einseitigkeit und der fehlenden Symmetrie in der Beziehung gescheitert.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Rahmenbedingungen der Missionsarbeit und Verhältnis zur Kolonialmacht
- Theoretische Positionen
- Wilhelm Schmidt (1868 - 1954)
- Viktor Lebzelter (1889-1936)
- Sixta (Maria) Kasbauer (1888 – 1973)
- Die einheimische Bevölkerung in den Berichten deutscher und österreichischer Missionsschwestern
- Berichte deutscher Franziskanerinnen aus South Dakota 1886 – 1900
- Berichte deutschsprachiger Steyler Missionsschwestern in der Zeitschrift „Missionsgrüße“ 1923-1939
- Berichte österreichischer Missionsschwestern der Kongregation „Königin der Apostel“ aus Indien 1927 - 1939
- Exkurs: Zur Entstehungsgeschichte der Kongregation
- Die Berichte
- Resümee
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der komplexen Beziehung zwischen Missionsarbeit, Rassentheorien und Geschlechterbeziehungen. Sie untersucht, wie diese drei Bereiche im Kontext der Missionspraxis und -theorie im 19. und 20. Jahrhundert miteinander verzahnt waren. Die Untersuchung basiert auf Fallbeispielen aus der Missionsarbeit und analysiert dabei insbesondere Berichte von Missionsschwestern.
- Verhältnis von Missionsarbeit und Kolonialismus
- Rassentheorien und ihre Bedeutung für die Missionsarbeit
- Die Rolle der Missionsschwestern und ihre Sichtweise auf die einheimische Bevölkerung
- Geschlechterbeziehungen in der Missionsarbeit
- Die Entwicklung von „Entwicklungshilfe“ im Vergleich zur Missionsarbeit
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Diese Einleitung stellt die Zielsetzung und den Kontext der Arbeit vor. Sie skizziert die Komplexität des Themas und die Schwierigkeiten bei der Abgrenzung von Rassismus und der Wahrnehmung ethnischer Unterschiede.
- Rahmenbedingungen der Missionsarbeit und Verhältnis zur Kolonialmacht: Dieses Kapitel beleuchtet den historischen Kontext der Missionsarbeit und ihr Verhältnis zur Kolonialisierung. Es zeigt die enge Zusammenarbeit und die teilweise verhängnisvolle Verflechtung zwischen diesen beiden Bereichen auf.
- Theoretische Positionen: Dieses Kapitel analysiert die theoretischen Positionen von wichtigen Persönlichkeiten im Bereich der Missionsarbeit und der Rassentheorie, wie Wilhelm Schmidt, Viktor Lebzelter und Sixta (Maria) Kasbauer.
- Die einheimische Bevölkerung in den Berichten deutscher und österreichischer Missionsschwestern: Dieses Kapitel untersucht verschiedene Berichte von Missionsschwestern, um Einblicke in ihre Sichtweise auf die einheimische Bevölkerung zu gewinnen. Es analysiert Berichte deutscher Franziskanerinnen aus South Dakota, deutschsprachiger Steyler Missionsschwestern und österreichischer Missionsschwestern der Kongregation „Königin der Apostel“ aus Indien.
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf die Schlüsselbegriffe Missionsarbeit, Rassentheorie, Geschlechterbeziehungen, Kolonialismus, Entwicklungshilfe, Ethnizität und Anthropologie. Die Untersuchung analysiert die Interaktionen und Verflechtungen dieser Begriffe im historischen Kontext des 19. und 20. Jahrhunderts.
Häufig gestellte Fragen
Wie hängen Missionsarbeit und Kolonialismus zusammen?
Missionsarbeit unterstützte oft den Kolonialismus, indem sie europäische Werte exportierte und die einheimische Bevölkerung nach westlichen Kriterien „erziehen“ wollte.
Welche rassistischen Elemente finden sich in Berichten von Missionsschwestern?
Die Berichte spiegeln oft ein Bild der Einheimischen als „Wilde“, „Kinder“ oder „Heiden“ wider, was eine Überlegenheit der weißen, christlichen Kultur impliziert.
Welche Rolle spielten Geschlechterbeziehungen in der Mission?
Die Unterdrückung der Frau bei fremden Völkern wurde oft kritisiert, um die Missionare als „Heilsbringer“ darzustellen, während Geschlechterhierarchien in der eigenen Kirche meist verschwiegen wurden.
Wer war Wilhelm Schmidt im Kontext der Missionswissenschaft?
Wilhelm Schmidt war ein einflussreicher Ethnologe und Priester, dessen theoretische Positionen zur Anthropologie und Religionsgeschichte die Missionsarbeit prägten.
Warum scheiterte das Beziehungsphänomen „Mission“ oft?
Laut der Arbeit scheiterte die Mission oft an der Einseitigkeit und der fehlenden Symmetrie in der Beziehung zwischen Europa und den missionierten Völkern.
- Quote paper
- Ilsemarie Walter (Author), 2003, Missionsarbeit, Rassentheorie und Geschlechterbeziehungen; Eine Annäherung an das Thema, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/17386