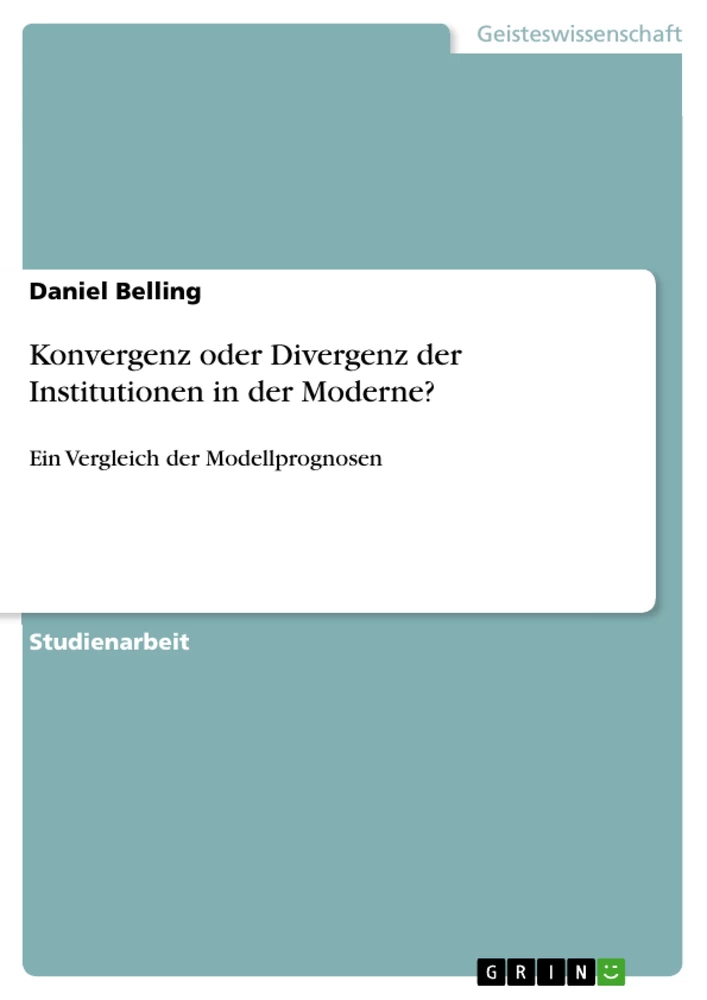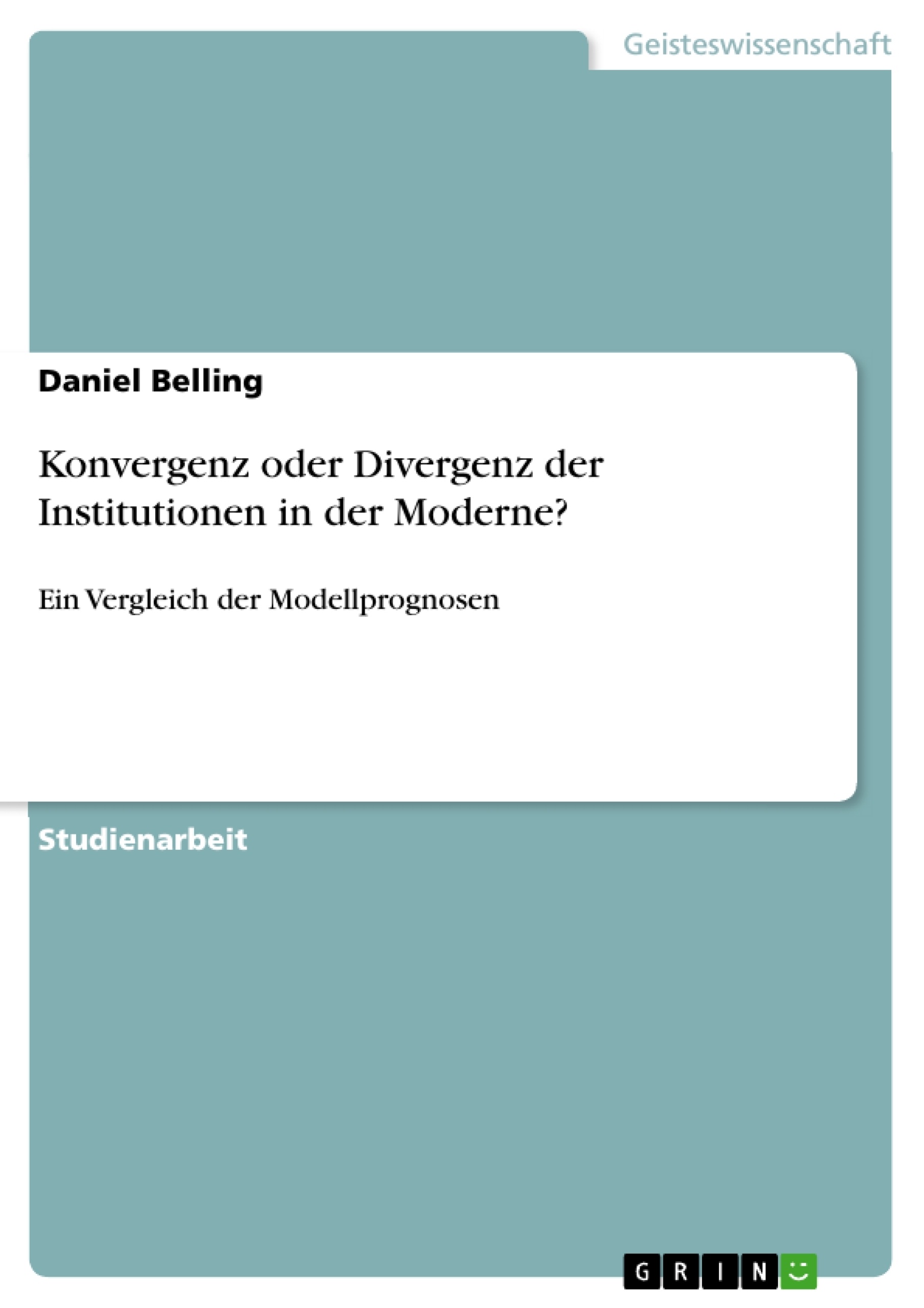Die Arbeit stellt zwei wichtige aktuelle Ansätze der Institutionenanalyse vor: Die Neue Institutionenökonomik nach North basiert auf grundlegenden Kosten-Nutzen-Überlegungen, wobei die Frage nach dem Fortbestehen ineffizienter Institutionen mit zu hohen Kosten bei der Einführung neuerer Institutionen beantwortet wird. Für den Neuen Soziologischen Institutionalismus nach DiMaggio/Powell steht die Frage, weshalb Organisationen sich in ihrer Struktur innerhalb eines Feldes angleichen - obwohl dies häufig mit hohen Kosten verbunden ist. Dieses als "Isomorphismus" bezeichnete Phänomen bietet sich auch als Erklärung für Konvergenzen(nationaler) Institutionen an.
Inhalt
Einleitung
Die Neue Institutionenökonomik bei North
Der Neue Institutionalismus als alternativer Ansatz
Prognosen für die Zukunft - Vergleich der Modelle
Literatur
Einleitung
Institutionen sind das Produkt menschlichen Handelns und somit auch ein kulturelles Produkt. Dennoch sind diese „Spielregeln der Gesellschaft“ keineswegs einfach zu begreifen. Dies liegt auch daran, dass Institutionen nur zum Teil bewusste Schöpfungen menschlichen Schaffens sind und die Verbindlichkeit, d.h. der Grad der Handlungsorientierung an institutionellen Vorgaben, unterschiedlich stark ist.
Institutionentheorien versuchen, diesen Schwierigkeiten in ihren Darlegungen zu begegnen und uns begreifbar zu machen, wie Institutionen wirken und wie groß der Einfluss der Akteure auf den Wandel von Institutionen ist. Dazu wird praktischerweise die institutionelle Ebene getrennt von der organisationalen (Handlungs-)Ebene analysiert und die Wechselbeziehungen benannt.
Neben der Frage wie institutioneller Wandel abläuft muss ebenso geklärt werden, ob in der Moderne eine Konvergenz der Institutionen zu beobachten sein wird oder aber die Institutionen in verschiedenen Gesellschaften divergieren. Naturgemäß fallen je nach theoretischem Blickwinkel die Prognosen anders aus, und so soll im Folgenden ein Vergleich der neuen Institutionenökonomik mit dem Neuen Institutionalismus in der Soziologie klären, warum beide Programme zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen.
Die Neue Institutionenökonomik bei North
Eine wichtige Frage für jede Institutionentheorie ist diejenige, wie es zu Veränderungen der formgebundenen wie formlosen Regeln der Institution kommt. Der Ausgangspunkt bei North lässt sich dabei als einer dem methodologischem Individualismus nahestehendes Modell beschreiben: Den Akteuren haften subjektive Präferenzen an, aus denen heraus sie Interessen für oder gegen die Umgestaltung einer Institution entwickeln. Dieses Hinterfragen der Regeln nach Zweckmäßigkeitsaspekten kommt einer Abwägung zwischen dem eigenen Nutzen des veränderten institutionellen Rahmens und den Informations- und Transaktionskosten, welche durch den Wandlungsprozess anfallen, gleich. In Anlehnung an den frühen Ökonomen Pareto geht North von einem Institutionellen Gleichgewicht aus, welches er als „Situation, in der […] kein Spieler es vorteilhaft fände, Mittel auf die Neuformulierung der Vereinbarungen aufzuwenden“ (North 1992: 101f.) beschreibt. Dabei ist dies kein Zustand universaler Glückseligkeit, sondern geht es hier um das Ertragen gegenwärtiger Restriktionen, da die Transaktionskosten einen Wandel unattraktiv machen.
Unterscheidet man die organisationale Ebene (hier als Akteursebene) und die sie verfassende institutionelle Ebene voneinander, lassen sich zwei Wirkrichtungen unterscheiden: Zum einen die Wirkung eingrenzender formaler Regelungen seitens der Institutionen, welche die Unternehmer in die Pflicht nimmt, im Gegensatz dazu aber zu einer allgemeinen Wohlfahrtssteigerung (von der alle profitieren) beitragen sollen. So lässt sich annehmen, dass sich durch das eben beschriebene Gleichgewicht eine Situation rien ne va plus ergibt und keine Veränderung mehr nötig ist.
Selbstverständlich ist dem nicht so, denn es verändern sich relative Preise und Präferenzen der Marktteilnehmer. In dieser Situation greift der ökonomische Grundsatz, wonach Akteure auf Anreize reagieren - so auch die Organisationen. Mit der Essenz der Organisation (als Vereinigung von Personen zur Erreichung eines gemeinsamen Zwecks) gibt sie laut North notwendig die Ursache und Richtung institutionellen Wandels vor. Veränderte Bedingungen der organisationalen Umwelt führen zu einer neuen Deutung der Situation bezüglich der Maximierung des Organisationszieles und der Analyse der eigenen Mittelwahl und der bisherigen institutionellen Einschränkungen. Sofern Letztere sich als ein Hindernis der Ersteren herausstellt, „mag die Partei, die eine Verbesserung ihrer Handlungsposition erwarten kann, ohne weiteres versuchen, Mittel auf die Umgestaltung der Regeln einer höheren Stufe zu verwenden“ (a.a.O.: 102). Dies ist die andere Wirkrichtung, die der Organisationen, die aufgrund ihrer Beschaffenheit auf einen kontinuierlichen institutionellen Wandel drängen um so den neuen Gegebenheiten gerecht zu werden.
Der North‘sche Ansatz möchte mitnichten behaupten, dass es permanente Entwicklungen gäbe, die die Institutionen immer effizienter machen - im Gegenteil können frühere Entscheidungen zugunsten der einen (technologischen) Innovation in der Gegenwart zu ineffizienten Resultaten führen. Dabei kann es durchaus effizientere Alternativen geben, doch je früher die Entscheidung getroffen wurde, desto wahrscheinlicher ist es, dass die Akteure diesen Weg eingeschlagen haben; die Transaktionskosten eines Wechsels hin zu effizienteren Optionen steigen mit dem Grad der Pfadabhängigkeit.
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in diesem Text?
Der Text ist eine umfassende Sprachvorschau, die Titel, Inhaltsverzeichnis, Ziele und Schwerpunktthemen, Kapitelzusammenfassungen und Schlüsselwörter enthält. Er vergleicht die Neue Institutionenökonomik nach North mit dem Neuen Institutionalismus in der Soziologie.
Was sind Institutionen laut Einleitung?
Institutionen sind das Produkt menschlichen Handelns und ein kulturelles Produkt. Sie sind die "Spielregeln der Gesellschaft", aber nicht immer einfach zu verstehen, da sie teils bewusst geschaffen sind und die Verbindlichkeit unterschiedlich stark ist.
Was versuchen Institutionentheorien zu erklären?
Institutionentheorien versuchen zu erklären, wie Institutionen wirken und wie groß der Einfluss der Akteure auf den Wandel von Institutionen ist. Sie trennen die institutionelle Ebene von der organisationalen Ebene und analysieren deren Wechselbeziehungen.
Was ist die zentrale Frage im Vergleich der neuen Institutionenökonomik und dem Neuen Institutionalismus?
Es geht darum, ob in der Moderne eine Konvergenz der Institutionen zu beobachten ist oder ob sie divergieren. Die theoretischen Blickwinkel führen zu unterschiedlichen Prognosen.
Wie beschreibt North den Ausgangspunkt für Veränderungen der Institutionen?
North's Ansatz ähnelt dem methodologischen Individualismus. Akteure haben subjektive Präferenzen, aus denen Interessen für oder gegen die Umgestaltung einer Institution entstehen. Dies beinhaltet eine Abwägung zwischen dem eigenen Nutzen des veränderten institutionellen Rahmens und den damit verbundenen Informations- und Transaktionskosten.
Was ist laut North ein institutionelles Gleichgewicht?
Ein institutionelles Gleichgewicht ist eine Situation, in der kein Akteur es vorteilhaft fände, Mittel auf die Neuformulierung der Vereinbarungen aufzuwenden. Es ist kein Zustand universaler Glückseligkeit, sondern das Ertragen gegenwärtiger Restriktionen, da die Transaktionskosten einen Wandel unattraktiv machen.
Wie wirken Institutionen auf Organisationen und umgekehrt?
Institutionen wirken eingrenzend durch formale Regelungen, die Unternehmer in die Pflicht nehmen und zu allgemeiner Wohlfahrtssteigerung beitragen sollen. Organisationen drängen aufgrund ihrer Beschaffenheit auf kontinuierlichen institutionellen Wandel, um den neuen Gegebenheiten gerecht zu werden.
Werden Institutionen durch Entwicklungen immer effizienter?
Nein, frühere Entscheidungen zugunsten einer Innovation können in der Gegenwart zu ineffizienten Resultaten führen. Pfadabhängigkeit und hohe Transaktionskosten können den Wechsel zu effizienteren Optionen erschweren.
Welche Rolle spielen subjektive Modelle der Akteure?
Die subjektiven Modelle der Akteure bedingen den Entwicklungsverlauf. Diese Modelle sind subjektiv aufgrund unvollkommener Märkte, unterschiedlich hoher Transaktionskosten, mangelnder und ungleichmäßiger Allokation von Informationen und ideologisch unterschiedlicher Einfärbung.
- Citation du texte
- Daniel Belling (Auteur), 2009, Konvergenz oder Divergenz der Institutionen in der Moderne?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/173867