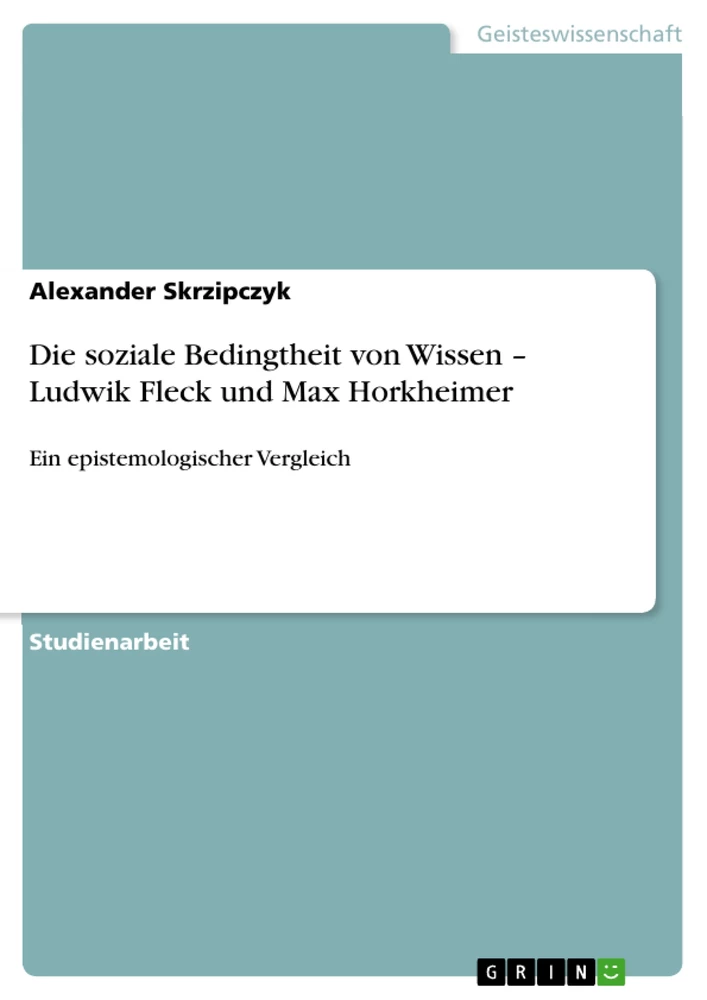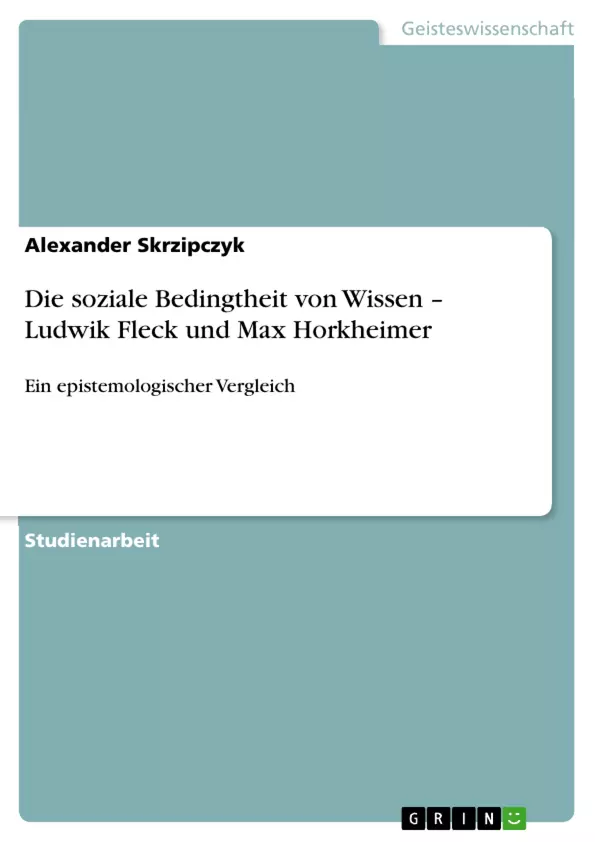„Propaganda, Nachahmung, Konkurrenz, Solidarität, Feindschaft und Freundschaft. Alle diese Motive gewinnen erkenntnistheoretische Wichtigkeit“1. Mit solchen für die damalige Zeit schockierenden Aussagen leitet Ludwik Fleck seine wissenschaftstheoretischen Reflexionen über den „Denkstil“ und das „Denkkollektiv“ ein, wobei zu betonen ist, das er als erster Denker dieser Tradition die soziale Bedingtheit allen Wissens so gründlich zu seinem Leitsatz gemacht hat. Wie genau eine wissenschaftliche Tatsache entsteht, und wie sie sich nach Fleck entwickelt, soll Gegenstand dieser Arbeit sein, deren zweiter Fokus auf den epistemologischen Gedanken in Max Horkheimers berühmten Aufsatz „Traditionelle und Kritische Theorie“ liegt, die im Verlauf der Arbeit mit den Gedanken Flecks verglichen und kontrastiert werden sollen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Historischer Kontext
- Die Entstehung von Wissen
- Urideen und Gestaltsehen
- Über den Denkstil und das Denkkollektiv
- esoterische und exoterische Kreise
- Die soziale Bedingtheit von Wissen
- „Vergleichende Erkenntnistheorie“ und „Kritische Theorie“
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Entstehung und Entwicklung wissenschaftlicher Tatsachen, indem sie die Theorien von Ludwik Fleck und Max Horkheimer vergleicht und kontrastiert. Der Fokus liegt auf der sozialen Bedingtheit von Wissen und der Historizität von Denksystemen. Die Arbeit analysiert, wie Wissen entsteht und sich entwickelt, und beleuchtet die Rolle von Tradition, Erziehung und Denkkollektiven in diesem Prozess.
- Die soziale Bedingtheit von Wissen
- Die Historizität von Denksystemen
- Die Entstehung und Entwicklung wissenschaftlicher Tatsachen
- Der Vergleich der epistemologischen Ansätze von Fleck und Horkheimer
- Die Rolle von Urideen und Gestaltsehen im Erkenntnisprozess
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in die wissenschaftstheoretischen Reflexionen von Ludwik Fleck ein, der die soziale Bedingtheit allen Wissens als Leitsatz formulierte. Die Arbeit fokussiert auf die Entstehung wissenschaftlicher Tatsachen nach Fleck und vergleicht diese mit den epistemologischen Gedanken Max Horkheimers in seinem Aufsatz „Traditionelle und kritische Theorie“. Der Vergleich und Kontrast beider Theorien bilden den Kern der Arbeit.
Historischer Kontext: Dieses Kapitel betont die Historizität der Denksysteme von Fleck und Horkheimer, deren Arbeiten (Flecks 1935, Horkheimers 1937) im Kontext des damaligen Zeitgeschehens und der epistemologischen Diskussionen, insbesondere im Gegensatz zum Wiener Kreis, betrachtet werden. Der unzureichende Umgang mit der sozialen Bedingtheit von Wissen in der damaligen Epistemologie wird hervorgehoben, und die jeweiligen Hintergründe der Autoren (Flecks medizinischer Hintergrund, Horkheimers philosophisch-sozialwissenschaftliche Perspektive) werden skizziert. Die Kritik am Positivismus des Wiener Kreises wird als gemeinsamer Nenner beider Denker herausgestellt.
Die Entstehung des Wissens: Dieses Kapitel, unterteilt in die Unterkapitel „Urideen und Gestaltsehen“, „Über den Denkstil und das Denkkollektiv“ und „esoterische und exoterische Kreise“, beleuchtet die Vorprägungen und Konditionierungen im Erkenntnisprozess. Fleck analysiert die Rolle von „Urideen“ (präwissenschaftlichen Ideen) und dem „Gestaltsehen“ (von Erziehung und Ausbildung geprägte Wahrnehmung) als Ausgangspunkte wissenschaftlicher Erkenntnis. Er betont den Einfluss der kulturellen Erziehung und fachlichen Ausbildung auf die Wahrnehmung und Interpretation von Phänomenen. Der Prozess des Erkennens wird als dynamisch und von einem „Streit der gedanklichen Gesichtsfelder“ geprägt beschrieben, der sich vom unklare Schauen zum fertigen „Gestaltsehen“ entwickelt.
Schlüsselwörter
Soziale Bedingtheit von Wissen, Historische Epistemologie, Ludwik Fleck, Max Horkheimer, Denkstil, Denkkollektiv, Urideen, Gestaltsehen, Traditionelle und kritische Theorie, Wiener Kreis, Wissenschaftsgeschichte.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Entstehung und Entwicklung wissenschaftlicher Tatsachen
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Entstehung und Entwicklung wissenschaftlicher Tatsachen anhand eines Vergleichs und Kontrasts der Theorien von Ludwik Fleck und Max Horkheimer. Der Fokus liegt auf der sozialen Bedingtheit von Wissen und der Historizität von Denksystemen.
Welche Theorien werden verglichen?
Die Arbeit vergleicht die epistemologischen Ansätze von Ludwik Fleck, der die soziale Bedingtheit allen Wissens betonte, und Max Horkheimer, insbesondere dessen Gedanken in "Traditionelle und kritische Theorie".
Welche zentralen Themen werden behandelt?
Zentrale Themen sind die soziale Bedingtheit von Wissen, die Historizität von Denksystemen, die Entstehung und Entwicklung wissenschaftlicher Tatsachen, der Vergleich der epistemologischen Ansätze von Fleck und Horkheimer, sowie die Rolle von "Urideen" und "Gestaltsehen" im Erkenntnisprozess.
Was versteht man unter "Urideen" und "Gestaltsehen" im Kontext der Arbeit?
„Urideen“ bezeichnen präwissenschaftliche Ideen, während „Gestaltsehen“ die von Erziehung und Ausbildung geprägte Wahrnehmung beschreibt. Beide sind nach Fleck Ausgangspunkte wissenschaftlicher Erkenntnis und beeinflussen die Interpretation von Phänomenen.
Welche Rolle spielen Denkstile und Denkkollektive?
Fleck betont den Einfluss von Denkkollektiven und Denkstilen auf den Erkenntnisprozess. Der Prozess des Erkennens wird als dynamisch und von einem „Streit der gedanklichen Gesichtsfelder“ geprägt beschrieben.
Wie wird der historische Kontext berücksichtigt?
Die Arbeit betrachtet die Arbeiten von Fleck (1935) und Horkheimer (1937) im Kontext des damaligen Zeitgeschehens und der epistemologischen Diskussionen, insbesondere im Gegensatz zum Wiener Kreis. Die jeweiligen Hintergründe der Autoren und die Kritik am Positivismus des Wiener Kreises werden beleuchtet.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit beinhaltet eine Einleitung, ein Kapitel zum historischen Kontext, ein Kapitel zur Entstehung von Wissen (mit Unterkapiteln zu Urideen, Gestaltsehen, Denkstilen und Denkkollektiven sowie esoterischen und exoterischen Kreisen), ein Kapitel zur sozialen Bedingtheit von Wissen, ein Kapitel zum Vergleich von "Vergleichender Erkenntnistheorie" und "Kritischer Theorie", und ein Literaturverzeichnis.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Soziale Bedingtheit von Wissen, Historische Epistemologie, Ludwik Fleck, Max Horkheimer, Denkstil, Denkkollektiv, Urideen, Gestaltsehen, Traditionelle und kritische Theorie, Wiener Kreis, Wissenschaftsgeschichte.
Für wen ist diese Arbeit bestimmt?
Diese Arbeit ist für ein akademisches Publikum bestimmt, das sich mit wissenschaftstheoretischen Fragen, der Wissenschaftsgeschichte und den epistemologischen Ansätzen von Fleck und Horkheimer auseinandersetzen möchte.
- Arbeit zitieren
- Alexander Skrzipczyk (Autor:in), 2011, Die soziale Bedingtheit von Wissen – Ludwik Fleck und Max Horkheimer , München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/173978