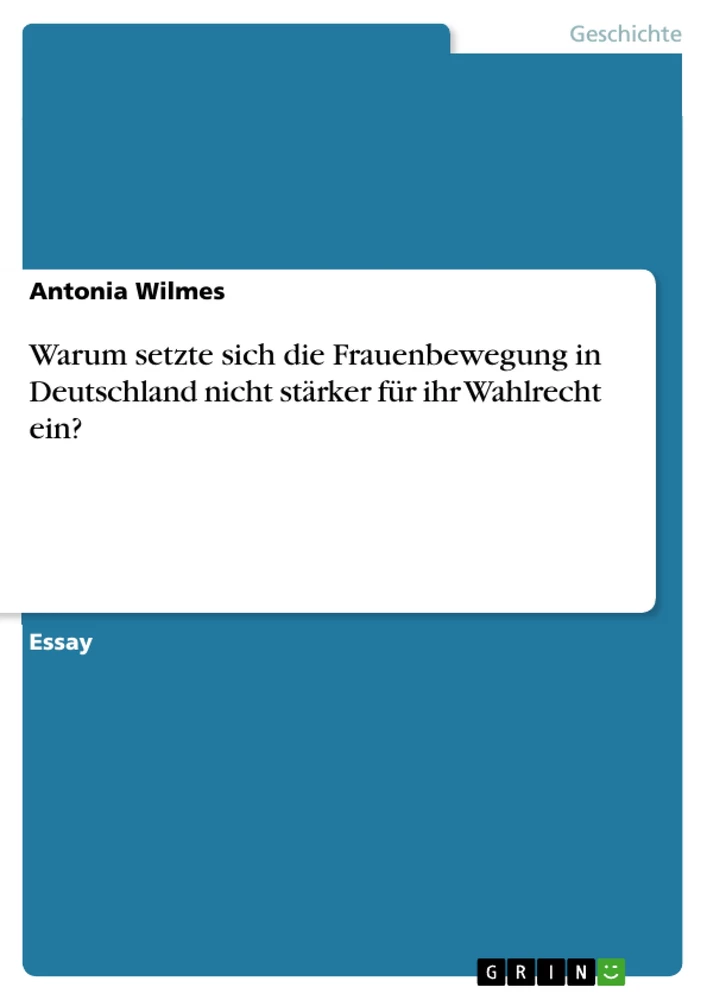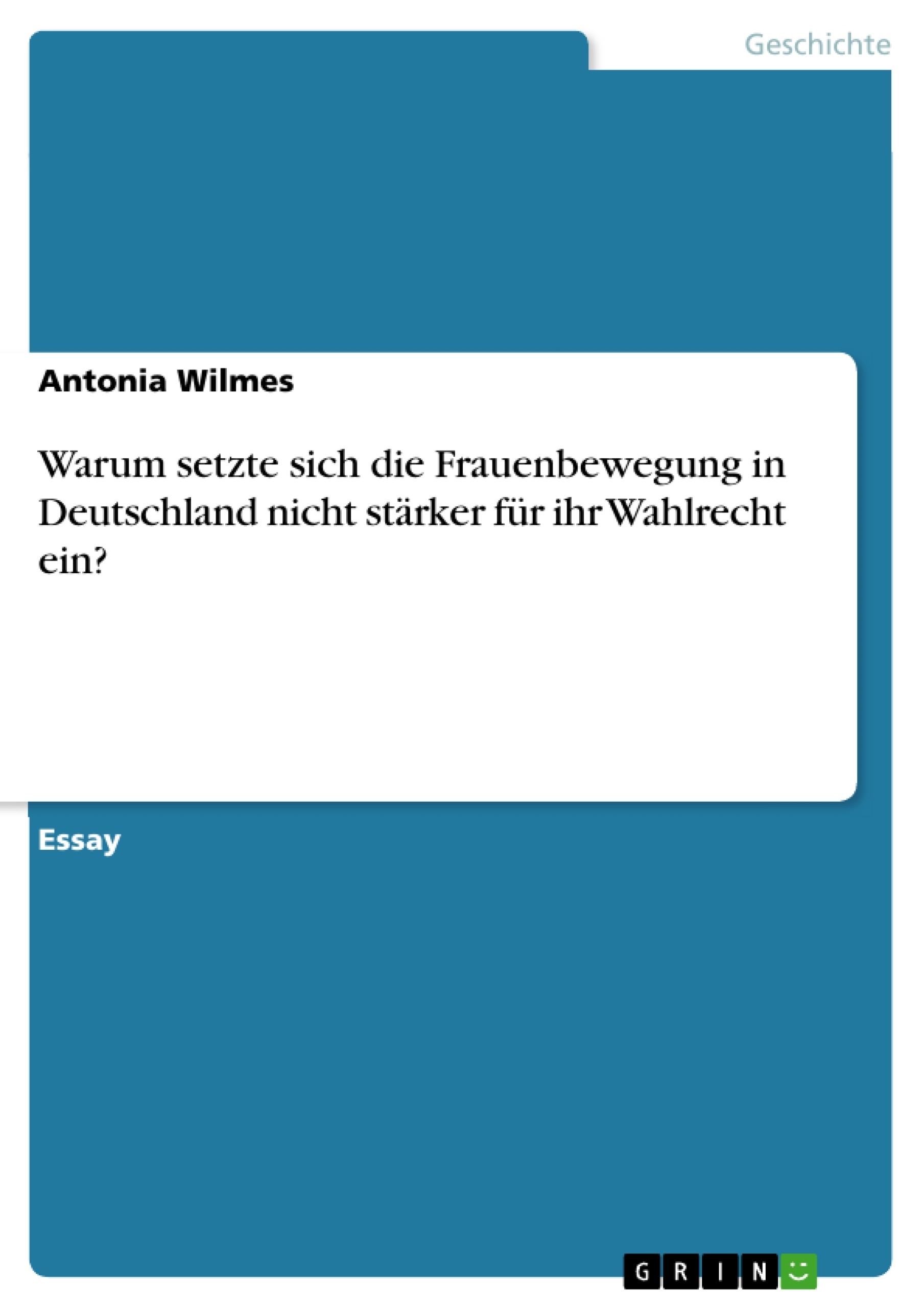„Die Frau des 19. Jahrhunderts erkannte, dass sie in einer Männerwelt lebte; sie sah, dass die Familie, der Beruf, die Bildungsmöglichkeiten, die Stadt, der Staat, die innere und die äußere Politik, ja auch die Kirche von Männern nach Männerbedürfnissen und –wünschen ausgerichtet waren; und sie sah weiter, dass alle diese Bildungen mit schweren Männern behaftet waren.“
In vier Bereichen kämpften die Frauen um ihre Emanzipation: Gleichheit auf dem Gebiet der Bildung, des Erwerbslebens, der Ehe und Familie und des öffentlichen Lebens in Gemeinde und Staat. Das Frauenwahlrecht wurde von der, in der Mitte des 19. Jahrhunderts in Deutschland entstehenden Frauenbewegung als die „Grundbedingung allen Frauenfortschritts“ angesehen.
Doch die Meinungen gingen auseinander, als es darum ging, wie man an das Frauenwahlrecht gelangen kann und wie schnell das passieren sollte. Viele Frauen des 19. Jahrhunderts hatten das Bedürfnis ihre Lebensumstände zu ändern. Dazu gehörte für sie zwar auch, jedoch nicht in erster Linie, die Forderung nach einem gleichen Wahlrecht für Männer und Frauen.
Inhaltsverzeichnis (Table of Contents)
- Warum setzte sich die Frauenbewegung in Deutschland nicht stärker für ihr Wahlrecht ein?
- Die Frau des 19. Jahrhunderts
- Kämpfe um Emanzipation
- Meinungsverschiedenheiten zum Frauenwahlrecht
- Mangel an Bildung
- Der „Allgemeine Deutsche Frauenverein“
- Widerstand und Argumente gegen die Frauenbewegung
- Die Rolle der Frauen in der Gesellschaft
- Die „sanften Waffen“ der Frauenbewegung
- Vermeidung der direkten Forderung nach Wahlrecht
Zielsetzung und Themenschwerpunkte (Objectives and Key Themes)
Die Arbeit analysiert die Gründe, warum sich die Frauenbewegung im 19. Jahrhundert in Deutschland nicht stärker für das Wahlrecht einsetzte. Sie untersucht die Herausforderungen, denen die Frauenbewegung in Bezug auf die gesellschaftlichen Normen und die männliche Dominanz begegnete.
- Die Rolle der Frauen in der Gesellschaft des 19. Jahrhunderts
- Der Kampf um die Emanzipation in verschiedenen Bereichen
- Der Einfluss von Bildung und gesellschaftlichen Erwartungen auf die politische Aktivität der Frauen
- Der Widerstand gegen die Frauenbewegung und ihre Forderungen
- Die Strategien der Frauenbewegung zur Durchsetzung ihrer Ziele
Zusammenfassung der Kapitel (Chapter Summaries)
- Der Text stellt die Frage, warum die Frauenbewegung im 19. Jahrhundert in Deutschland nicht stärker für ihr Wahlrecht eintrat, obwohl ihnen dieses große Vorteile beim Vertreten ihrer Meinung bietet. Er erklärt, dass es für Frauen in dieser Zeit selbstverständlich erschien, dass sie nicht wählen durften, da sie in vielen Bereichen nicht die gleichen Möglichkeiten wie Männer hatten. Ein neues Selbstbild der Frau, das Gleichberechtigung als selbstverständlich verstand, setzte erst im 19. Jahrhundert ein.
- Der Text beschreibt die vier Bereiche, in denen die Frauen um ihre Emanzipation kämpften: Bildung, Erwerbsleben, Ehe und Familie sowie das öffentliche Leben. Er erklärt, dass das Frauenwahlrecht von der Frauenbewegung als die „Grundbedingung allen Frauenfortschritts“ angesehen wurde. Der Text beleuchtet auch die Meinungsverschiedenheiten über die Vorgehensweise und das Tempo, mit dem das Frauenwahlrecht erreicht werden sollte.
- Der Text argumentiert, dass die Frauenbewegung zunächst ihr Recht auf Bildung als Qualifikation für ein Berufsleben einforderte, da sie als ungebildet galten und deshalb nicht für ein Wahlrecht kämpfen konnten. Er führt ein Zitat von Oskar Poensgen an, der 1909 schrieb, dass Frauen durch ihre geringere Schulbildung nicht so wie Männer dazu befähigt seien, politische Rechte auszuüben.
- Der Text erklärt, dass die Frauen im Berufsleben keine große Rolle spielten, da die Männerwelt die Verantwortung für den Fortschritt der Gesellschaft übernahm. Obwohl viele Frauen in der Industrialisierung arbeiteten, war ihnen der Zugang zu anderen Berufen als Lehrerin verwehrt. Der „Allgemeine Deutsche Frauenverein“ wurde 1865 gegründet, was den Beginn der organisierten Frauenbewegung in Deutschland markierte.
- Der Text beschreibt den Widerstand, dem die Frauenbewegung begegnete. Er führt ein Zitat von H. Jakobs an, der die traditionelle Rollenverteilung von Mann und Frau rechtfertigte. Der Text zeigt, dass Frauen in dieser Zeit nicht einmal die Fähigkeit zugeschrieben wurde, einem Beruf nachzugehen, geschweige denn, politische Entscheidungen zu fällen.
- Der Text stellt verschiedene Meinungen innerhalb der Frauenbewegung dar. Einige argumentierten, dass man nur durch die schnelle Einführung des Frauenstimmrechts die Voraussetzung für eine Gleichberechtigung schaffen könne. Andere hingegen bevorzugten einen schrittweisen Ansatz, bei dem Frauen sich durch soziale Tätigkeiten in Vereinen „erst tüchtig machen“ sollten.
- Der Text zeigt, dass die Frauenbewegung auch mit rechtlichen Einschränkungen zu kämpfen hatte. Politische Tätigkeiten waren ihnen verboten. Die Frauenbewegung war gezwungen, „sanfte Waffen“ einzusetzen und durch Pflichterfüllung zu zeigen, dass sie bereit waren, mehr Pflichten und Rechte zu übernehmen. Die direkte Forderung nach einem Frauenwahlrecht wurde dabei oft vermieden oder sogar verneint.
Schlüsselwörter (Keywords)
Frauenbewegung, Frauenwahlrecht, Emanzipation, Bildung, Erwerbsleben, Ehe und Familie, öffentliches Leben, Widerstand, gesellschaftliche Normen, traditionelle Rollenverteilung, politische Partizipation, „sanfte Waffen“, Pflichterfüllung.
Häufig gestellte Fragen
Warum forderten deutsche Frauen im 19. Jahrhundert das Wahlrecht nicht offensiver?
Frauen waren gesetzlich von politischer Betätigung ausgeschlossen und viele sahen Bildung und wirtschaftliche Unabhängigkeit als dringlichere Voraussetzungen für die Emanzipation an.
Welche Rolle spielte die Bildung in der Frauenstimmrechtsdebatte?
Gegner argumentierten, Frauen seien aufgrund geringerer Schulbildung politisch nicht urteilsfähig. Die Frauenbewegung konzentrierte sich daher zunächst auf den Zugang zu höherer Bildung und Berufen.
Was war der „Allgemeine Deutsche Frauenverein“?
Der 1865 gegründete Verein markiert den Beginn der organisierten Frauenbewegung in Deutschland und setzte sich primär für das Recht auf Bildung und Erwerbsarbeit ein.
Was sind die „sanften Waffen“ der Frauenbewegung?
Da direkte politische Forderungen oft verboten waren, versuchten Frauen durch soziale Arbeit und Pflichterfüllung in Vereinen zu beweisen, dass sie bereit für mehr Rechte sind.
Gab es innerhalb der Frauenbewegung Uneinigkeit zum Wahlrecht?
Ja, es gab radikale Flügel, die das sofortige Wahlrecht als Grundbedingung sahen, und gemäßigte Flügel, die einen schrittweisen Weg über soziale Qualifizierung bevorzugten.
- Quote paper
- Antonia Wilmes (Author), 2011, Warum setzte sich die Frauenbewegung in Deutschland nicht stärker für ihr Wahlrecht ein?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/174001