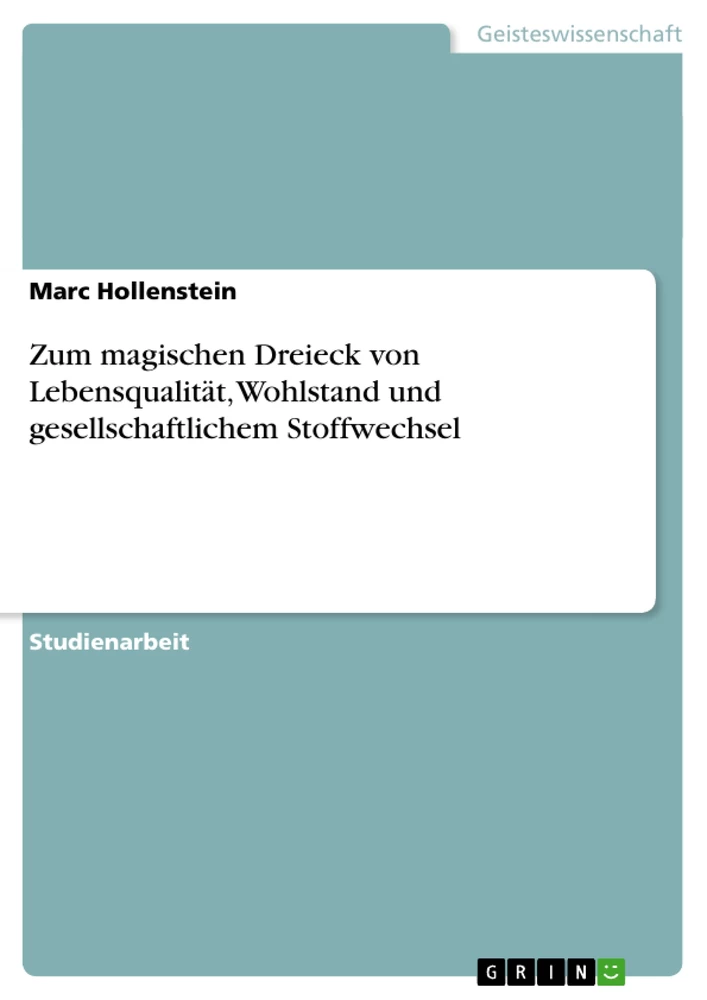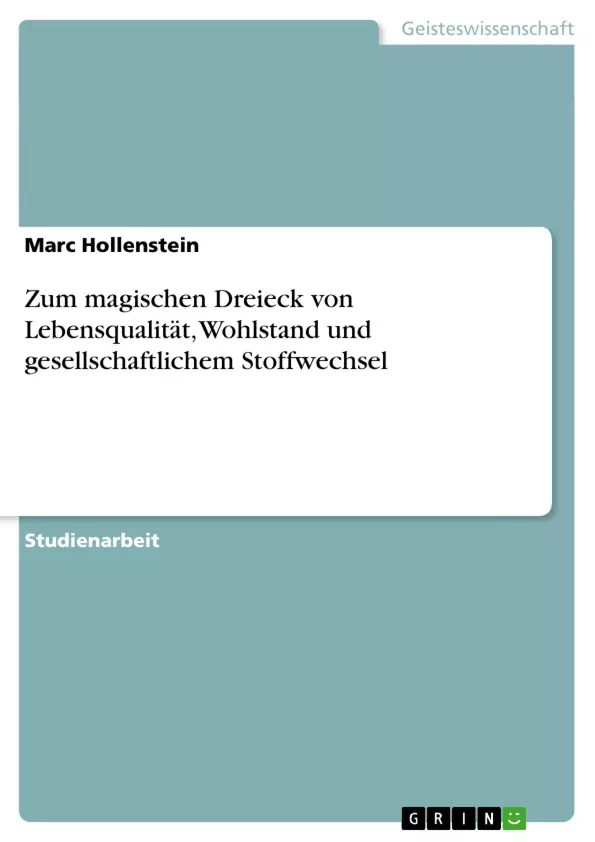Die Menschheit steht vor einer neuen Stufe der Naturbeherrschung. Der ursprünglich scharfe Unterschied zwischen der Welt des Gemachten und der Welt des Geborenen beginnt zu verschwimmen. Maschine als Leben, Leben als Maschine - lösen sich die Grenzen zwischen Artefakt und Natur auf? Immer tiefer greifen Gesellschaften in Lebensprozesse ein, um sich natürliche Systeme nutzbar zu machen. Das Maß der Technologisierung menschlicher Lebensweisen scheint keine Grenzen zu kennen.
Österreich ist eines der Länder, das Beiträge zum materiellen Stoffwechsel leistet. Gesellschaften entnehmen der Natur Rohstoffe, verarbeiten sie zu Nahrung und anderen Produkten und schließlich zu Abfällen und Emissionen. Analog zum Stoffwechsel eines Organismus werden diese materiellen und energetischen Austauschbeziehungen zwischen Gesellschaften und Natur gesellschaftlicher Metabolismus genannt.
Im Hinblick auf die Umweltfolgen gesellschaftlichen Handelns stellen sich folgende zentrale Fragen: Können die Beziehungen von Gesellschaften mit der Natur als reine Input-Output-Prozesse von Materialien unterschiedlicher Qualität und Menge ausreichend beschrieben werden? Welche Strategien entwickeln Gesellschaften um ihre vielfältigen Austauschbeziehungen mit der Natur zu organisieren? Wie kann die ökologische Dimension von Eingriffen in natürliche Systeme erfasst werden, wie sie landwirtschaftliche Aktivitäten oder die moderne Gentechnologie darstellen?
Gesellschaften greifen gezielt in Natursysteme ein und transformieren sie dabei in einer Weise, dass sie für Gesellschaften nützlicher sind als ohne diesen Eingriff. Diese Art der Umweltbeziehung wird Kolonisierung von Natur genannt. Kolonisierende Eingriffe können mit materiellem und energetischem Aufwand verbunden sein, setzen in natürlichen Systemen für bestimmte Parameter die ökosystemaren Selbstregulierungskräfte außer Kraft und ersetzen sie durch gezielte menschliche Planung. Aus natürlichen Systemen entstehen gesellschaftliche Kolonien. Wenn von Kolonisierung der Natur gesprochen ist dreierlei wichtig:
1. dass es um gesellschaftliches Handeln geht, das darauf abzielt, bestimmte Parameter eines natürlichen Systems zu manipulieren (und nicht bloß um Nachwirkungen oder Nebenfolgen von Handeln),
2. dass dieses Handeln eine gewisse Beständigkeit hat, dass heißt im Sinne eines negativen Feedbacks auf Veränderung des natürlichen Systems reagiert, und
3. dass es im Sinn von Kausalität eine gewisse Wirksamkeit hat.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Das magische Dreieck
- Zur Entkoppelung
- Effizienzkritik
- Konsumkritik
- Wohlfahrtskritik
- Überlegungen zu möglichen integrierten umwelt-, sozial- und wirtschaftspolitischen Maßnahmen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit dem komplexen Verhältnis zwischen Lebensqualität, Wohlstand und gesellschaftlichem Stoffwechsel. Sie untersucht die dynamischen Wechselwirkungen zwischen diesen drei Größen und analysiert, wie diese Beziehungen zur Nachhaltigkeit und zum Schutz der natürlichen Umwelt beitragen können.
- Das magische Dreieck: Die Arbeit stellt ein systemisches Modell vor, das die Beziehungen zwischen Lebensqualität, Wohlstand und Stoffwechsel beschreibt.
- Entkopplung: Sie erörtert verschiedene Ansätze zur Entkopplung von Wohlstand und Stoffwechsel, um die Nachhaltigkeit zu fördern.
- Effizienz- und Konsumkritik: Die Arbeit analysiert die Rolle von Effizienzsteigerungen und Konsumveränderungen für die Reduzierung des Stoffwechsels.
- Kolonisierung von Natur: Sie beleuchtet den Einfluss des gesellschaftlichen Handelns auf natürliche Systeme und die daraus resultierende ökologische Belastung.
- Ökologische Dimension von Eingriffen: Die Arbeit untersucht, wie die ökologische Dimension von Eingriffen in natürliche Systeme erfasst werden kann.
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema ein und erläutert die zentrale Fragestellung: Wie können die Beziehungen zwischen Gesellschaften und der Natur nachhaltig gestaltet werden? Sie stellt das Konzept des gesellschaftlichen Stoffwechsels und die Idee der Kolonisierung von Natur vor.
Das Kapitel "Das magische Dreieck" präsentiert ein systemisches Modell, das die Wechselwirkungen zwischen Lebensqualität, Wohlstand und Stoffwechsel darstellt. Es werden die Rückkoppelungen zwischen gesellschaftlicher Dynamik und natürlicher Umwelt sowie die dynamischen Beziehungen zwischen den drei Größen beleuchtet.
Der Abschnitt "Zur Entkoppelung" widmet sich der Frage, wie man wirtschaftliches Wachstum garantieren, den Stoffwechsel reduzieren und gleichzeitig die Lebensqualität erhalten kann. Es werden drei Ansätze zur Entkopplung von Wohlstand, Lebensqualität und Stoffwechsel vorgestellt: Effizienzkritik, Konsumkritik und Wohlfahrtskritik.
Schlüsselwörter
Die Arbeit behandelt zentrale Themen wie gesellschaftlicher Stoffwechsel, Kolonisierung von Natur, Lebensqualität, Wohlstand, Entkopplung, Effizienz, Konsum, Nachhaltigkeit und Umweltpolitik. Sie fokussiert auf die Analyse der Beziehungen zwischen diesen Konzepten und die Herausforderungen, die sich aus der komplexen Interaktion von Wirtschaft, Gesellschaft und Umwelt ergeben.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der gesellschaftliche Stoffwechsel (Metabolismus)?
Dies bezeichnet die materiellen und energetischen Austauschbeziehungen zwischen Gesellschaft und Natur, bei denen Rohstoffe entnommen, verarbeitet und als Abfälle oder Emissionen zurückgegeben werden.
Was versteht man unter der „Kolonisierung der Natur“?
Es handelt sich um gezielte gesellschaftliche Eingriffe in natürliche Systeme (z.B. Landwirtschaft oder Gentechnik), um diese für menschliche Zwecke nützlicher zu machen und Selbstregulierungskräfte durch Planung zu ersetzen.
Was ist das „magische Dreieck“ in dieser Arbeit?
Das magische Dreieck beschreibt das systemische Wechselverhältnis zwischen Lebensqualität, Wohlstand und dem gesellschaftlichen Stoffwechsel.
Wie kann Wohlstand vom Stoffwechsel entkoppelt werden?
Dazu werden Ansätze wie Effizienzkritik (bessere Ressourcennutzung), Konsumkritik (Veränderung des Lebensstils) und Wohlfahrtskritik (Neudefinition von Wohlstand) diskutiert.
Welche Rolle spielt die Technologisierung für die Umwelt?
Die zunehmende Technologisierung lässt die Grenzen zwischen Natürlichem und Künstlichem verschwimmen und erhöht die Intensität der Eingriffe in Lebensprozesse.
- Citar trabajo
- Mag. Marc Hollenstein (Autor), 2001, Zum magischen Dreieck von Lebensqualität, Wohlstand und gesellschaftlichem Stoffwechsel, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/17401