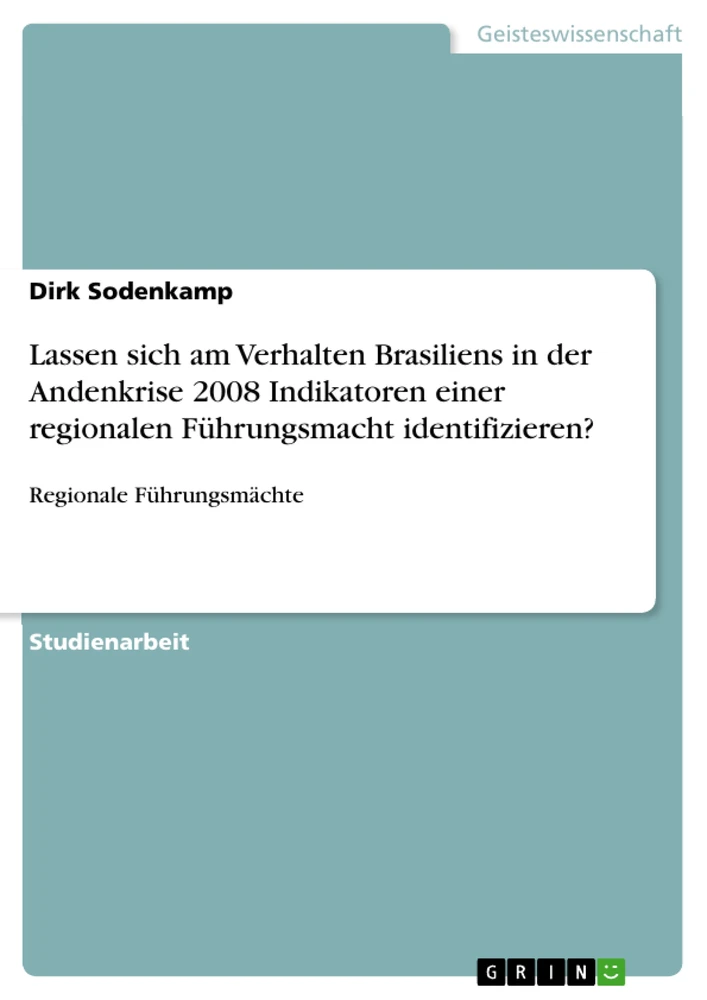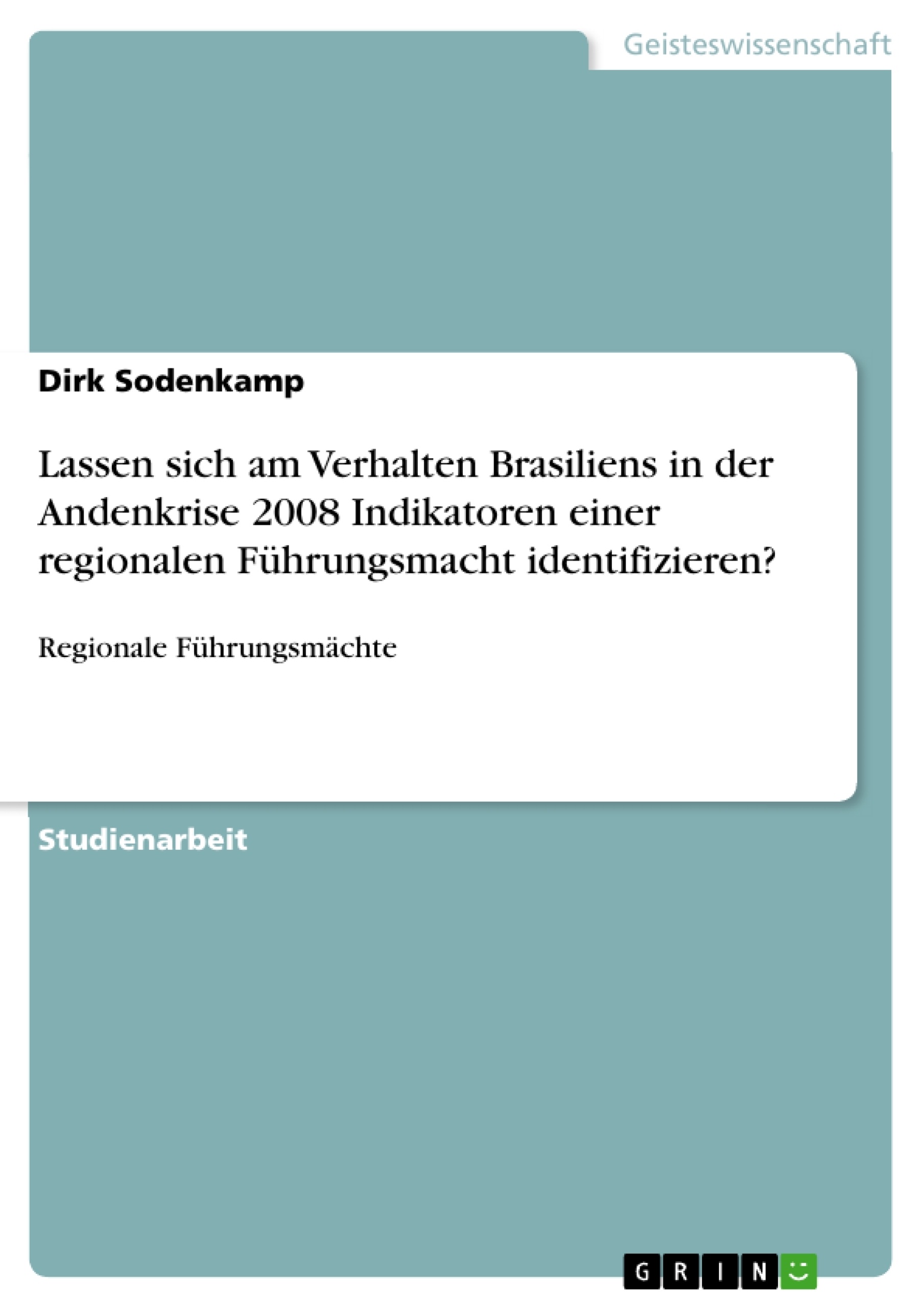Brasilien wird auf internationalem Parkett als die Führungsmacht Südamerikas angesehen . Diese Sicht wird durch die geographische Größe des Landes mit 8,5 Millionen qkm, der hohen Bevölkerungszahl im Verhältnis zu anderen südamerikanischen Staaten von knapp 200 Millionen Einwohnern (prognostiziert 210 Millionen in 2015) und der in den letzten Jahren stark gewachsenen wirtschaftlichen Potenz des Landes - besonders die wachsende Bedeutung von Rohstoffen und Agrarprodukten sind dafür verantwortlich - begründet.
Diese Arbeit ist mit der Leitfrage „Lassen sich am Verhalten Brasiliens in der Andenkrise 2008 Indikatoren einer regionalen Führungsmacht identifizieren?“ überschrieben und soll im Weiteren Untersuchungsgegenstand werden. Die Andenkrise von 2008 bildet das Zentrum dieser Fallstudie. Sie eignet sich als Fallstudie hervorragend, da Brasilien in ihr keine direkt beteiligte Partei war. Daher lässt sich die Frage „Ist Brasiliens Außen- und Regionalpolitik Kennzeichen und Ausdruck für eine regionale Führungsmacht in Südamerika?“ ebenso wie die Leitfrage umso besser stellen.
Zunächst wird als Grundlage für die Prüfung dieses Falles die Neorealismus-Theorie vorgestellt, ebenso die Ereignisse, die als Andenkrise 2008 bezeichnet werden, sowie die diplomatischen Aktivitäten zur Beilegung der Krise. Mit Hilfe des von Professor Stefan A. Schirm entwickelten analytischen Konzepts mit Indikatoren und Variablen zur Identifizierung einer Führungsmacht wird das Verhalten Brasiliens in der Krisensituation vom März 2008 analysiert.
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- II. Hauptteil
- 1. Macht - Theorie des Neorealismus
- 2. Andenkrise 2008: Abfolge der Ereignisse
- 3. Analyse des brasilianischen Verhaltens in der Andenkrise
- III. Schlussteil / Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit untersucht, ob sich im Verhalten Brasiliens während der Andenkrise 2008 Indikatoren für eine regionale Führungsmacht identifizieren lassen. Die Arbeit analysiert Brasiliens Rolle in der Krise, wobei es sich um einen besonders geeigneten Fall handelt, da Brasilien nicht direkt an der Krise beteiligt war. Die Analyse ermöglicht somit eine differenzierte Betrachtung von Brasiliens Außen- und Regionalpolitik.
- Der Neorealismus als theoretisches Rahmenmodell
- Die Abfolge der Ereignisse während der Andenkrise 2008
- Analyse des brasilianischen Verhaltens in der Andenkrise
- Identifizierung von Indikatoren einer regionalen Führungsmacht
- Bewertung der These, dass Brasiliens Auftreten Ausdruck seiner regionalen Führungsrolle ist.
Zusammenfassung der Kapitel
I. Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema ein und stellt die zentrale Forschungsfrage nach der Identifizierung von Indikatoren einer regionalen Führungsmacht am Beispiel Brasiliens während der Andenkrise 2008. Sie begründet die Wahl Brasiliens als Fallstudie aufgrund seiner Position als vermeintliche Führungsmacht Südamerikas und seiner indirekten Beteiligung an der Krise. Die Einleitung skizziert den methodischen Aufbau der Arbeit, der den Neorealismus als theoretisches Fundament nutzt und ein analytisches Konzept zur Identifizierung von Führungsmachtindikatoren anwendet. Die These der Arbeit, wonach Brasiliens Handeln in der Krise seine regionale Führungsrolle widerspiegelt, wird vorgestellt.
II. Hauptteil - 1. Macht - Theorie des Neorealismus: Dieser Abschnitt präsentiert den Neorealismus als theoretisches Fundament der Analyse. Er beschreibt die Kernelemente der Theorie, insbesondere das Streben nach Macht im anarchischen internationalen System, die Betonung von Sicherheitsinteressen und die Rolle des "balance of power". Der Neorealismus wird als Erklärungsmodell für das Verhalten der Akteure in der Andenkrise eingeführt, wobei die Vereinfachung der Staaten als "black boxes" und die Fokussierung auf Sicherheitsaspekte hervorgehoben werden. Die Anwendung dieser Theorie auf die Andenkrise wird als Grundlage für die spätere Analyse des brasilianischen Verhaltens dargestellt.
II. Hauptteil - 2. Andenkrise 2008: Abfolge der Ereignisse: Dieser Teil beschreibt die wichtigsten Ereignisse der Andenkrise 2008. Er skizziert die militärischen und diplomatischen Auseinandersetzungen, die zu der Krise führten, und beleuchtet die beteiligten Akteure und deren Motivationen. Die Beschreibung der Andenkrise dient als Kontext für die anschließende Analyse des brasilianischen Verhaltens. Dieser Abschnitt liefert das notwendige Hintergrundwissen, um die Rolle Brasiliens in diesem Konflikt zu verstehen.
II. Hauptteil - 3. Analyse des brasilianischen Verhaltens in der Andenkrise: Dieser Abschnitt bildet den Kern der Arbeit und analysiert das konkrete Verhalten Brasiliens während der Andenkrise 2008. Er verwendet das zuvor eingeführte analytische Konzept, um Indikatoren für eine regionale Führungsmacht zu identifizieren und zu bewerten. Die Analyse untersucht Brasiliens diplomatische Aktivitäten, seine Reaktionen auf die Krise und seine Interaktionen mit anderen beteiligten Staaten. Dieser Teil prüft die These der Arbeit, indem er das brasilianische Verhalten im Lichte des Neorealismus und der Indikatoren für regionale Führungsmacht bewertet. Die gewonnenen Erkenntnisse werden dazu verwendet, die Rolle Brasiliens im Kontext der Andenkrise umfassend zu beleuchten und die aufgestellte These zu überprüfen.
Schlüsselwörter
Andenkrise 2008, Brasilien, regionale Führungsmacht, Neorealismus, Sicherheitspolitik, Außenpolitik, Südamerika, Macht, Balance of Power, Fallstudie.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Seminararbeit: Brasilien und die Andenkrise 2008
Was ist das Thema der Seminararbeit?
Die Seminararbeit untersucht, ob sich im Verhalten Brasiliens während der Andenkrise 2008 Indikatoren für eine regionale Führungsmacht identifizieren lassen. Sie analysiert Brasiliens Rolle in der Krise, wobei die indirekte Beteiligung Brasiliens als besonders geeigneter Fall für eine differenzierte Betrachtung der brasilianischen Außen- und Regionalpolitik dient.
Welche Methodik wird angewendet?
Die Arbeit verwendet den Neorealismus als theoretisches Rahmenmodell. Sie analysiert die Abfolge der Ereignisse während der Andenkrise 2008 und untersucht das brasilianische Verhalten anhand eines analytischen Konzepts zur Identifizierung von Indikatoren für regionale Führungsmacht. Die These der Arbeit ist, dass Brasiliens Auftreten in der Krise seine regionale Führungsrolle widerspiegelt.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, einen Hauptteil mit drei Unterkapiteln (Macht - Theorie des Neorealismus; Andenkrise 2008: Abfolge der Ereignisse; Analyse des brasilianischen Verhaltens in der Andenkrise) und einen Schlussteil/Fazit.
Was wird im Kapitel "Macht - Theorie des Neorealismus" behandelt?
Dieses Kapitel präsentiert den Neorealismus als theoretisches Fundament. Es beschreibt die Kernelemente der Theorie, wie das Streben nach Macht, die Betonung von Sicherheitsinteressen und die Rolle der "balance of power". Die Anwendung dieser Theorie auf die Andenkrise wird als Grundlage für die Analyse des brasilianischen Verhaltens dargestellt.
Was wird im Kapitel "Andenkrise 2008: Abfolge der Ereignisse" behandelt?
Dieser Abschnitt beschreibt die wichtigsten Ereignisse der Andenkrise 2008, die militärischen und diplomatischen Auseinandersetzungen, die beteiligten Akteure und deren Motivationen. Es liefert den Kontext für die Analyse des brasilianischen Verhaltens.
Was wird im Kapitel "Analyse des brasilianischen Verhaltens in der Andenkrise" behandelt?
Dieser zentrale Abschnitt analysiert das konkrete Verhalten Brasiliens während der Krise. Er identifiziert und bewertet Indikatoren für eine regionale Führungsmacht anhand des analytischen Konzepts und prüft die These der Arbeit, indem das brasilianische Verhalten im Lichte des Neorealismus und der Indikatoren für regionale Führungsmacht bewertet wird.
Welche Schlüsselwörter sind relevant?
Relevante Schlüsselwörter sind: Andenkrise 2008, Brasilien, regionale Führungsmacht, Neorealismus, Sicherheitspolitik, Außenpolitik, Südamerika, Macht, Balance of Power, Fallstudie.
Welche zentrale Forschungsfrage wird gestellt?
Die zentrale Forschungsfrage lautet: Lassen sich im Verhalten Brasiliens während der Andenkrise 2008 Indikatoren für eine regionale Führungsmacht identifizieren?
Was ist die These der Arbeit?
Die These der Arbeit besagt, dass Brasiliens Handeln in der Andenkrise seine regionale Führungsrolle widerspiegelt.
Warum wurde Brasilien als Fallstudie ausgewählt?
Brasilien wurde aufgrund seiner Position als vermeintliche Führungsmacht Südamerikas und seiner indirekten Beteiligung an der Krise als besonders geeignete Fallstudie ausgewählt. Dies ermöglicht eine differenzierte Betrachtung seiner Außen- und Regionalpolitik.
- Quote paper
- Dirk Sodenkamp (Author), 2011, Lassen sich am Verhalten Brasiliens in der Andenkrise 2008 Indikatoren einer regionalen Führungsmacht identifizieren?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/174047