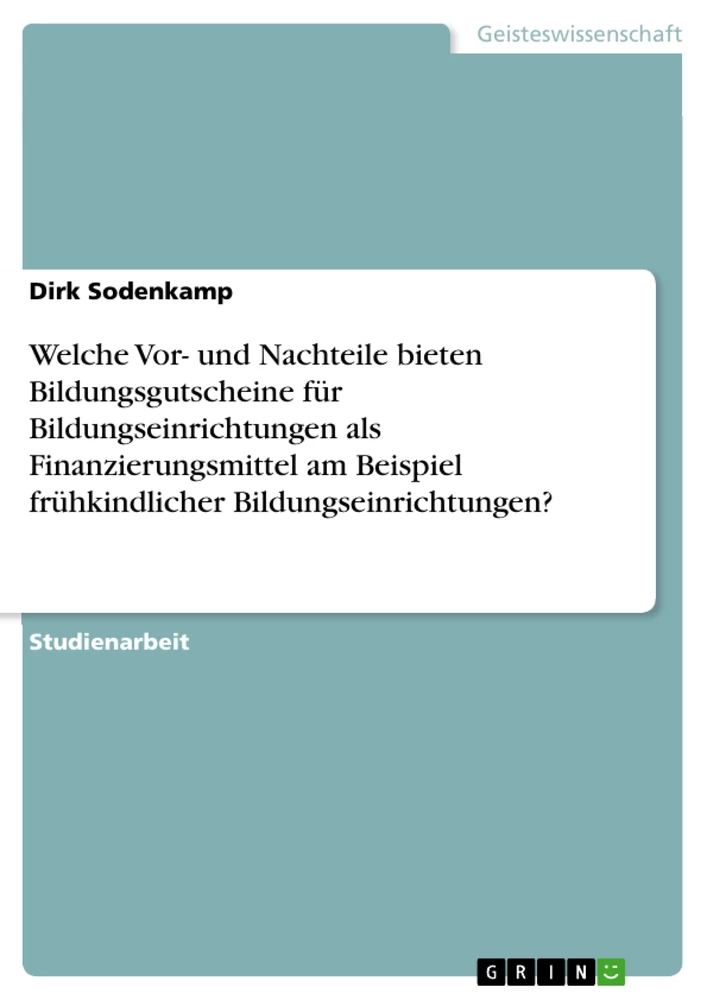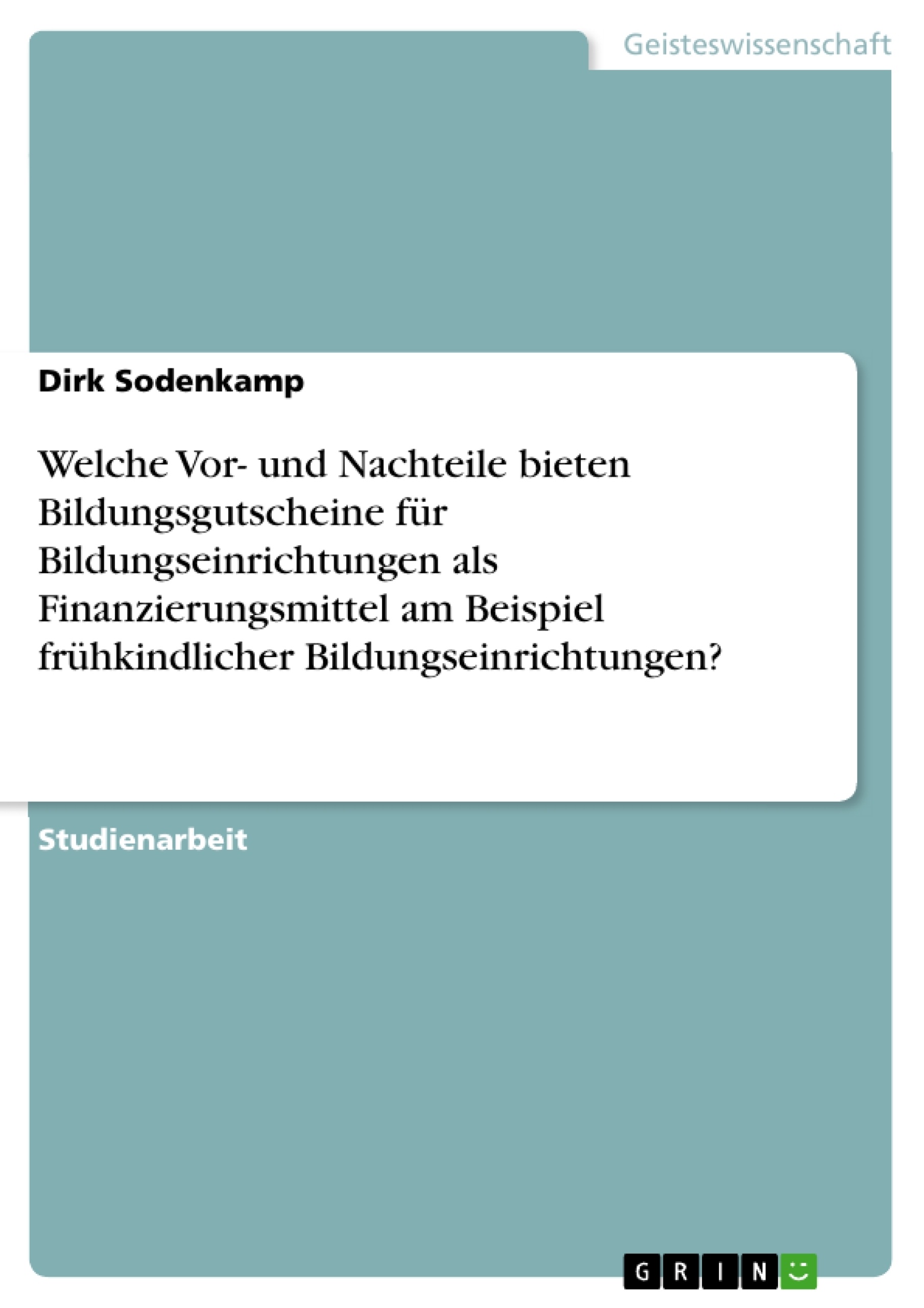Kindertageseinrichtungen werden bereits seit dem Beginn des 20. Jahrhun-derts institutionell organisiert und finanziert . Sie entstanden überwiegend, um dem „moralischen Verfall“ der ansonsten unbeaufsichtigten Arbeiterkinder entgegenzuwirken. Durch die Bildungsreformen der 1960er Jahre bekam die Finanzierung von Kinderbetreuungseinrichtungen einen neuen Schub in Westdeutschland. Der Kindergarten konnte sich als Regelinstitution etablieren .
In der DDR war eine Grundposition der sozialistischen Politik die Erwerbsfähigkeit der Frau zu fördern. Aufgrund dessen und dem Ziel der frühzeitigen ideologischen Unterweisung des Nachwuchses wurde eine flächendeckende und ganztägige Betreuung von Kindern aller Altersklassen in der Deutschen Demokratischen Republik geschaffen und etabliert.
Aufgrund dieser unterschiedlichen Entwicklungen beider deutscher Staaten im Primärbereich der Kinderbetreuung lassen sich bis heute große Unterschiede in den Bereichen Ganztagsbetreuung, Versorgung mit Hort- und Krippenplätzen und der Wortortnähe feststellen.
Die Kinderbetreuung wird im wiedervereinigten Deutschland vor dem Hintergrund der PISA-Studien und deren zum Teil unbefriedigenden Ergebnissen unter dem Qualitätsaspekt intensiv diskutiert. Gleichrangig wird die Thematik der Vereinbarkeit von Familie und Beruf in einem dauerhaften öffentlichen Diskurs erörtert.
Beide Diskussionsstränge finden sich auch in der vorliegenden Seminararbeit wieder, die sich mit einer Variante der Steuerung des Kinderbetreuungssystems auseinandersetzt und diese beleuchtet: dem Bildungsgutscheinmodell.
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- II. Hauptteil
- 1) Historie und Konzept des Bildungsgutscheinmodells
- 2) Ausgestaltungsmerkmale für ein erfolgreiches Gutscheinmodell in verschiedenen Bildungssektoren
- 3) Gutscheinmodelle in kleinkindlichen Betreuungs- und Bildungseinrichtungen
- 4) Das Hamburger „Kita-Gutscheinsystem“ als Beispiel
- III. Schlussteil / Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit untersucht Vor- und Nachteile von Bildungsgutscheinen als Finanzierungsmittel für Bildungseinrichtungen, insbesondere im Bereich der frühkindlichen Bildung. Die Arbeit analysiert das Gutscheinmodell im Kontext der aktuellen Diskussion um die Vereinbarkeit von Familie und Beruf und die Qualität der Kinderbetreuung.
- Historische Entwicklung und Konzept des Bildungsgutscheinmodells
- Ausgestaltungsmerkmale erfolgreicher Gutscheinmodelle
- Anwendbarkeit von Gutscheinmodellen in der frühkindlichen Bildung
- Analyse des Hamburger Kita-Gutscheinsystems
- Bewertung der Vor- und Nachteile von Bildungsgutscheinen
Zusammenfassung der Kapitel
I. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der Finanzierung von Kindertageseinrichtungen ein und stellt den historischen Kontext dar, beginnend mit den Anfängen im 20. Jahrhundert bis hin zu den aktuellen Diskussionen im Kontext der PISA-Studien und der Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Die Arbeit fokussiert sich auf das Bildungsgutscheinmodell als eine Möglichkeit zur Steuerung des Kinderbetreuungssystems.
II. Hauptteil 1) Historie und Konzept des Bildungsgutscheinmodells: Dieser Abschnitt beleuchtet die Ursprünge des Gutscheinmodells, beginnend mit den Ideen von Thomas Paine und John Stuart Mill und der Weiterentwicklung durch Milton Friedman. Er beschreibt das Gutscheinmodell als eine Form der Subjektförderung, bei der Eltern einen Gutschein vom Staat erhalten, den sie bei einem Anbieter ihrer Wahl einlösen können. Die drei Hauptziele – sozialpolitische Ziele, Steigerung der Produktionseffizienz und Stärkung der Wahlfreiheit der Konsumenten – werden erläutert.
II. Hauptteil 2) Ausgestaltungsmerkmale für ein erfolgreiches Gutscheinmodell in verschiedenen Bildungssektoren: Dieser Teil der Arbeit analysiert die entscheidenden Faktoren für die Wirksamkeit von Gutscheinmodellen. Er betont, dass die Effektivität stark von der individuellen Ausgestaltung abhängt und dass die Kombinationsmöglichkeiten der Ausgestaltungsmerkmale sowohl Flexibilität als auch Komplexität mit sich bringen. Die Herausforderung besteht darin, die optimalen Ausgestaltungsmerkmale für den jeweiligen Bildungssektor zu finden.
II. Hauptteil 3) Gutscheinmodelle in kleinkindlichen Betreuungs- und Bildungseinrichtungen: Dieser Abschnitt untersucht die Anwendung von Gutscheinmodellen im Kontext der frühkindlichen Bildung. Er beleuchtet die Möglichkeiten, Chancen, Probleme und Risiken eines solchen Systems im Detail. Es wird diskutiert, wie ein Gutscheinmodell die Qualität der Betreuung und Bildung beeinflussen kann und welche Herausforderungen sich für die Einrichtung stellen.
II. Hauptteil 4) Das Hamburger „Kita-Gutscheinsystem“ als Beispiel: Hier wird das 2003 eingeführte Hamburger Kita-Gutscheinsystem als konkretes Beispiel für ein Bildungsgutscheinmodell detailliert vorgestellt und analysiert. Die Beschreibung umfasst die Struktur, die Funktionsweise und die Erfahrungen mit dem System in Hamburg. Die Diskussion der Vor- und Nachteile dieses spezifischen Modells liefert wertvolle Erkenntnisse für die allgemeine Diskussion um Bildungsgutscheine.
Schlüsselwörter
Bildungsgutscheine, frühkindliche Bildung, Kinderbetreuung, Finanzierungsmodelle, Qualitätsaspekte, Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Marktmechanismen, Subjektförderung, Hamburger Kita-Gutscheinsystem.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Seminararbeit: Bildungsgutscheine in der frühkindlichen Bildung
Was ist der Inhalt dieser Seminararbeit?
Diese Seminararbeit untersucht die Vor- und Nachteile von Bildungsgutscheinen als Finanzierungsmittel für Bildungseinrichtungen, insbesondere in der frühkindlichen Bildung. Sie analysiert das Gutscheinmodell im Kontext der Vereinbarkeit von Familie und Beruf und der Qualität der Kinderbetreuung. Die Arbeit beinhaltet eine Einleitung, einen Hauptteil mit detaillierten Analysen des Gutscheinmodells, seiner Ausgestaltung und Anwendung in verschiedenen Sektoren, sowie eine Fallstudie zum Hamburger Kita-Gutscheinsystem und einen abschließenden Fazit.
Welche Themen werden in der Seminararbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt die historische Entwicklung und das Konzept von Bildungsgutscheinen, die Ausgestaltungsmerkmale erfolgreicher Gutscheinmodelle, die Anwendbarkeit in der frühkindlichen Bildung, eine detaillierte Analyse des Hamburger Kita-Gutscheinsystems, sowie eine umfassende Bewertung der Vor- und Nachteile von Bildungsgutscheinen. Die Arbeit betrachtet dabei sowohl sozialpolitische Ziele als auch ökonomische Aspekte wie die Steigerung der Produktionseffizienz und die Stärkung der Wahlfreiheit der Konsumenten.
Welche Kapitel umfasst die Seminararbeit?
Die Seminararbeit gliedert sich in drei Hauptteile: Eine Einleitung, einen Hauptteil mit vier Unterkapiteln (Historie und Konzept des Bildungsgutscheinmodells; Ausgestaltungsmerkmale erfolgreicher Gutscheinmodelle; Gutscheinmodelle in der frühkindlichen Bildung; Das Hamburger Kita-Gutscheinsystem als Beispiel) und einen Schlussteil mit Fazit. Jedes Kapitel behandelt einen spezifischen Aspekt des Themas Bildungsgutscheine und trägt zum Gesamtverständnis bei.
Wie wird das Hamburger Kita-Gutscheinsystem in der Arbeit behandelt?
Das Hamburger Kita-Gutscheinsystem wird als konkretes Beispiel eines Bildungsgutscheinmodells detailliert vorgestellt und analysiert. Die Beschreibung umfasst die Struktur, Funktionsweise und Erfahrungen mit dem System in Hamburg. Die Diskussion der Vor- und Nachteile dieses Modells liefert wichtige Erkenntnisse für die allgemeine Diskussion um Bildungsgutscheine.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Seminararbeit am besten?
Schlüsselwörter, die den Inhalt der Seminararbeit prägnant zusammenfassen, sind: Bildungsgutscheine, frühkindliche Bildung, Kinderbetreuung, Finanzierungsmodelle, Qualitätsaspekte, Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Marktmechanismen, Subjektförderung und Hamburger Kita-Gutscheinsystem.
Welche Ziele verfolgt die Seminararbeit?
Die Seminararbeit zielt darauf ab, die Vor- und Nachteile von Bildungsgutscheinen als Finanzierungsmodell für Bildungseinrichtungen, insbesondere im Bereich der frühkindlichen Bildung, umfassend zu untersuchen und zu bewerten. Sie soll ein fundiertes Verständnis des Gutscheinmodells vermitteln und dessen Anwendbarkeit und Auswirkungen auf die Qualität der Kinderbetreuung beleuchten.
Welche Quellen werden in der Seminararbeit verwendet? (Nicht explizit im HTML, aber relevant für FAQ-Konzept)
Die Seminararbeit bezieht sich vermutlich auf diverse wissenschaftliche Literatur, Studien zum Thema Bildungsgutscheine, Berichte zum Hamburger Kita-Gutscheinsystem und möglicherweise auch auf gesetzliche Grundlagen und politische Dokumente. Diese Quellen würden im Literaturverzeichnis der vollständigen Arbeit aufgeführt sein.
- Quote paper
- Dirk Sodenkamp (Author), 2011, Welche Vor- und Nachteile bieten Bildungsgutscheine für Bildungseinrichtungen als Finanzierungsmittel am Beispiel frühkindlicher Bildungseinrichtungen? , Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/174048