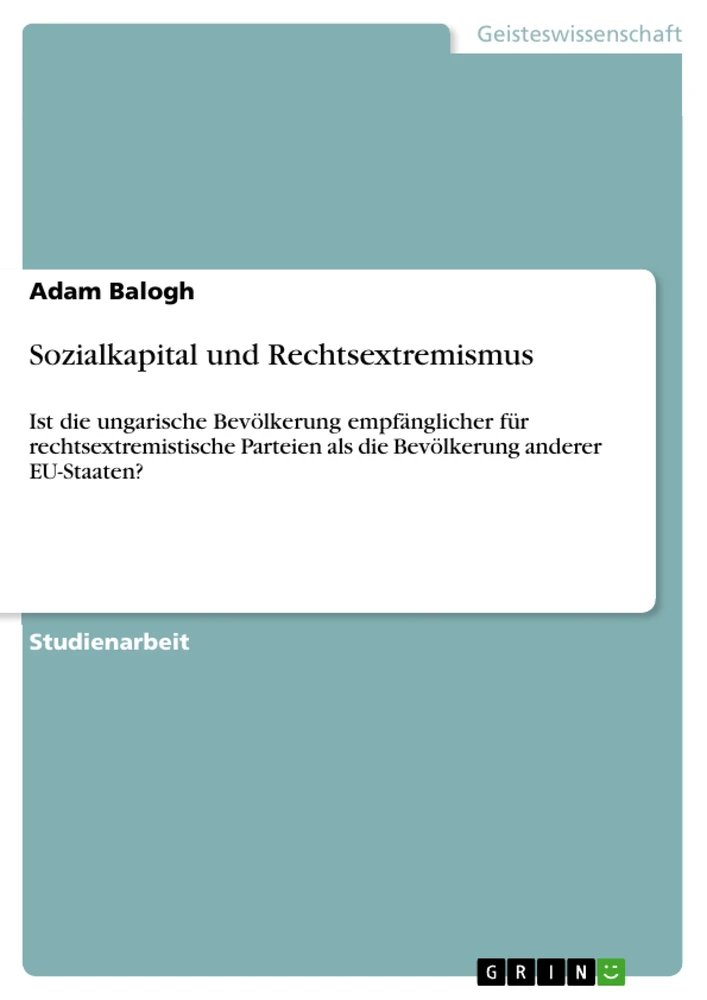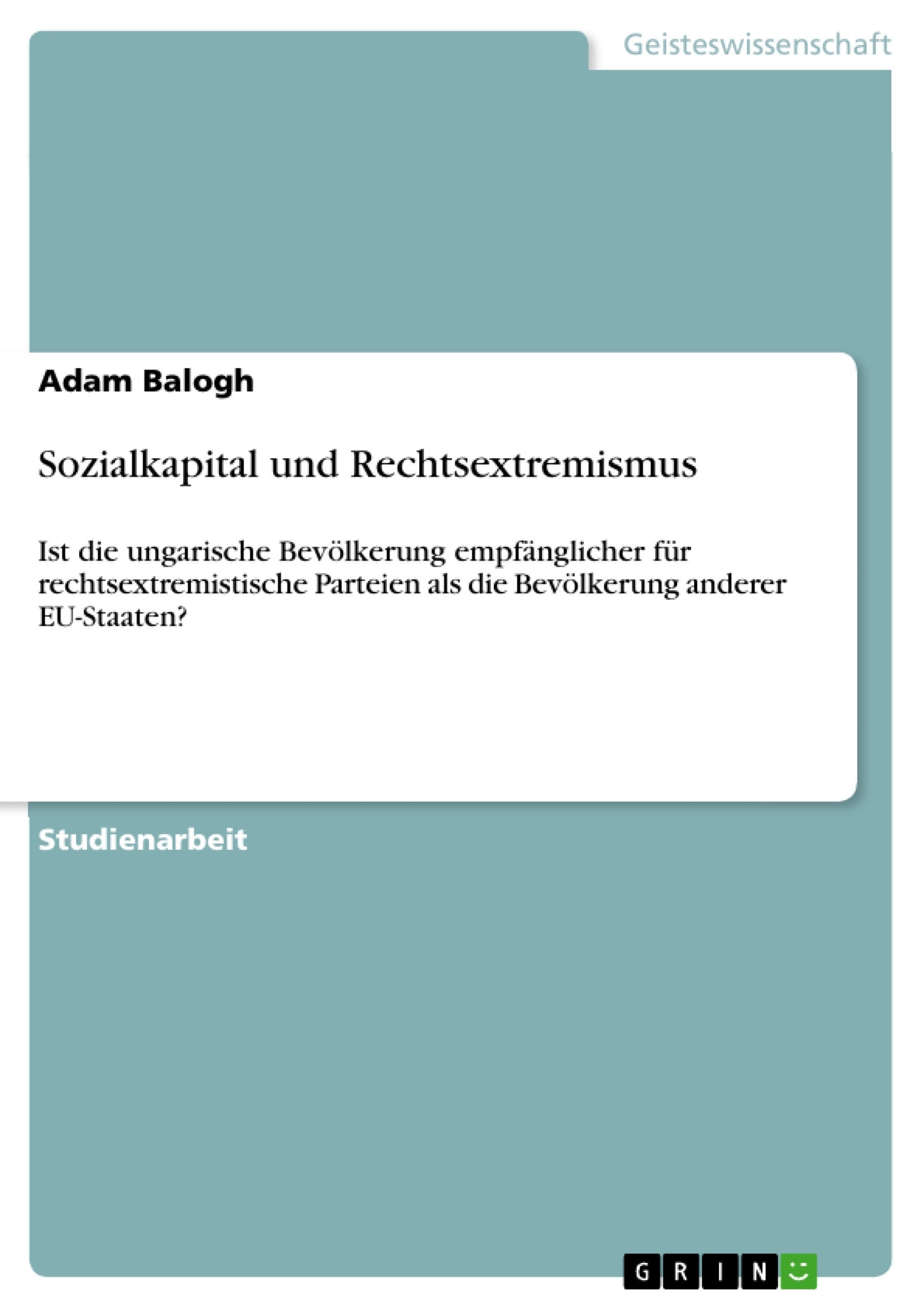Nach den sechsten Parlamentswahlen in Ungarn am 11. und 25. April 20101 erreichte die rechtsextreme Partei „Jobbik“ 12.2% der Sitze und zog somit als drittstärkste Fraktion in das ungarische Parlament ein. Das besondere an diesem Ereignis ist, dass die „Jobbik“ eine faschistisch-nationalsozialistische Ideologie vertritt und somit dem „harten“ Rechtsextremismus zuzuordnen ist. Im Gegensatz dazu steht die völkisch-nationalistische Ideologie „weicher“ Rechtsextremistischer Parteien, die bereits in vielen EU-Staaten erfolgreich sind.
Diese Konzentration von „harter“ rechtsextremer politischer Macht im Parlament eines der Mitgliedsstaaten der Europäischen Union ist einmalig. Besonders auffällig ist hierbei, dass Ungarn den Entwicklungen in westeuropäischen Staaten folgt, in denen schon länger „weiche“ rechtsextremistische Parteien in den Parlamenten vertreten und auch teilweise an der nationalen Regierung beteiligt sind. Angestoßen durch die Bedrohung, die diese Entwicklung für Freiheit, Demokratie und den Prozess der Europäischen Integration darstellt, wird in dieser Seminararbeit folgende Frage gestellt:
Ist die ungarische Bevölkerung empfänglicher für rechtsextremistische Parteien als die Bevölkerung anderer EU-Staaten?
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Sozialkapital und Rechtsextremismus
- Was ist Sozialkapital?
- Netzwerke
- Bonding und Bridging Sozialkapital
- Sozialkapital und Rechtsextremismus
- Überprüfung der Thesen
- Operationalisierung
- Analytischer Ländervergleich
- Zusammenfassung und Beantwortung der Forschungsfrage
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit untersucht die Frage, ob die ungarische Bevölkerung empfänglicher für rechtsextremistische Parteien ist als die Bevölkerung anderer EU-Staaten. Sie befasst sich mit dem Einfluss von Sozialkapital auf das Aufkommen von Rechtsextremismus, basierend auf der Theorie, dass die Art und Verteilung von Sozialkapital in einer Gesellschaft Auswirkungen auf deren Empfänglichkeit für rechtsextreme Ideologien haben kann.
- Das Konzept des Sozialkapitals und dessen Komponenten (Vertrauen, Netzwerke, Normen)
- Die Unterscheidung zwischen "Bonding" und "Bridging" Sozialkapital und deren Auswirkungen auf gesellschaftliche Grenzen
- Die These, dass eine hohe Konzentration von "Bonding" und ein geringes "Bridging" in einer Gesellschaft zu einer höheren Empfänglichkeit für rechtsextremistische Parteien führt
- Die Überprüfung dieser These durch einen analytischen Ländervergleich unter Verwendung von Daten des "Eurobarometer 223 social capital"
- Die Analyse der Beziehung zwischen der Verteilung von "Bonding" und "Bridging" und dem Erfolg rechtsextremer Parteien in verschiedenen EU-Staaten
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel der Seminararbeit befasst sich mit der Einleitung und stellt die Forschungsfrage: Ist die ungarische Bevölkerung empfänglicher für rechtsextremistische Parteien als die Bevölkerung anderer EU-Staaten? Es werden verschiedene Ansätze zur Erklärung von Rechtsextremismus vorgestellt, wobei der Schwerpunkt auf dem soziologischen Ansatz liegt, der das Sozialkapital als zentralen Faktor betrachtet.
Kapitel 2 analysiert das Konzept des Sozialkapitals und untersucht die Bedeutung von Netzwerken, "Bonding" und "Bridging". Es wird argumentiert, dass "Bonding" zur Errichtung und Verteidigung sozialer Grenzen beiträgt, während "Bridging" diese Grenzen überbrückt. Aus dieser Analyse wird die These abgeleitet, dass eine höhere Konzentration von "Bonding" in einer Gesellschaft zu einer größeren Empfänglichkeit für rechtsextremistische Parteien führen kann.
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselwörter dieser Seminararbeit sind: Sozialkapital, Rechtsextremismus, Bonding, Bridging, Netzwerke, Vertrauen, Normen, Eurobarometer 223 social capital, analytischer Ländervergleich, Ungarn, EU-Staaten.
Häufig gestellte Fragen
Was ist Sozialkapital?
Sozialkapital umfasst die Ressourcen, die aus sozialen Netzwerken, Vertrauen und gemeinsamen Normen innerhalb einer Gesellschaft entstehen.
Was ist der Unterschied zwischen "Bonding" und "Bridging" Sozialkapital?
"Bonding" stärkt den Zusammenhalt innerhalb einer homogenen Gruppe (Abgrenzung nach außen), während "Bridging" Verbindungen zwischen unterschiedlichen gesellschaftlichen Gruppen schafft (Integration).
Wie hängen Sozialkapital und Rechtsextremismus zusammen?
Die Arbeit stellt die These auf, dass eine hohe Konzentration von "Bonding" bei gleichzeitig geringem "Bridging" die Empfänglichkeit einer Bevölkerung für rechtsextreme Ideologien erhöhen kann.
Warum wird Ungarn in der Arbeit als Beispiel herangezogen?
Anlass war der Erfolg der rechtsextremen Partei „Jobbik“ im Jahr 2010. Die Arbeit untersucht, ob die ungarische Bevölkerung aufgrund ihrer Sozialkapital-Struktur empfänglicher für solche Parteien ist.
Welche Daten wurden für den Ländervergleich genutzt?
Die Untersuchung basiert auf Daten des „Eurobarometer 223 social capital“, um die Sozialkapital-Verteilung in verschiedenen EU-Staaten analytisch zu vergleichen.
- Quote paper
- Adam Balogh (Author), 2011, Sozialkapital und Rechtsextremismus, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/174049