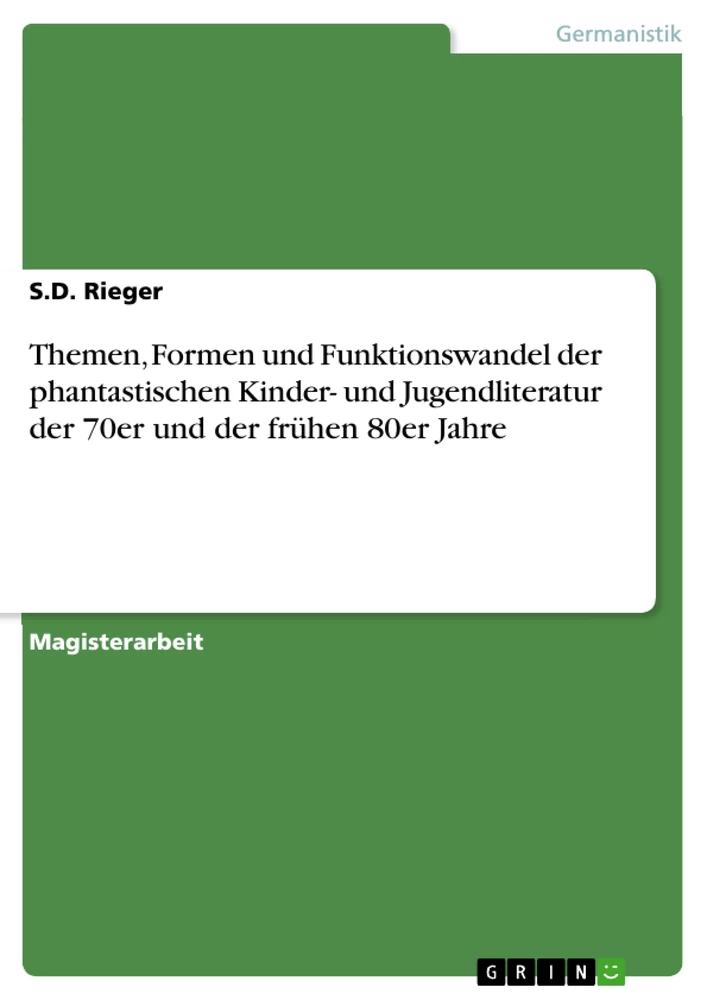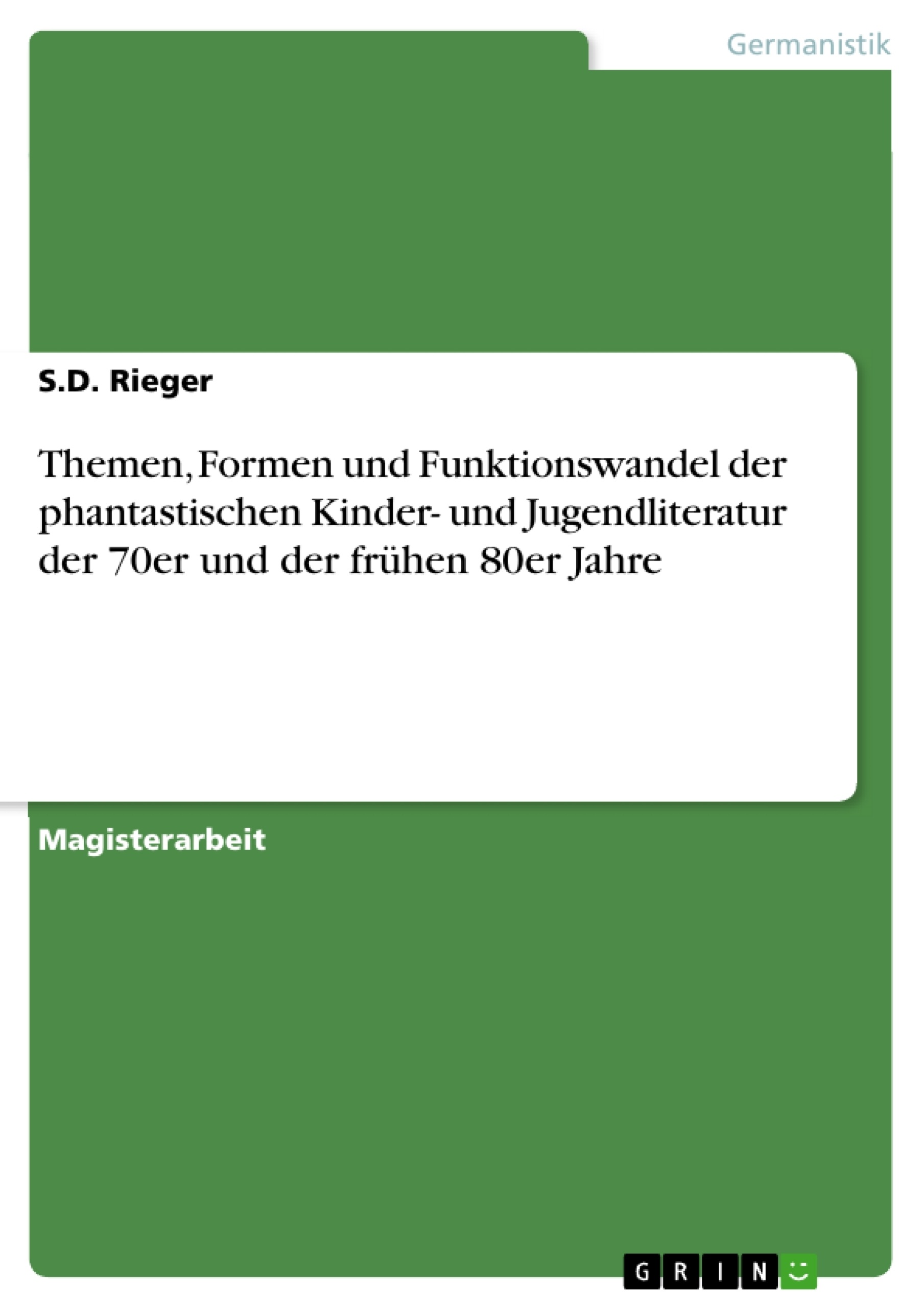Die 70er Jahre werde als das Jahrzehnt der Emanzipation, der Gleichberechtigung und der Ideologiekritik beschrieben. Kinder gelten den Erwachsenen als gleichgestellt, sie sollen die Probleme und Widersprüche der Realität, aber auch Mittel und Wege zu ihrer Bewältigung möglichst früh kennen lernen. Hans-Heino Ewers spricht hier von einer sich entwickelnden Literatur der kindlichen Gleichberechtigung. Der kulturelle Wandel der westdeutschen Gesellschaft führt auch zu einer tief greifenden Veränderung der phantastischen Kinder- und Jugendliteratur. Aus Märchen und Fabeldichtungen werden politische Parabeln, Phantastik wird dadurch politisiert. Auf viele andere phantastische Kinderbücher trifft die Bezeichnung der „sozialen“ oder „eingreifenden“ Phantasie zu. Erstmals ist die Rede von einem phantastischen Realismus, der aktuelle Probleme aufgreift und benennt. In dieser Phase erscheinen Romane wie „Momo“ und „Wir pfeifen auf den Gurkenkönig“, die Kämpfe des Individuums gegen ein System oder Obrigkeiten beschreiben. Diesen Wandel der Themen, Formen und Funktionen in der kinder- und jugendliterarischen Phantastik der 70er und frühen 80er Jahre in Westdeutschland zu untersuchen und nachzuweisen, soll Ziel der vorliegenden Magisterarbeit sein.
Zwar kam es auch in der DDR nach der kulturpolitischen Abwehr der Romantik im Laufe der 70er Jahre zum Durchbruch der Phantastik, doch würde eine Betrachtung der gesamtdeutschen phantastischen Kinder- und Jugendliteratur der 70er und 80er Jahre im Rahmen dieser Arbeit zu weit führen.
Deshalb sollen exemplarisch sechs phantastische Kinder- und Jugendbücher dieser beiden Jahrzehnte untersucht werden.
Inhaltsverzeichnis (Table of Contents)
- 1. Einleitung und Überblick
- 2. E.T.A. Hoffmann als Begründer der phantastischen Erzählung für Kinder- und Jugendliche
- 2.1. Volksmärchen und phantastische Erzählung: ein Vergleich
- 2.1.1. Volksmärchen
- 2.1.2. Phantastische Erzählung
- 3. Entwicklung der Phantastik in Europa seit der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts
- 4. Phantasie, Fiktionalität, Phantastisches, phantastische Literatur und Phantastik - eine Unterscheidung
- 5. Phantastik als Genremix?
- 6. Phantastikdiskussion in der Kinder- und Jugendliteraturforschung
- 6.1. Die frühe Forschung: Anna Krüger, Ruth Koch und Göte Klingberg
- 6.2. Die minimalistische Definition: Tzvetan Todorov
- 6.3. Die maximalistische Definition: Gerhard Haas
- 6.4. Die Forschung der 80er und 90er Jahre: Wolfgang Meißner und Gertrud Lehnert
- 7. Zwei-Welten-Theorie
- 8. Geschlossene, offene oder implizierte Welt: Modelle der phantastischen Literatur nach Maria Nikolajewa
- 9. Paradigmenwechsel in der Kinder- und Jugendliteratur der 70er Jahre
- 10. Phantastik in „realistischer“ Absicht
- 11. Kindheitsbilder seit der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts
- 11.1. Veränderte Kindheitsbilder und „soziale Phantastik“ als Folge der studentischen Kulturrevolution 1968
- 11.2. Familienbilder in der Kinder- und Jugendliteratur in den 70er und 80er Jahren
- 12. (Post-)Moderne in den 70er Jahren
- 12.1. Phantastische Kinderliteratur im Spannungsfeld zwischen Tradition und (Post-)Moderne
- 12.2. Intertextualität als Merkmal der postmodernen phantastischen Kinder- und Jugendliteratur nach 1970
- 12.3. Ich- und Du- Themen in der modernen Phantastik
- 13. Funktionen der Phantastik
- 14. Themen, Typen und Merkmale kinder- und jugendliterarischer Phantastik
- 14.1. Grenzüberschritt in andere Welten und in andere Zeiten
- 14.2. Phantastische Reise
- 14.3. Phantastische Reisen zu sich selbst
- 14.4. Anderswelten
- 14.5. Spiegel als phantastische Schwellen
- 14.6. Gäste aus dem Unbekannten
- 14.6.1. Das fremde Kind
- 14.7. Miniaturgesellschaften und lebendiges Spielzeug
- 14.8. Hexen, Zauberer und das Teufelsmotiv
- 14.9. Mythische Erzählung
- 14.9.1. Einbruch der mythischen Vergangenheit in die Gegenwart
- 14.9.2. Das mythische Gegenspiel von Gut und Böse
- 15. Die komisch-phantastische Kindererzählung
- 15.1. Die drei Typen der komisch-phantastischen Erzählung nach Reinbert Tabbert
- 16. Kindliche Wunschträume als Motive phantastischer Geschichten
- 17. Günther Herburgers „Birne kann alles“ (1971) als Beispiel einer sozialkritischen Phantastik
- 17.1. Phantastik im Zeichen der Sozialkritik
- 17.2. Ziele und phantastische Inhalte von „Birne kann alles“
- 17.3. Einfachheit als sprachliches Kennzeichen in „Birne kann alles“
- 17.4. Schreibthematisierung als postmodernes Element
- 18. Christine Nöstlingers „Wir pfeifen auf den Gurkenkönig“ (1972) als Beispiel eines phantastischen Realismus
- 18.1. Antiautoritäre Elemente und phantastischer Realismus
- 18.2. Der Gurkenkönig und sein Volk als phantastische Figuren mit Katalysatorfunktion
- 18.3. Der Erzähler als (sprachlicher) Vermittler und Inszenierender von Komik
- 18.4. Zwei-Welten-Theorie
- 19. Paul Maars „Eine Woche voller Samstage“ (1973) als Beispiel einer surreal-komischen Kinderliteratur
- 19.1. Die surreale Komik des Sams
- 19.2. Phantastische und psychologische Funktion des Sams
- 19.3. Sprache, Nonsens und Imitationen
- 19.4. Funktion des Erzählers und intertextuelle Merkmale
- 20. Michael Endes „Momo“ (1973) als Beispiel einer politischen Phantastik
- 20.1. Kapitalismuskritik als Zeichen der politischen Phantastik
- 20.2. Kennzeichen der Phantastik
- 20.3. Sprachlich-literarische Konzeption und Thematisierung des Schreibens als postmodernes Element
- 20.4. Romantische Elemente in „Momo“
- 21. Christine Nöstlingers „Hugo, das Kind in den besten Jahren“ (1983) als Beispiel einer doppelsinnigen Phantastik
- 21.1. Intertextualität und Doppelsinnigkeit
- 21.2. Phantastische Motive
- 21.3. Sprache
- 21.4. Hugo: Kinderliteratur für Erwachsene?
- 22. „Pepito und der unsichtbare Hund“ von Antonio Martínez-Menchén (1985) als Beispiel einer psychologischen Phantastik
- 22.1. Einsamkeit und innere Zerrissenheit als Elemente einer psychologischen Phantastik
- 22.2. Phantastik im Zeichen der Postmoderne
- 22.3. Sprache in „Pepito und der unsichtbare Hund“ unter Berücksichtigung des impliziten Übersetzers
- 22.4. Doktor Faustus und die Teufel - Intertextualität
- 23. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte (Objectives and Key Themes)
Die vorliegende Magisterarbeit hat zum Ziel, den Wandel der Themen, Formen und Funktionen der phantastischen Kinder- und Jugendliteratur der 70er und frühen 80er Jahre in Westdeutschland zu untersuchen und nachzuweisen.
- Politisierung der Phantastik
- Entwicklung eines „phantastischen Realismus“
- Veränderungen der Kindheitsbilder
- Einfluss der (Post-)Moderne auf die phantastische Kinder- und Jugendliteratur
- Funktionen der Phantastik in der Kinder- und Jugendliteratur
Zusammenfassung der Kapitel (Chapter Summaries)
Die Einleitung stellt die Thematik der Arbeit vor und erläutert die Zielsetzung. Kapitel 2 beleuchtet die Bedeutung von E.T.A. Hoffmann als Begründer der phantastischen Erzählung für Kinder- und Jugendliche, während Kapitel 3 die Entwicklung der Phantastik in Europa seit der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts skizziert. In Kapitel 4 wird eine Unterscheidung zwischen Phantasie, Fiktionalität, Phantastisches, phantastische Literatur und Phantastik vorgenommen.
Kapitel 5 diskutiert die Frage, ob Phantastik als Genremix betrachtet werden kann. Kapitel 6 befasst sich mit der Phantastikdiskussion in der Kinder- und Jugendliteraturforschung, wobei verschiedene Definitionen und Forschungsansätze beleuchtet werden. Kapitel 7 erläutert die Zwei-Welten-Theorie, während Kapitel 8 die Modelle der phantastischen Literatur nach Maria Nikolajewa behandelt.
Kapitel 9 analysiert den Paradigmenwechsel in der Kinder- und Jugendliteratur der 70er Jahre. Kapitel 10 untersucht die Verwendung von Phantastik in „realistischer“ Absicht, während Kapitel 11 sich mit veränderten Kindheitsbildern und der „sozialen Phantastik“ befasst.
Kapitel 12 beleuchtet den Einfluss der (Post-)Moderne auf die phantastische Kinderliteratur und behandelt Themen wie Intertextualität und Ich- und Du-Themen. Kapitel 13 widmet sich den Funktionen der Phantastik in der Kinder- und Jugendliteratur. Kapitel 14 behandelt Themen, Typen und Merkmale kinder- und jugendliterarischer Phantastik, einschließlich Grenzüberschritten, phantastischen Reisen, Anderswelten, Spiegel als phantastische Schwellen und Gästen aus dem Unbekannten.
Kapitel 15 untersucht die komisch-phantastische Kindererzählung und die drei Typen dieser Erzählform nach Reinbert Tabbert. Kapitel 16 beschäftigt sich mit kindlichen Wunschträumen als Motive phantastischer Geschichten. Kapitel 17 analysiert Günther Herburgers „Birne kann alles“ (1971) als Beispiel einer sozialkritischen Phantastik.
Schlüsselwörter (Keywords)
Die Arbeit beschäftigt sich mit den Themen Phantastik, Kinder- und Jugendliteratur, 70er und 80er Jahre, Westdeutschland, sozialkritische Phantastik, phantastischer Realismus, (Post-)Moderne, Intertextualität, Zwei-Welten-Theorie, Kindheitsbilder, Familienbilder und Funktionen der Phantastik.
- Quote paper
- S.D. Rieger (Author), 2009, Themen, Formen und Funktionswandel der phantastischen Kinder- und Jugendliteratur der 70er und der frühen 80er Jahre, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/174181