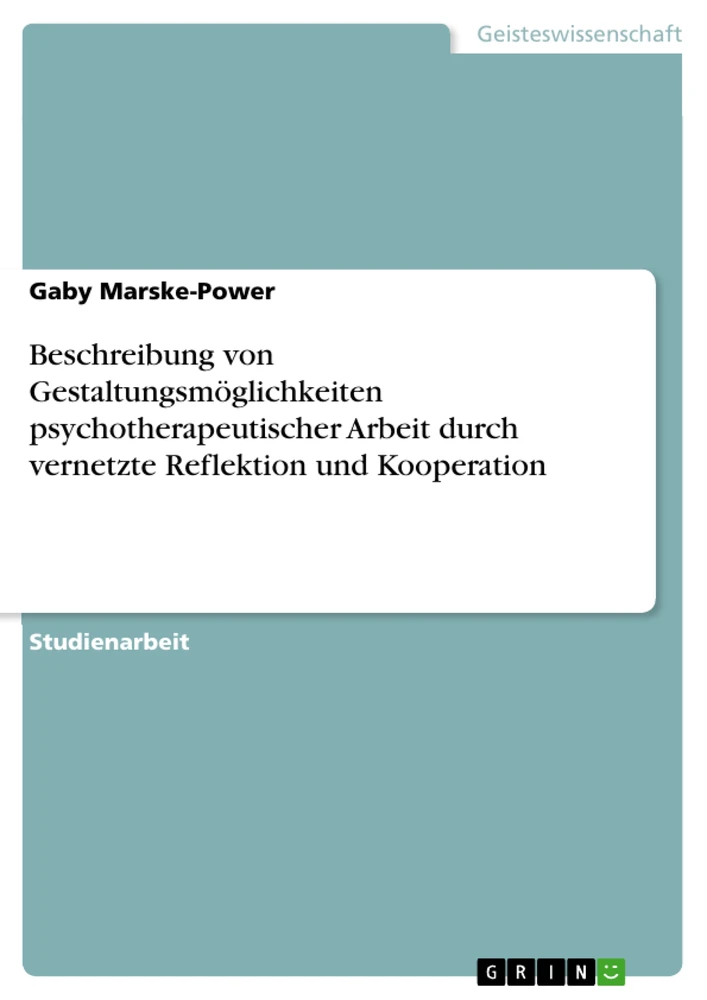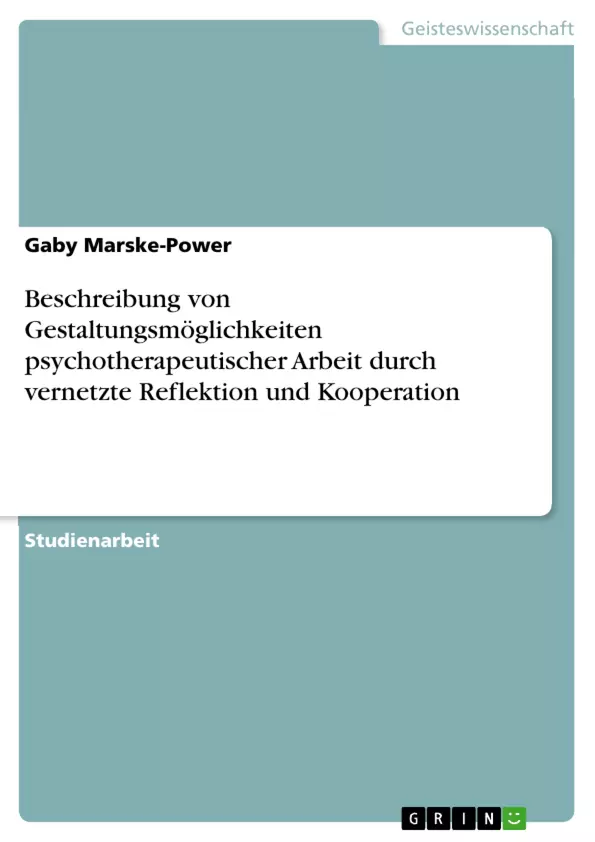Mein ursprüngliches Thema war es gewesen, den Bedingungen für eine selbstständige, nicht institutionell eingebundene psychotherapeutische Praxis nachzugehen, welches ich dann verwarf, weil ich vermutete, dass einE selbstständig arbeitende TherapeutIn eigentlich keine seriöse Opfer- oder TäterInarbeit anbieten kann – Opferarbeit ist nicht nur in meinem eigenen Erfahrungshorizont ebenso Teamarbeit, wie auch TäterInnenarbeit grundlegend sich darauf gründet. [...] Aus der Praxis kenne ich das Widerstreben und die Unwilligkeit der niedergelassenen PsychotherapeutInnen, selbst an unseren Supervisionen, zu denen wir freundlich und kostenfrei einladen, mit teilzunehmen. Sind sie so einzuordnen, wie die Widerstände des Jugendamtes gegen längerfristige Maßnahmen auf dem Hintergrund finanzieller Vorsicht? Oder wie die Ängste der Schulen – inzwischen zum Teil mit Schulgeld - angesichts sich verringender SchülerInnenzahlen, die zum Verschweigen von Gewalt vor Ort führt? Geht es bei allem primär um den ökonomischen Faktor – oder ist er einer unter vielen? Das kann gut sein, meine Gedanken werden ihn auch nicht außer Acht lassen, aber hier all den anderen, rein inhaltlichen Möglichkeiten nachgehen, da sie mir veränderungswilliger erscheinen.
Ich stelle daher kurz beschreibend die unterschiedlichen Kooperations- und Austauschmöglichkeiten, die ich kenne, exemplarisch vor. Der Überblick soll veranschaulichen, wie stark sich tatsächlich der interagierende Wechsel zwischen einer Beratungsstelle, die sich der Gewaltthematik stellt, mit den anderen Stellen des sozialen Netzwerks, darstellt, um dann Schlussfolgerungen für die Austauschmöglichkeiten einer selbstständig niedergelassenen TherarpeutIn zu ziehen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Vernetzung im Landkreis
- Kooperation im klinischen Kontext
- Kinder- und Jugendpsychiatrie
- Tagespsychiatrische Klinik
- Kinder- und Jugendpsychiater
- Kinderstation des Kreiskrankenhauses
- KinderärztInnen
- Sozialpädiatrisches Zentrum
- Niedergelassene DiplompsychologInnen und PsychotherapeutInnen
- Kooperation mit Behörden und Justiz
- Polizei
- Justiz
- Jugendamt
- Schulamt
- Kooperation im beraterischem Kontext
- Beratungsstellen
- Kooperation innerhalb der eigenen Einrichtung
- Zusammenfassung der Kooperationsbedingungen im regionalen sozialen Netzwerk
- Gemeinsame Reflektion
- HelferInnenkonferenz
- Kollegiale Fallbesprechung / Teamberatung
- Kollegiale Fallbesprechung / Intervision
- Supervision
- Zusammenfassung Gemeinsame Reflektion
- Schlussfolgerungen
- Anmerkungen
- Quellenverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Der Text beleuchtet die Gestaltungsmöglichkeiten psychotherapeutischer Arbeit im Kontext von Vernetzung und Kooperation. Er fokussiert dabei insbesondere auf die Herausforderungen und Möglichkeiten der Zusammenarbeit in einem regionalen sozialen Netzwerk, wobei der Schwerpunkt auf der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen liegt.
- Analyse der verschiedenen Kooperationsformen im regionalen sozialen Netzwerk
- Bewertung der Vor- und Nachteile der Zusammenarbeit für psychotherapeutische Arbeit
- Bedeutung der gemeinsamen Reflektion und Supervision in der psychotherapeutischen Praxis
- Die Rolle von Teamarbeit und Interdisziplinarität in der Bearbeitung von Gewaltthematik
- Herausforderungen und Chancen für selbstständig tätige PsychotherapeutInnen im Kontext von Vernetzung und Kooperation
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung beleuchtet die Motivation und die Herausforderungen einer selbstständigen psychotherapeutischen Praxis im Kontext von Gewaltarbeit. Es werden die Bedeutung der Teamarbeit, die spezifischen Dynamiken in der therapeutischen Beziehung und die Notwendigkeit der kontinuierlichen Selbstreflexion hervorgehoben.
Das Kapitel "Vernetzung im Landkreis" analysiert die verschiedenen Kooperationsformen im klinischen Kontext, wie z.B. die Zusammenarbeit mit der Kinder- und Jugendpsychiatrie, der Tagespsychiatrie, Kinder- und Jugendärzten sowie dem Sozialpädiatrischen Zentrum. Die Bedeutung der Netzwerkarbeit für die Bearbeitung von Gewaltthematik wird deutlich herausgestellt.
Der Abschnitt "Kooperation im beraterischem Kontext" beleuchtet die Zusammenarbeit mit Beratungsstellen und anderen Einrichtungen im sozialen Netzwerk. Die Bedeutung von gegenseitigem Austausch und gemeinsamen Vorgehensweisen wird hervorgehoben.
Das Kapitel "Kooperation innerhalb der eigenen Einrichtung" beschreibt die verschiedenen Formen der gemeinsamen Reflektion innerhalb eines Teams, wie z.B. HelferInnenkonferenzen, Kollegiale Fallbesprechungen und Supervision. Die Notwendigkeit dieser Prozesse für die Qualitätssicherung und die Bewältigung der spezifischen Belastungen in der Arbeit mit Gewaltthematik wird betont.
Schlüsselwörter
Die zentralen Begriffe, die in diesem Text behandelt werden, sind: Psychotherapie, Vernetzung, Kooperation, soziales Netzwerk, Gewaltarbeit, Kinder- und Jugendhilfe, Teamarbeit, Selbstreflexion, Supervision, Qualitätssicherung.
Häufig gestellte Fragen
Warum ist Vernetzung in der Psychotherapie so wichtig?
Besonders in der Arbeit mit Gewaltopfern oder -tätern ist Teamarbeit essenziell, da die Komplexität der Fälle oft die Möglichkeiten eines einzelnen Therapeuten übersteigt.
Mit welchen Stellen kooperieren Psychotherapeuten im Landkreis?
Zu den Partnern gehören Kinder- und Jugendpsychiatrien, Kinderärzte, das Jugendamt, die Polizei, Schulen sowie spezialisierte Beratungsstellen.
Was ist eine "HelferInnenkonferenz"?
Dies ist ein Treffen aller an einem Fall beteiligten Fachkräfte (z.B. Lehrer, Therapeuten, Sozialarbeiter), um das Vorgehen abzustimmen und die bestmögliche Unterstützung zu planen.
Welche Rolle spielt die Supervision?
Supervision dient der Qualitätssicherung und psychischen Entlastung der Therapeuten, indem das eigene Handeln und die Dynamik in schwierigen Fällen professionell reflektiert werden.
Was erschwert die Kooperation zwischen niedergelassenen Therapeuten und Behörden?
Oft stehen ökonomische Faktoren, Zeitmangel oder auch institutionelle Widerstände (z.B. finanzielle Vorsicht des Jugendamtes) einer tiefergehenden Vernetzung im Weg.
- Quote paper
- Gaby Marske-Power (Author), 2011, Beschreibung von Gestaltungsmöglichkeiten psychotherapeutischer Arbeit durch vernetzte Reflektion und Kooperation, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/174205