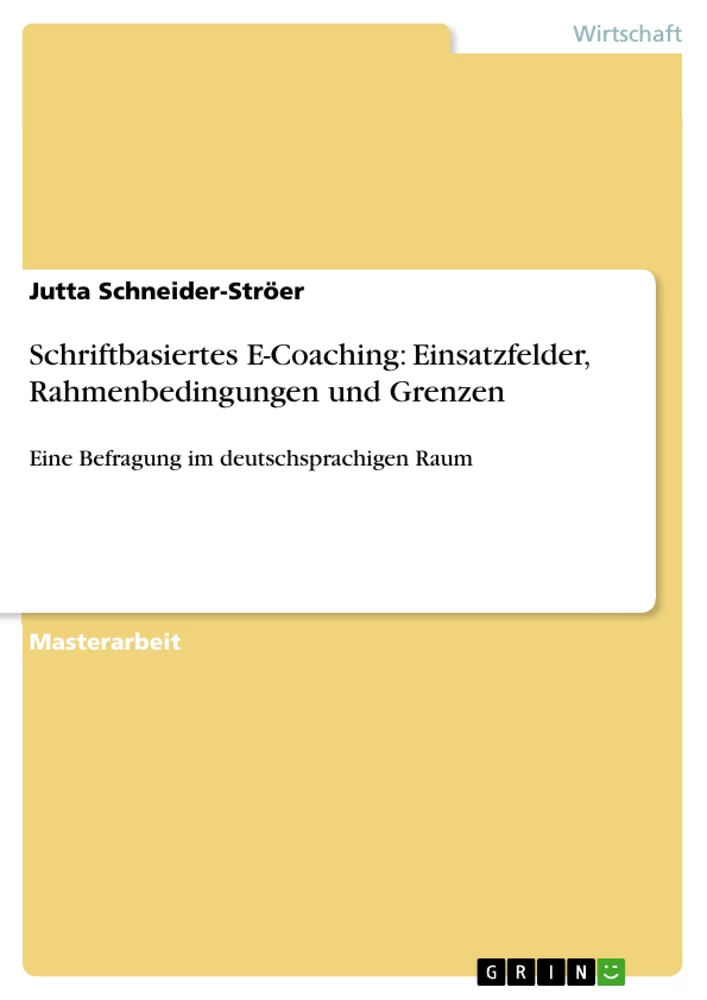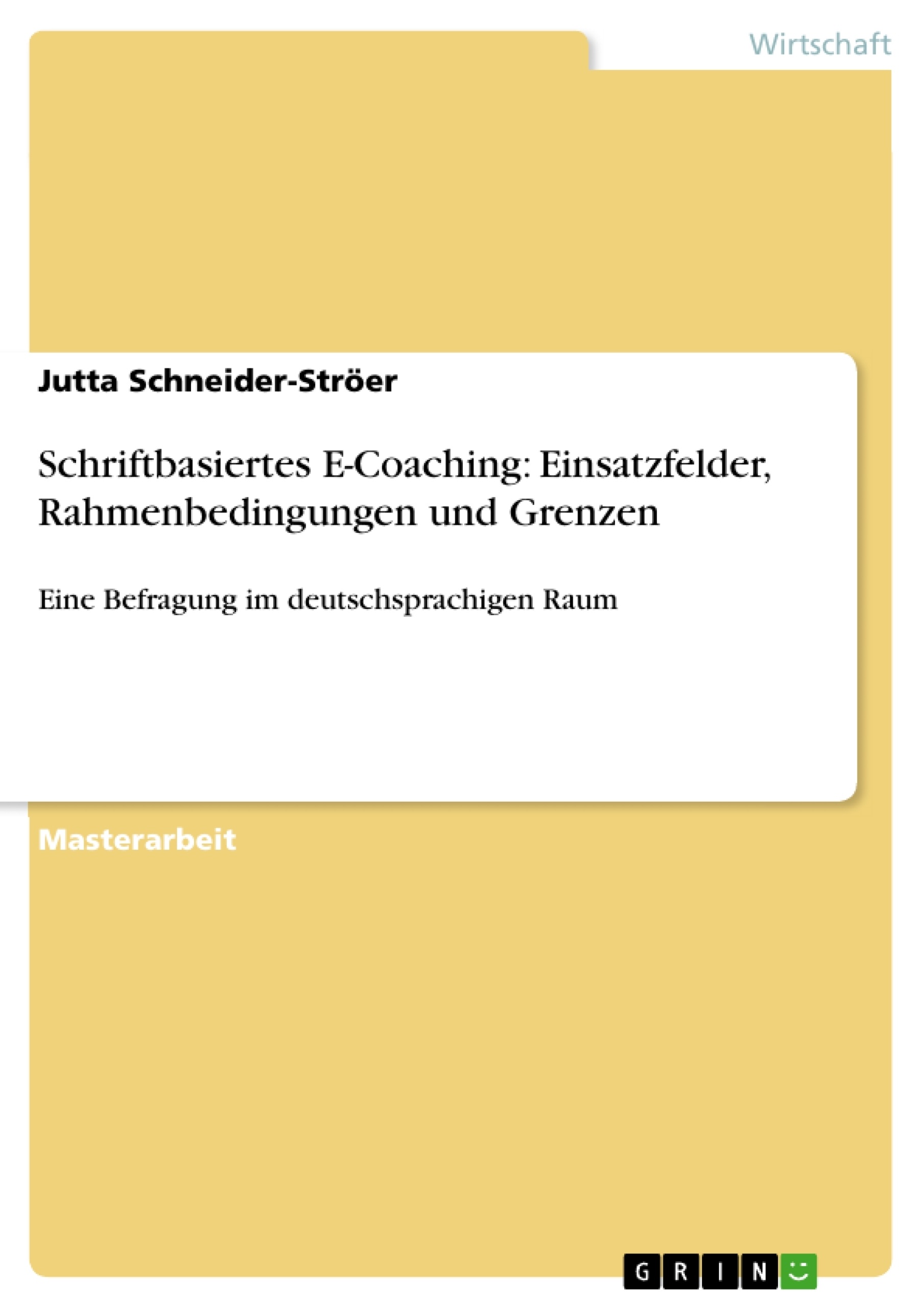In einer globalisierten Welt ist das Internet zum alltäglichen Kommunikations-medium geworden. Das Angebot zum Coaching via Internet nimmt zu, ist breit gefächert und unübersichtlich. Es wird von Befürwortern und Gegnern kontrovers diskutiert. Dabei gibt es wenige aussagekräftige Studien, welche schriftbasiertes E-Coaching im deutschsprachigen Raum thematisieren. Das Ziel der vorliegenden Arbeit ist, die Rahmenbedingungen, Einsatzfelder und Grenzen von schriftbasiertem E-Coaching in Deutschland, Österreich und der Schweiz zu erheben. Per Online-Interview wurden zehn Anbieter von E-Coaching als Experten ausführlich zu dem Thema befragt.
Die Ergebnisse sind sehr differenziert und zeigen klar die grossen Chancen und Einsatzmöglichkeiten, aber auch die Grenzen von E-Coaching auf. Schriftbasiertes E-Coaching kann dann sein grösstes Potenzial entfalten, wenn es von qualifizierten E-Coaches als ein zielgruppenspezifisches Instrument eingesetzt wird. Eine Kombination mit Präsenzcoaching in der Kontraktphase ist empfehlenswert.
In a global economy the internet is a commonplace means of communication. The range of coaching services offered via internet is diverse and growing, and can be confusing. Controversial discussions take place between supporters and detractors. There are few relevant studies addressing text-based e-coaching in German speaking regions. The aim of this work is to highlight the general conditions, areas of application and limits of text based e-coaching in Germany, Austria and Switzerland. Ten e-coaching service providers were asked their expert opinions on this subject via extensive online interviews.
The results are highly differentiated and clearly show not only the considerable possibilities and vast array of applications available through e-coaching, but also its limits. Text based e-coaching can achieve its greatest potential if it is used by qualified e-coaches as an instrument for specific target groups. It is recommended that e-coaching be combined with face-to-face coaching during the “contracting” or “entry phase” of the coaching process.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 1.1 Thema und Fragestellungen
- 1.2 Aufbau der Arbeit
- 1.3 Sprachregelung
- 2 Begriffsdefinitionen
- 2.1 Coaching
- 2.1.1 Definition von Coaching
- 2.1.2 Abgrenzung zu Beratung
- 2.1.3 Abgrenzung zu Mentoring
- 2.1.4 Abgrenzung zu Supervision
- 2.1.5 Abgrenzung zu Psychotherapie
- 2.1.6 Abgrenzung zu Training
- 2.2 E-Coaching
- 2.2.1 Definition von E-Coaching
- 2.2.2 Formen von E-Coaching
- 2.2.3 Abgrenzung zu Face-to-Face-Coaching, Blended Coaching und E-Learning
- 3 Besonderheiten des E-Coachings
- 3.1 Kennzeichen des Internets
- 3.1.1 Internetnutzung
- 3.1.2 Auswirkungen des Internets auf Individuum und Gesellschaft
- 3.2 Computervermittelte Kommunikation (CVK)
- 3.2.1 Kanalreduktionstheorie
- 3.2.2 Theorie des Herausfilterns sozialer Hinweisreize
- 3.2.3 Medienwahlmodelle
- 3.2.4 Theorie der sozialen Informationsverarbeitung
- 3.2.5 Simulationsmodell
- 3.2.6 Imaginationsmodell
- 3.3 Schriftkommunikation im Internet: Parasprache und Oraliteralität
- 3.4 Ablauf und Setting von E-Coachings
- 3.5 Zielgruppen von E-Coaching und Anforderungen an den E-Coachee
- 3.6 Anforderungen an den E-Coach
- 3.7 Vorteile des E-Coachings
- 3.8 Nachteile des E-Coachings
- 3.9 Ethische Fragestellungen
- 4 Untersuchungsmethode
- 4.1 Methodische Überlegungen und Forschungsprozess
- 4.2 Datenerhebung
- 4.2.1 Datenerhebungsverfahren
- 4.2.2 Interviewleitfaden und Pretest
- 4.2.3 Stichprobenauswahl und Stichprobenbeschreibung
- 4.3 Rahmenbedingungen der Befragung
- 4.3.1 Kontaktaufnahme zu den Interviewpartnern
- 4.3.2 Interviewsituation
- 4.3.3 Interviewprotokolle
- 4.4 Auswertungsmethode
- 4.4.1 Qualitative Inhaltsanalyse
- 4.4.2 Auswertungsschritte
- 5 Ergebnisse
- 5.1 Kontaktaufnahme und technische Rahmenbedingungen
- 5.2 Ablauf der E-Coachings
- 5.3 E-Coaching-Kunden
- 5.4 Themen und Ziele von E-Coaching
- 5.5 Vor- und Nachteile von E-Coaching
- 5.6 Einstellung und Motivation der E-Coaching-Anbieter
- 5.7 Ist-Situation und Blick in die Zukunft
- 5.8 Ergänzende Bemerkungen der Interviewpartner
- 6 Interpretation und Diskussion
- 6.1 Rahmenbedingungen von schriftbasiertem E-Coaching
- 6.1.1 Angebot und Anbieter von schriftbasiertem E-Coaching
- 6.1.2 Ablauf der E-Coachings
- 6.2 Einsatzfelder von schriftbasiertem E-Coaching
- 6.2.1 E-Coaching-Kunden
- 6.2.2 Themen und Ziele von schriftbasierten E-Coachings
- 6.2.3 Vorteile von E-Coaching
- 6.3 Grenzen von schriftbasiertem E-Coaching
- 6.3.1 Anforderungen an die E-Coaching-Kunden
- 6.3.2 Anforderungen an die E-Coachs
- 6.3.3 Limitierung der Themen und Methoden
- 6.3.4 Nachteile von schriftbasiertem E-Coaching
- 6.3.5 Ist-Situation bei der Nachfrage nach schriftbasiertem E-Coaching
- 7 Ausblick: Die Zukunft von schriftbasiertem E-Coaching in Forschung und Praxis
- 7.1 Konsequenzen für die Forschung
- 7.2 Konsequenzen für die Praxis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit untersucht die Rahmenbedingungen, Einsatzfelder und Grenzen schriftbasierten E-Coachings im deutschsprachigen Raum. Ziel ist es, durch Experteninterviews ein umfassendes Bild der aktuellen Situation zu zeichnen und Potenziale sowie Limitationen dieser Coaching-Form aufzuzeigen.
- Definition und Abgrenzung von E-Coaching zu anderen Methoden
- Analyse der Besonderheiten schriftbasierter Kommunikation im Kontext von Coaching
- Erfassung der Einsatzfelder und Zielgruppen von schriftbasiertem E-Coaching
- Untersuchung der Vor- und Nachteile von schriftbasiertem E-Coaching
- Bewertung der ethischen Aspekte von E-Coaching
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Dieses Kapitel führt in die Thematik des schriftbasierten E-Coachings ein und legt die Forschungsfrage und die methodische Vorgehensweise dar. Es hebt die Relevanz des Themas im Kontext der wachsenden Internetnutzung und des sich entwickelnden Coaching-Marktes hervor und begründet die Notwendigkeit für eine differenzierte Untersuchung der spezifischen Rahmenbedingungen, Einsatzmöglichkeiten und Grenzen dieser Kommunikationsform.
2 Begriffsdefinitionen: Hier werden die zentralen Begriffe „Coaching“, „E-Coaching“ und deren Abgrenzung zu verwandten Konzepten wie Beratung, Mentoring, Supervision, Psychotherapie und Training präzise definiert. Diese Klärung der Begrifflichkeiten bildet die Grundlage für ein präzises Verständnis der weiteren Untersuchung. Die unterschiedlichen Definitionen und Abgrenzungen werden detailliert erläutert und mit Beispielen veranschaulicht, um mögliche Missverständnisse zu vermeiden.
3 Besonderheiten des E-Coachings: Dieses Kapitel beleuchtet die spezifischen Charakteristika des E-Coachings im Vergleich zu traditionellen Coaching-Formaten. Es werden relevante Theorien der computervermittelten Kommunikation (CVK) eingeführt und deren Relevanz für das schriftbasierte E-Coaching diskutiert, unter Berücksichtigung von Aspekten wie Kanalreduktion, sozialen Hinweisreizen und Medienwahl. Die Rolle schriftlicher Kommunikation im Internet, inklusive der Herausforderungen von Parasprache und Oralität, wird umfassend analysiert. Zusätzlich werden die Zielgruppen, Anforderungen an Coachee und Coach, sowie die Vor- und Nachteile, sowie ethische Fragestellungen, im Detail behandelt.
4 Untersuchungsmethode: Das Kapitel beschreibt detailliert die gewählte Forschungsmethodik, beginnend mit methodischen Überlegungen und dem Forschungsprozess. Es erläutert das Datenerhebungsverfahren, den Interviewleitfaden, die Stichprobenauswahl und die Beschreibung der Stichprobe, sowie die Rahmenbedingungen der Befragung inklusive Kontaktaufnahme und Interviewsituation. Abschließend wird die qualitative Inhaltsanalyse als Auswertungsverfahren vorgestellt und die Auswertungsschritte werden detailliert beschrieben.
5 Ergebnisse: In diesem Kapitel werden die Ergebnisse der durchgeführten Experteninterviews präsentiert. Die gewonnenen Daten werden systematisch und nachvollziehbar dargestellt, umfassend die Kontaktaufnahme, den Ablauf der E-Coachings, die E-Coaching-Kunden, die Themen und Ziele, die Vor- und Nachteile, sowie die Einstellungen und Motivationen der Anbieter. Ein Ausblick auf die Ist-Situation und die zukünftige Entwicklung des schriftbasierten E-Coachings wird gegeben, ergänzt durch Kommentare der Interviewpartner.
6 Interpretation und Diskussion: Dieses Kapitel interpretiert die im vorherigen Kapitel dargestellten Ergebnisse. Es analysiert die Rahmenbedingungen des schriftbasierten E-Coachings, untersucht seine Einsatzfelder und Grenzen, und setzt sich intensiv mit den Anforderungen an Coachees und Coaches auseinander. Die Limitierungen der Themen und Methoden werden ebenso beleuchtet wie die Nachteile und die Ist-Situation der Nachfrage. Die Interpretation wird durch ausführliche Diskussion der Ergebnisse abgerundet.
Schlüsselwörter
Schriftbasiertes E-Coaching, Online-Coaching, Computervermittelte Kommunikation (CVK), Qualitative Inhaltsanalyse, Experteninterviews, Coaching-Methoden, Zielgruppen, Rahmenbedingungen, Einsatzfelder, Grenzen, Vorteile, Nachteile, Ethische Aspekte.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Schriftbasiertes E-Coaching
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht schriftbasiertes E-Coaching im deutschsprachigen Raum. Sie analysiert die Rahmenbedingungen, Einsatzfelder und Grenzen dieser Coaching-Form und zeichnet ein umfassendes Bild der aktuellen Situation, inklusive Potenziale und Limitationen.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themen: Definition und Abgrenzung von E-Coaching, Besonderheiten schriftbasierter Kommunikation im Coaching-Kontext, Einsatzfelder und Zielgruppen von schriftbasiertem E-Coaching, Vor- und Nachteile, ethische Aspekte und die Zukunft von schriftbasiertem E-Coaching in Forschung und Praxis.
Welche Methodik wurde verwendet?
Die Untersuchung basiert auf Experteninterviews. Die Methodik umfasst methodische Überlegungen, den Forschungsprozess, die Datenerhebung (Interviewleitfaden, Stichprobenauswahl), die Rahmenbedingungen der Befragung und die qualitative Inhaltsanalyse als Auswertungsverfahren.
Wie ist die Arbeit aufgebaut?
Die Arbeit gliedert sich in sieben Kapitel: Einleitung (Thema, Fragestellung, Aufbau), Begriffsdefinitionen (Coaching, E-Coaching und Abgrenzungen), Besonderheiten des E-Coachings (Theorien der CVK, Schriftkommunikation, Ablauf, Zielgruppen, Vor- und Nachteile, Ethik), Untersuchungsmethode (Datenerhebung, Auswertung), Ergebnisse (Präsentation der Interviewergebnisse), Interpretation und Diskussion (Analyse der Ergebnisse, Einsatzfelder, Grenzen) und Ausblick (Konsequenzen für Forschung und Praxis).
Welche Ergebnisse wurden erzielt?
Die Ergebnisse der Experteninterviews werden systematisch präsentiert. Sie umfassen Aspekte wie Kontaktaufnahme, Ablauf der E-Coachings, E-Coaching-Kunden, Themen und Ziele, Vor- und Nachteile, Einstellungen und Motivationen der Anbieter, sowie die Ist-Situation und zukünftige Entwicklung des schriftbasierten E-Coachings.
Welche Schlussfolgerungen werden gezogen?
Die Interpretation der Ergebnisse analysiert die Rahmenbedingungen, Einsatzfelder und Grenzen des schriftbasierten E-Coachings, inklusive der Anforderungen an Coachees und Coaches. Die Limitierungen der Themen und Methoden, Nachteile und die Ist-Situation der Nachfrage werden diskutiert.
Welche Schlüsselwörter sind relevant?
Schlüsselwörter sind: Schriftbasiertes E-Coaching, Online-Coaching, Computervermittelte Kommunikation (CVK), Qualitative Inhaltsanalyse, Experteninterviews, Coaching-Methoden, Zielgruppen, Rahmenbedingungen, Einsatzfelder, Grenzen, Vorteile, Nachteile, Ethische Aspekte.
Für wen ist diese Arbeit relevant?
Diese Arbeit ist relevant für Personen, die sich mit Coaching, E-Coaching, Online-Kommunikation, qualitativer Forschung und den ethischen Aspekten von Online-Dienstleistungsangeboten auseinandersetzen. Sie ist insbesondere für Coaches, Forscher und alle Interessierten an den Möglichkeiten und Grenzen des schriftbasierten E-Coachings von Interesse.
Wo finde ich weitere Informationen?
(Hier könnte ein Link zu einer Webseite oder einem Dokument eingefügt werden, falls vorhanden)
- Citation du texte
- Jutta Schneider-Ströer (Auteur), 2010, Schriftbasiertes E-Coaching: Einsatzfelder, Rahmenbedingungen und Grenzen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/174282