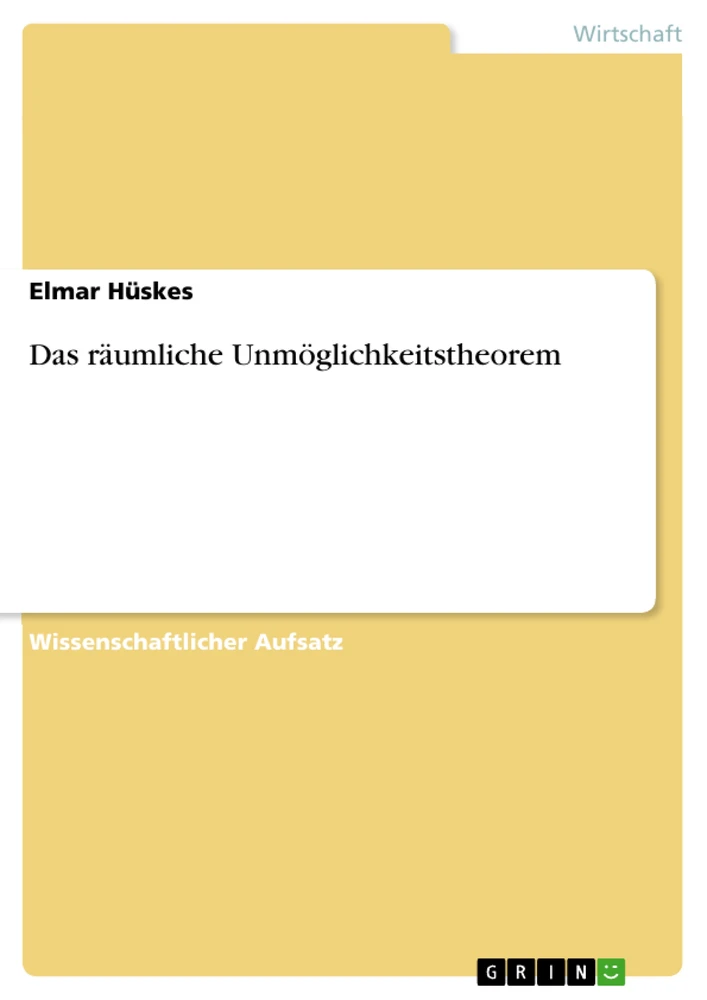Die von Wettbewerbsparadigmen beherrschte wirtschaftliche Theorie blendete das Phänomen der Zusammenballung von Menschen und ökonomischen Aktivitäten (Agglomeration) bisher aus, obwohl schon seit Beginn der Industrialisierung eine positive Korrelation zwischen Urbanisierung und dem Entwicklungsstand eines Landes zu erkennen ist. Als ein Beispiel hierfür wären Berlin, Hamburg, München, Köln und Frankfurt zu nennen, die zusammen mit einem Anteil von 0,7 % an der Gesamtfläche der Bundesrepublik Deutschland und einem Anteil von 15,9 % an der Gesamtbevölkerung 15,9 % der Wertschöpfung (1994) erwirtschafteten. Das Beispiel macht deutlich, dass in einem entwickelten Land die Wirtschaftsleistung zunehmend in Ballungszentren erbracht wird. Dies ist umso verwunderlicher, da esbei einer solchen Agglomeration offensichtlich zu Ballungskosten kommt. Diese negativen externen Effekte reichen von Umweltverschmutzung bis hin zu erhöhter Lärmbelästigung.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Versagen des Preismechanismus in der räumlichen Ökonomie
- Vollständige Konkurrenz und neoklassisches Gleichgewicht
- Unzulänglichkeiten der Wettbewerbsannahmen für eine räumliche Ökonomie
- Bedeutung der Konvexität
- Quadratisches Zuweisungsproblem (externer Beweis der Theorie)
- Räumliches Unmöglichkeitstheorem
- Modell-Setup (statisches Modell)
- Schlussfolgerung
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Abhandlung widmet sich der Analyse des Phänomens der Agglomeration und dem Versagen des Preismechanismus in der räumlichen Ökonomie. Die Arbeit untersucht, wie sich die klassische ökonomische Theorie mit dem empirischen Befund der Konzentration von Wirtschaftsaktivitäten in Ballungszentren auseinandersetzt.
- Das Arrow/Debreu-Modell der vollständigen Konkurrenz
- Kritik an den Annahmen des Arrow/Debreu-Modells im räumlichen Kontext
- Das räumliche Unmöglichkeitstheorem und seine Implikationen
- Die Bedeutung von räumlicher Inhomogenität für die Entstehung von Agglomerationen
- Die Grenzen des neoklassischen Wettbewerbsmodells in der räumlichen Ökonomie
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung stellt den Widerspruch zwischen der klassischen ökonomischen Theorie und der empirischen Beobachtung von Agglomerationsphänomenen dar. Sie führt in die Problematik ein und skizziert den Aufbau der Abhandlung.
- Versagen des Preismechanismus in der räumlichen Ökonomie: Dieses Kapitel untersucht das Arrow/Debreu-Modell der vollständigen Konkurrenz und beleuchtet dessen Unzulänglichkeiten im Kontext räumlicher Ökonomie. Es wird dargelegt, wie das Modell die räumliche Interdependenz von Märkten nicht hinreichend berücksichtigt und warum es keine Agglomeration erklären kann.
- Räumliches Unmöglichkeitstheorem: Das Kapitel präsentiert das räumliche Unmöglichkeitstheorem, das die Unfähigkeit des Preismechanismus zeigt, räumliche Gleichgewichte mit Agglomeration zu generieren. Es werden die wichtigsten Implikationen des Theorems für die räumliche Ökonomie diskutiert.
Schlüsselwörter
Die Arbeit fokussiert auf die Schlüsselbegriffe Agglomeration, räumliches Unmöglichkeitstheorem, Arrow/Debreu-Modell, vollständige Konkurrenz, räumliche Inhomogenität, Transportkosten und neoklassische Ökonomie. Diese Begriffe bilden den Rahmen für die Analyse des Versagens des Preismechanismus in der räumlichen Ökonomie.
Häufig gestellte Fragen
Was besagt das räumliche Unmöglichkeitstheorem?
Es zeigt auf, dass unter den Annahmen vollständiger Konkurrenz kein stabiles räumliches Gleichgewicht mit Agglomeration (Zusammenballung) existieren kann.
Warum versagt der Preismechanismus in der räumlichen Ökonomie?
Klassische Modelle wie das Arrow-Debreu-Modell berücksichtigen Transportkosten und räumliche Interdependenzen nicht ausreichend, was die Theorie von der Realität entfernt.
Was ist Agglomeration?
Agglomeration bezeichnet die räumliche Konzentration von Menschen und ökonomischen Aktivitäten in Ballungszentren wie Berlin oder München.
Welche Rolle spielen Transportkosten für Ballungszentren?
Das Theorem verdeutlicht, dass räumliche Inhomogenität und Transportkosten entscheidend für die Entstehung von wirtschaftlichen Zentren sind.
Was sind Ballungskosten?
Das sind negative externe Effekte von Agglomerationen, wie erhöhte Lärmbelästigung, Umweltverschmutzung und hohe Mieten.
- Arbeit zitieren
- Elmar Hüskes (Autor:in), 2011, Das räumliche Unmöglichkeitstheorem, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/174309