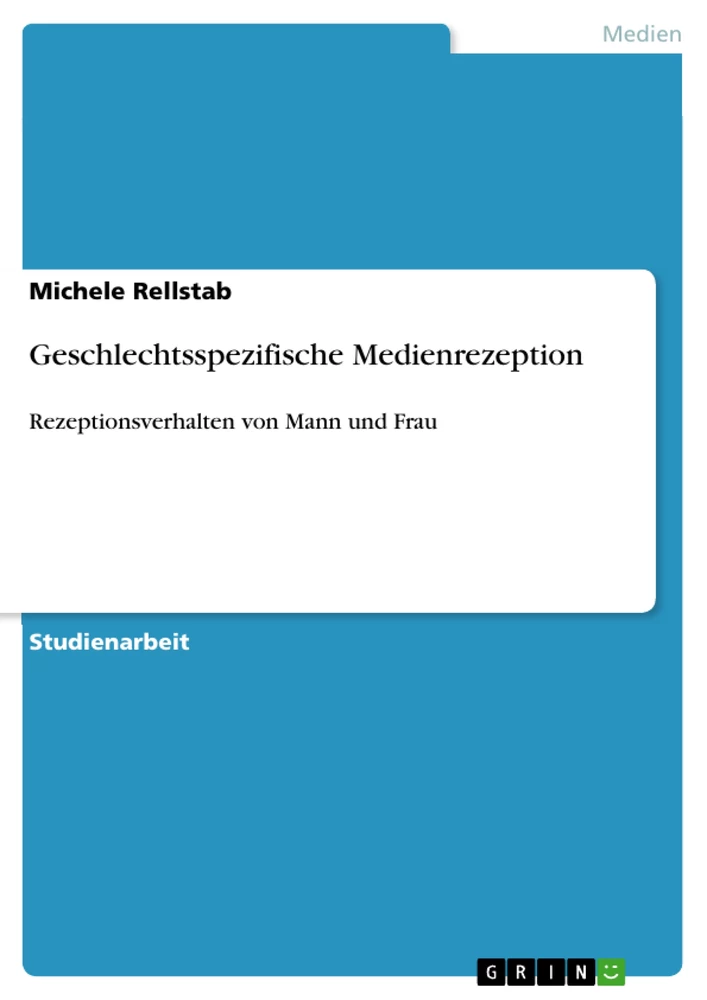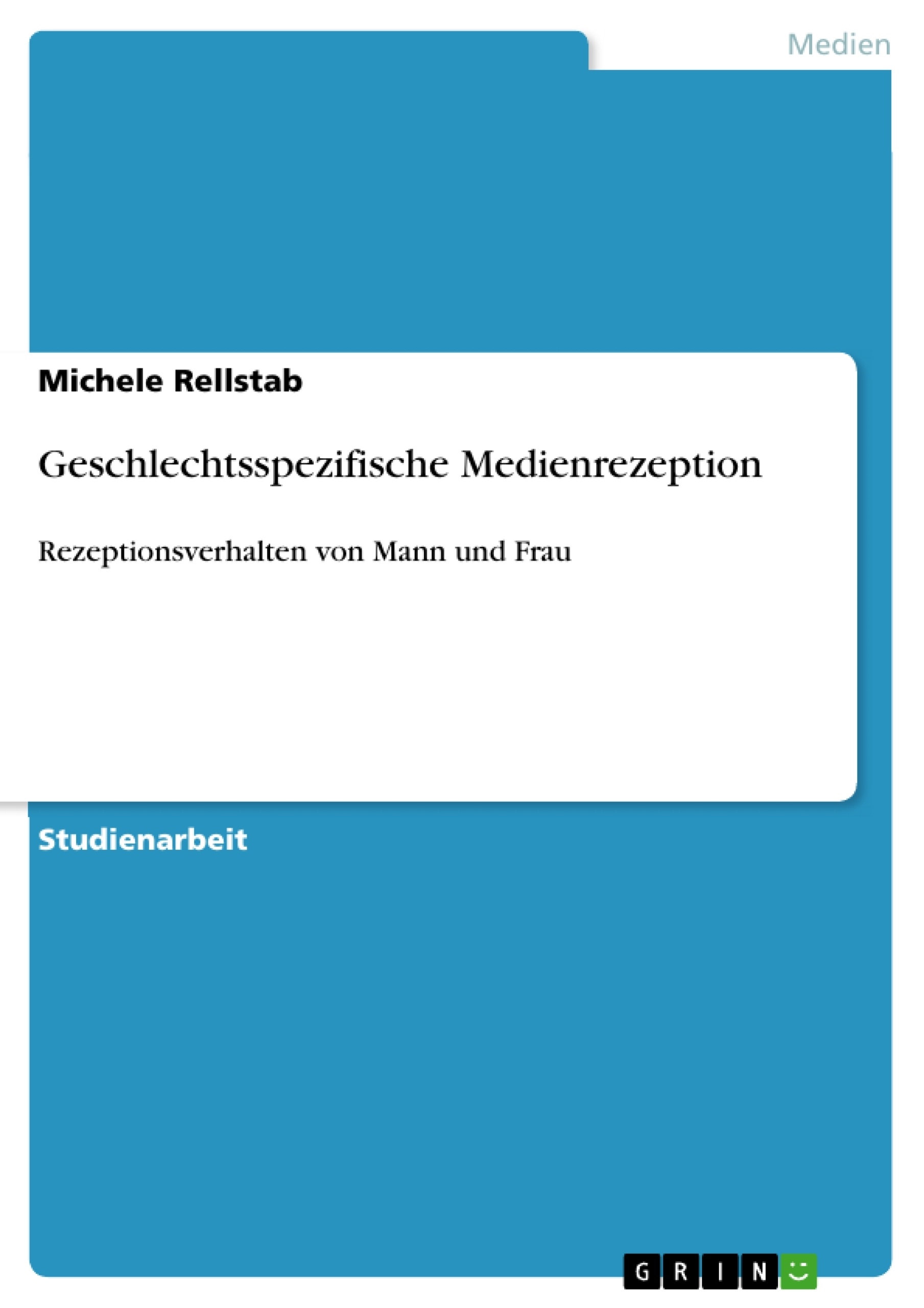Gender - Ein aktuelles soziales Problem in den Medien? Existieren wirklich geschlechtsspezifische Unterschiede in der Rezeption von Medienangeboten? Sind es nicht viel mehr die Medien selbst, die solche Differenzen hervorrufen? Das Ziel dieser Seminararbeit besteht darin, bestehende Unterschiede von Frau und Mann in der Rezeption von Fernsehinhalten aufzuzeigen und sie im Hinblick auf soziale Probleme kritisch zu hinterfragen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Historischer Überblick
- Wirkungstheorien
- Involvement als Rezeptionsprozess
- Definition von Involvement
- PSI - Parasoziale Interaktion und PSB - parasoziale Beziehung
- Emotionen
- Rezeptionshandeln und Lebenszusammenhang
- Wirkung von Geschlechtsrollenstereotypen in den Medien
- Wirkung von Gewaltdarstellung im TV
- Warum existieren diese Unterschiede in der Rezeption von Gewalt bei Frauen und Männern?
- Inhaltsbezogene Faktoren
- Rezipientenbezogene Faktoren
- Weitere Erklärung für Geschlechtsunterschiede in der Wahrnehmung
- Rezeptionsverhalten von Musikvideos
- Schlussfazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit untersucht geschlechtsspezifische Unterschiede in der Medienrezeption. Ziel ist es, bestehende Unterschiede zwischen Frauen und Männern bei der Rezeption von Fernsehsendungen aufzuzeigen und diese im Hinblick auf soziale Probleme kritisch zu hinterfragen. Die Arbeit beleuchtet, ob und inwiefern Medien selbst solche Differenzen hervorrufen.
- Geschlechtsspezifische Unterschiede in der Medienrezeption
- Einfluss von Geschlechtsrollenstereotypen in den Medien
- Wirkung von Gewaltdarstellungen im Fernsehen auf Männer und Frauen
- Relevanz von Involvement-Theorien für die Erklärung geschlechtsspezifischer Rezeption
- Parasoziale Interaktion und Beziehungen im Kontext der Medienrezeption
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema der geschlechtsspezifischen Medienrezeption ein und formuliert die Forschungsfrage nach bestehenden Unterschieden und deren sozialer Relevanz. Sie stellt die These auf, dass Medien selbst solche Differenzen hervorrufen könnten und benennt die Zielsetzung der Arbeit, Unterschiede aufzuzeigen und kritisch zu hinterfragen.
Historischer Überblick: Dieses Kapitel beleuchtet die Entwicklung der feministischen Medienforschung und den späten Fokus auf geschlechtsspezifische Rezeption. Es beschreibt frühere Annahmen, die Unterschiede auf Bildung und politisches Interesse zurückführten, sowie die lange Vernachlässigung des Geschlechts als Variable in der Medienwirkungsforschung. Besonders die Forschungslücke bezüglich Gewaltdarstellung und deren Auswirkungen wird hervorgehoben, und der Beitrag von Forscherinnen wie Christina Holz-Bach und Gertrude Robinson zur Diskussion um die Rolle des Geschlechts wird dargestellt. Der Übergang vom Gleichheits- zum Differenzansatz in der Forschung wird ebenfalls behandelt.
Wirkungstheorien: Dieses Kapitel präsentiert verschiedene Theorien und Mechanismen der Medienwirkungsforschung, die zur Erklärung des Rezeptionsverhaltens herangezogen werden. Es fokussiert auf Theorien, die relevant für die Erklärung geschlechtsspezifischer Rezeptionsunterschiede sind. Besonders wird das Involvement-Modell erläutert, differenziert in kognitives, affektives und konatives Involvement. Die Bedeutung des emotionalen Involvements für die Erklärung geschlechtsspezifischer Unterschiede wird hervorgehoben.
Involvement als Rezeptionsprozess: Dieses Kapitel beschreibt detailliert das Involvement als ein komplexes Modell, welches das frühere Stimulus-Respons-Modell ablöst. Es definiert Involvement als das Ausmaß der individuellen, aktiven, mentalen Auseinandersetzung mit einem Bezugsobjekt und unterscheidet zwischen kognitiven, affektiven und konativen Aspekten. Die Rolle des emotionalen Involvements und die Konzepte der parasozialen Interaktion (PSI) und der parasozialen Beziehung (PSB) werden ausführlich erklärt.
PSI - Parasoziale Interaktion und PSB – parasoziale Beziehung: Der Abschnitt erklärt das Konzept der parasozialen Interaktion, eine scheinbare Interaktion zwischen Rezipient und Medienfigur, und unterscheidet sie von normaler sozialer Interaktion. Die Entwicklung einer parasozialen Beziehung (PSB) aus wiederholter PSI wird beschrieben, und eine Studie von Schramm und Wirth, welche signifikante geschlechtsspezifische Unterschiede im Aufbau parasozialer Beziehungen in Quizshows nachweist, wird erwähnt.
Schlüsselwörter
Geschlechtsspezifische Medienrezeption, Medienwirkung, Wirkungstheorien, Involvement, Parasoziale Interaktion, Parasoziale Beziehung, Geschlechtsrollenstereotypen, Gewaltdarstellung im Fernsehen, Feministische Medienforschung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Seminararbeit: Geschlechtsspezifische Unterschiede in der Medienrezeption
Was ist das Thema der Seminararbeit?
Die Seminararbeit untersucht geschlechtsspezifische Unterschiede in der Medienrezeption. Der Fokus liegt auf den Unterschieden zwischen Frauen und Männern bei der Rezeption von Fernsehsendungen, insbesondere im Hinblick auf Gewaltdarstellungen und den Einfluss von Geschlechtsrollenstereotypen. Die Arbeit hinterfragt kritisch, ob und inwiefern Medien selbst solche Differenzen hervorrufen.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, bestehende geschlechtsspezifische Unterschiede in der Medienrezeption aufzuzeigen und diese im Hinblick auf soziale Probleme kritisch zu hinterfragen. Ein besonderes Augenmerk liegt auf der Rolle der Medien bei der Entstehung und Verstärkung dieser Unterschiede.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themenschwerpunkte: geschlechtsspezifische Unterschiede in der Medienrezeption, Einfluss von Geschlechtsrollenstereotypen, Wirkung von Gewaltdarstellungen im Fernsehen auf Männer und Frauen, Relevanz von Involvement-Theorien und parasoziale Interaktion/Beziehungen im Kontext der Medienrezeption.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in folgende Kapitel: Einleitung, Historischer Überblick, Wirkungstheorien (inkl. Involvement, Emotionen, PSI und PSB), Rezeptionshandeln und Lebenszusammenhang, Wirkung von Geschlechtsrollenstereotypen in den Medien, Wirkung von Gewaltdarstellung im TV, Rezeptionsverhalten von Musikvideos und Schlussfazit.
Welche Theorien werden zur Erklärung der geschlechtsspezifischen Unterschiede herangezogen?
Die Arbeit bezieht verschiedene Wirkungstheorien der Medienwirkungsforschung ein, insbesondere Involvement-Theorien (kognitives, affektives und konatives Involvement). Die Bedeutung des emotionalen Involvements und die Konzepte der parasozialen Interaktion (PSI) und der parasozialen Beziehung (PSB) werden ausführlich erläutert.
Was versteht man unter parasozialer Interaktion (PSI) und parasozialer Beziehung (PSB)?
Parasoziale Interaktion beschreibt eine scheinbare Interaktion zwischen Rezipient und Medienfigur. Eine parasoziale Beziehung entwickelt sich aus wiederholter PSI. Die Arbeit erwähnt eine Studie, die signifikante geschlechtsspezifische Unterschiede im Aufbau parasozialer Beziehungen in Quizshows nachweist.
Wie wird der historische Kontext der Forschung berücksichtigt?
Das Kapitel "Historischer Überblick" beleuchtet die Entwicklung der feministischen Medienforschung und den späten Fokus auf geschlechtsspezifische Rezeption. Es thematisiert frühere Annahmen, die Unterschiede auf Bildung und politisches Interesse zurückführten, sowie die lange Vernachlässigung des Geschlechts als Variable in der Medienwirkungsforschung. Der Übergang vom Gleichheits- zum Differenzansatz wird ebenfalls behandelt.
Welche Rolle spielen Geschlechtsrollenstereotypen und Gewaltdarstellungen?
Die Arbeit untersucht den Einfluss von Geschlechtsrollenstereotypen in den Medien und die Wirkung von Gewaltdarstellungen im Fernsehen auf Männer und Frauen. Sie analysiert, warum Unterschiede in der Rezeption von Gewalt bei Frauen und Männern existieren (inhaltsbezogene und rezipientenbezogene Faktoren).
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Geschlechtsspezifische Medienrezeption, Medienwirkung, Wirkungstheorien, Involvement, Parasoziale Interaktion, Parasoziale Beziehung, Geschlechtsrollenstereotypen, Gewaltdarstellung im Fernsehen, Feministische Medienforschung.
- Quote paper
- Michele Rellstab (Author), 2010, Geschlechtsspezifische Medienrezeption, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/174336