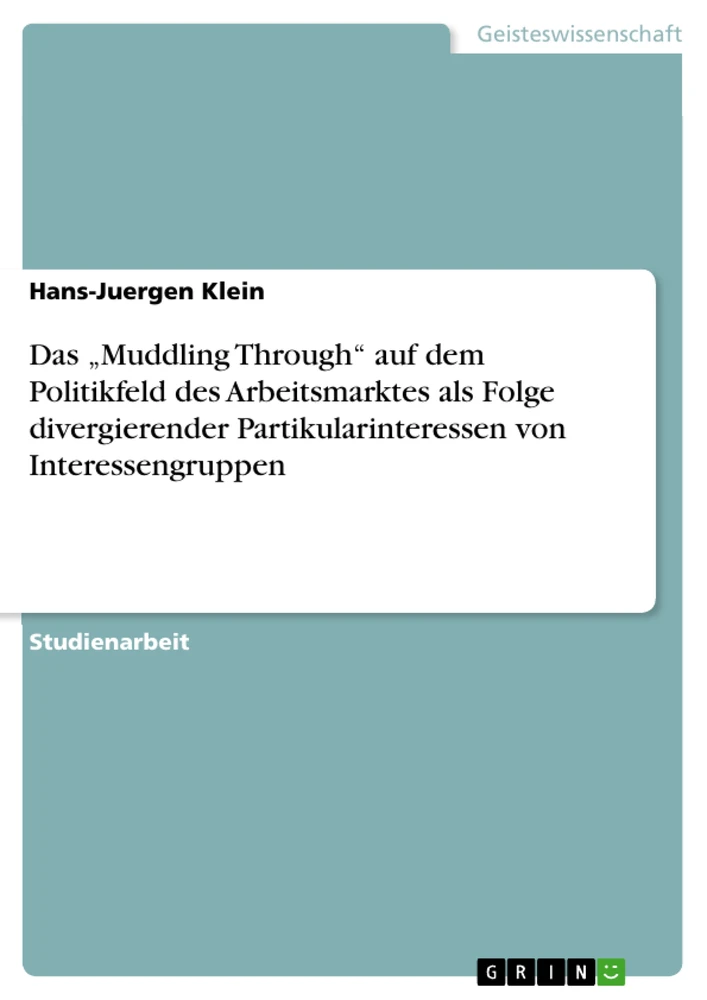In vielen Artikeln werden u.a. die Konsequenzen der Globalisierung als Grund angeführt, warum die deutschen Arbeitsmarktgesetze einer permanenten An-passung unterliegen. Die Gefahr der Produktionsverlagerung und dass Deutschland den Ruf als Exportnation verlieren könnte sind in diesem Kontext häufig genannte Gründe. Dieser ökonomische Druck zwingt Deutschland Reformen durchzuführen, um Wettbewerbsfähig zu bleiben. Reformen in Demokratien vollziehen sich jedoch nur evolutionär, d.h. sie sind nicht zu revolutionären Veränderungen fähig, da die davon betroffenen Akteure politischen Widerstand leisten. Am Fallbeispiel der Umsetzung der Gesetze zur Reform des Arbeitsmarktes (auch Hartz-I bis Hartz-IV-Gesetze genannt) werden die Ursachen für die evolutionären Veränderun-gen dargelegt und analysiert.
Inhaltsverzeichnis
- A. Einleitende Gedanken
- A.1 Beleuchtung des verfassungsmäßigen Auftrags zur Sozialpolitik
- A.2 Skizzierung der Entwicklungsphasen der Sozialpolitik in Deutschland
- A.3 Problemstellung und Hypothesenentwicklung
- A.4 Darlegung des Aufbaus der Analyse
- A.5 Definition der Leitbegriffe „Entscheidung“ und „Inkrementalismus“
- B. Hauptteil
- B.1 Aufbau des theoretischen Rahmens
- B.1.1 Inkrementalismus
- B.1.1.1 Darstellung und Zusammenfassung der Indikatoren des „Muddling Through“ von Lindblom, Popper und Scott
- B.1.1.2 Die Bedeutung von „Output“ und „Outcome“ im Kontext vom „Muddling Through“
- B.1.2 Erarbeitung des Governance-Bezugsrahmens
- B.1.2.1 Beschreibung der Merkmale eines Policy-Feldes insbesondere des Aufbaus und der Funktion eines Policy-Netzwerks
- B.1.2.2 Präsentation der zentralen Akteure im Policy-Feld der Arbeitsmarktpolitik und Herausarbeitung der Handlungsorientierung der politischen Parteien
- B.1.2.3 Verknüpfung der ökonomischen Theorien der Demokratie mit den Handlungsorientierungen der politischen Parteien im Policy-Feld der Arbeitsmarktpolitik
- B.2 Entwicklung des Policy-Rahmens unter Berücksichtigung des Konzepts und der Gesetze für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt
- B.2.1 Die wesentlichen Inhalte des „Hartz-Konzepts“
- B.2.2 Die Wirkungen der Hartz-Gesetze im Policy-Feld „Arbeitsmarkt“
- B.2.3 Wirkungen der Hartz-Gesetze in der Gesellschaft
- B.2.4 Resümee
- B.3 Analyse-Teil
- B.3.1 Entwicklung der Parteienlandschaft und der Regierungskonstellationen von 2002 bis 2011
- B.3.2 Analyse der durchgeführten Veränderungen an den Hartz-Gesetzen innerhalb der verschiedenen Regierungsperioden
- B.4 Fazit im Hinblick auf „Muddling Through“
- C. Abschließende Gedanken
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die arbeitsmarktpolitischen Reformen in Deutschland seit 2002, insbesondere die Hartz-Gesetze, unter dem Blickwinkel des „Muddling Through“. Ziel ist es, die evolutionäre Entwicklung dieser Reformen als Folge divergierender Partikularinteressen verschiedener Interessengruppen zu analysieren. Die Arbeit beleuchtet die komplexen Zusammenhänge zwischen ökonomischen Zwängen, sozialpolitischen Zielen und dem politischen Entscheidungsprozess.
- Der Einfluss divergierender Interessen von Akteuren auf die Gestaltung der Arbeitsmarktpolitik.
- Die Rolle des „Muddling Through“ als Erklärungsmodell für die evolutionäre Entwicklung der Hartz-Gesetze.
- Die Verknüpfung von ökonomischen und sozialen Zielen in der deutschen Sozial- und Arbeitsmarktpolitik.
- Die Auswirkungen der Hartz-Reformen auf den Arbeitsmarkt und die Gesellschaft.
- Die Bedeutung von Regierungswechseln und Parteiprogrammen für die Gestaltung der Arbeitsmarktpolitik.
Zusammenfassung der Kapitel
A. Einleitende Gedanken: Dieser einführende Teil beleuchtet den verfassungsmäßigen Auftrag zur Sozialpolitik in Deutschland, skizziert die Entwicklungsphasen der Sozialpolitik, formuliert die Problemstellung und die Hypothesen der Arbeit und definiert die zentralen Begriffe „Entscheidung“ und „Inkrementalismus“. Der Fokus liegt auf dem Spannungsfeld zwischen ökonomischen und sozialen Zielen sowie der Komplexität des Entscheidungsprozesses im Kontext der Arbeitsmarktpolitik. Die Arbeit argumentiert, dass die evolutionäre Entwicklung der Arbeitsmarktpolitik, besonders im Zusammenhang mit den Hartz-Gesetzen, durch das Modell des „Muddling Through“ erklärt werden kann. Die Einleitung präsentiert den konzeptionellen Rahmen der folgenden Analyse.
B. Hauptteil: Der Hauptteil gliedert sich in die Erarbeitung eines theoretischen Rahmens, der die Konzepte des Inkrementalismus und des Governance-Ansatzes umfasst. Dabei werden insbesondere die Indikatoren des „Muddling Through“ nach Lindblom, Popper und Scott diskutiert, und der Zusammenhang zwischen Output und Outcome im Kontext des „Muddling Through“ wird beleuchtet. Der Abschnitt widmet sich der Entwicklung des Policy-Rahmens, der die Hartz-Gesetze und ihre Wirkungen im Policy-Feld „Arbeitsmarkt“ sowie deren gesellschaftlichen Auswirkungen beinhaltet. Der Analyse-Teil untersucht die Entwicklung der Parteienlandschaft und der Regierungskonstellationen seit 2002 und analysiert die Veränderungen der Hartz-Gesetze über verschiedene Regierungsperioden hinweg. Der Hauptteil bietet eine detaillierte Analyse der verschiedenen Einflussfaktoren auf die Entwicklung der Arbeitsmarktpolitik. Er verbindet theoretische Konzepte mit empirischen Beobachtungen der Hartz-Reformen.
Schlüsselwörter
Muddling Through, Inkrementalismus, Arbeitsmarktpolitik, Hartz-Gesetze, Sozialpolitik, Governance, Policy-Netzwerk, Interessengruppen, politische Parteien, Deutschland, ökonomische Theorien der Demokratie, Sozialer Bundesstaat.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Analyse der Hartz-Gesetze
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese wissenschaftliche Arbeit analysiert die arbeitsmarktpolitischen Reformen in Deutschland seit 2002, insbesondere die Hartz-Gesetze. Der Fokus liegt auf der Untersuchung der evolutionären Entwicklung dieser Reformen unter dem Blickwinkel des „Muddling Through“, also der schrittweisen, inkrementellen Entscheidungsfindung.
Welche Forschungsfrage wird gestellt?
Die Arbeit untersucht, inwieweit die evolutionäre Entwicklung der Hartz-Gesetze als Folge divergierender Partikularinteressen verschiedener Interessengruppen erklärt werden kann und welche Rolle das „Muddling Through“-Modell dabei spielt.
Welche theoretischen Konzepte werden verwendet?
Die Analyse basiert auf den Konzepten des Inkrementalismus („Muddling Through“ nach Lindblom, Popper und Scott) und des Governance-Ansatzes. Dabei werden die Indikatoren des „Muddling Through“, der Zusammenhang zwischen Output und Outcome sowie die Rolle verschiedener Akteure im Policy-Netzwerk der Arbeitsmarktpolitik berücksichtigt.
Welche Akteure werden in der Analyse betrachtet?
Die Arbeit analysiert die Rolle verschiedener Akteure im Policy-Feld der Arbeitsmarktpolitik, einschließlich politischer Parteien, Interessengruppen und der beteiligten Ministerien. Der Einfluss divergierender Interessen auf die Gestaltung der Arbeitsmarktpolitik wird untersucht.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in einen einführenden Teil, einen Hauptteil und einen schlussfolgernden Teil. Der Hauptteil umfasst die Erarbeitung des theoretischen Rahmens, die Entwicklung des Policy-Rahmens (einschließlich der Hartz-Gesetze und ihrer Auswirkungen), eine Analyse der Entwicklung der Parteienlandschaft und der Regierungskonstellationen seit 2002 sowie eine Analyse der Veränderungen an den Hartz-Gesetzen in verschiedenen Regierungsperioden.
Welche methodischen Ansätze werden angewendet?
Die Arbeit kombiniert die Anwendung des „Muddling Through“-Modells als Erklärungsansatz mit einer empirischen Analyse der Entwicklung der Hartz-Gesetze und der beteiligten Akteure. Es wird eine Verbindung zwischen theoretischen Konzepten und empirischen Beobachtungen hergestellt.
Welche Ergebnisse werden präsentiert?
Die Arbeit präsentiert eine detaillierte Analyse der verschiedenen Einflussfaktoren auf die Entwicklung der Arbeitsmarktpolitik und zeigt auf, wie die Hartz-Gesetze im Kontext des „Muddling Through“ entstanden und sich im Laufe der Zeit entwickelt haben. Die Auswirkungen der Reformen auf den Arbeitsmarkt und die Gesellschaft werden ebenfalls beleuchtet.
Welche Schlussfolgerungen werden gezogen?
Die Schlussfolgerungen der Arbeit beziehen sich auf die Erklärungskraft des „Muddling Through“-Modells für die evolutionäre Entwicklung der Hartz-Gesetze und auf die Bedeutung divergierender Interessen verschiedener Akteure für die Gestaltung der deutschen Arbeitsmarktpolitik.
Welche Schlüsselbegriffe sind relevant?
Schlüsselbegriffe sind: Muddling Through, Inkrementalismus, Arbeitsmarktpolitik, Hartz-Gesetze, Sozialpolitik, Governance, Policy-Netzwerk, Interessengruppen, politische Parteien, Deutschland, ökonomische Theorien der Demokratie, Sozialer Bundesstaat.
- Quote paper
- B.A. "Politik- und Verwaltungswissenschaft" und Dipl.-Betrw. FH Hans-Juergen Klein (Author), 2011, Das „Muddling Through“ auf dem Politikfeld des Arbeitsmarktes als Folge divergierender Partikularinteressen von Interessengruppen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/174385