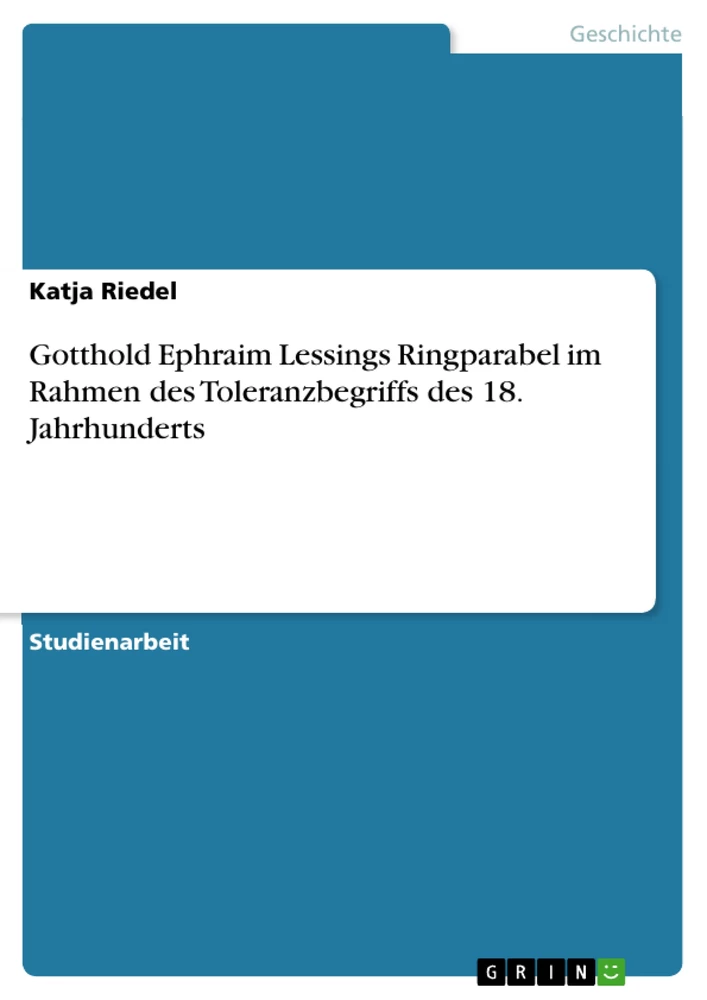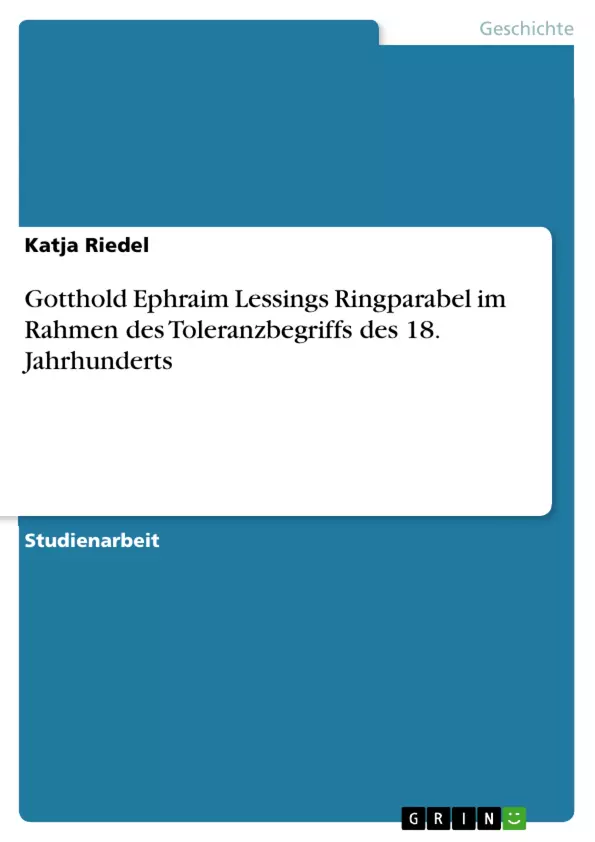Die religiöse Toleranzdebatte war in jeder Epoche allgegenwärtig. So auch im 18. Jahrhundert. Neben dem allgemeinen Verständnis von Toleranz als Duldung des Andersartigen, war eine kritische Auseinandersetzung mit der christlichen Religion und ihrem Toleranzverständnis angesichts zahlreicher Glaubenskonflikte und religiöser Verfolgungen von hoher Relevanz. Die Ringparabel von Gotthold Ephraim Lessing gilt als Paradebeispiel für den Kampf gegen die Intoleranz und die Schaffung einer religiösen Toleranz. Was beinhaltet der durch die Ringparabel transportierte Toleranzbegriff? Was sind die zentralen Inhalte des Toleranzbegriffs des 18. Jahrhunderts? Inwieweit deckt sich die Auffassung von Toleranz der Ringparabel mit den allgemeinen Ansichten des 18. Jahrhunderts und dem Toleranzbegriff bedeutender Vertreter der Aufklärung? Ziel dieser Arbeit wird es sein, diese Fragen zu klären.
Inhaltsverzeichnis (Table of Contents)
- 1. Einführung in das Thema
- 2. Toleranzbegriff im 18. Jahrhundert
- 2.1. Die französische Enzyklopädie
- 2.2. Voltaire
- 3. Lessings Ringparabel
- 3.1. Nathan der Weise
- 3.2. Vorläufer der Ringparabel
- 3.3. Toleranzbegriff in Lessings Ringparabel
- 4. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte (Objectives and Key Themes)
Diese Arbeit untersucht den Toleranzbegriff in Gotthold Ephraim Lessings Ringparabel im Kontext des 18. Jahrhunderts. Sie analysiert, wie Lessings Konzept von Toleranz mit den allgemeinen Ansichten der Aufklärung und den Ansichten bedeutender Vertreter wie der französischen Enzyklopädie und Voltaire übereinstimmt. Der Schwerpunkt liegt auf der Erläuterung der Ringparabel und ihrer zentralen Botschaften im Hinblick auf Toleranz.
- Der Toleranzbegriff im 18. Jahrhundert und seine Entwicklung
- Die Ringparabel als exemplarisches Beispiel für den Kampf gegen Intoleranz
- Der Vergleich von Lessings Toleranzkonzept mit dem der Aufklärung
- Die Rolle der französischen Enzyklopädie und Voltaire in der Toleranzdebatte
- Die Bedeutung der Ringparabel für das Verständnis von Toleranz
Zusammenfassung der Kapitel (Chapter Summaries)
Die Einleitung führt in das Thema der religiösen Toleranzdebatte im 18. Jahrhundert ein und stellt Lessings Ringparabel als zentrales Beispiel für den Kampf gegen Intoleranz vor.
Kapitel 2 beleuchtet den Toleranzbegriff im 18. Jahrhundert. Es werden die wichtigsten Auffassungen des Toleranzbegriffs dargestellt und Beispiele aus der französischen Enzyklopädie und von Voltaire aufgezeigt.
Kapitel 3 konzentriert sich auf Lessings Ringparabel. Es wird die Entstehungsgeschichte und Handlung von "Nathan der Weise" sowie die Vorläufer der Ringparabel skizziert. Der Schwerpunkt liegt auf dem Toleranzbegriff in der Ringparabel.
Schlüsselwörter (Keywords)
Die Arbeit beschäftigt sich mit zentralen Begriffen wie Toleranz, Aufklärung, Ringparabel, "Nathan der Weise", Gotthold Ephraim Lessing, Voltaire, französische Enzyklopädie, christlicher Glaube, religiöse Verfolgung und Intoleranz. Es werden die unterschiedlichen Auffassungen von Toleranz in der Aufklärung und im 18. Jahrhundert erörtert.
Häufig gestellte Fragen
Was ist die Kernaussage von Lessings Ringparabel?
Die Parabel besagt, dass keine Religion ihren absoluten Wahrheitsanspruch beweisen kann; stattdessen soll sich jede durch tugendhaftes Handeln und Liebe als die „echte“ erweisen.
In welchem Werk ist die Ringparabel enthalten?
Sie ist das Kernstück von Lessings dramatischem Gedicht „Nathan der Weise“, das 1779 erschien.
Wie definierte das 18. Jahrhundert den Begriff Toleranz?
Toleranz wurde primär als Duldung des Andersartigen verstanden, entwickelte sich in der Aufklärung aber hin zu einer aktiven Anerkennung religiöser Vielfalt.
Welche Rolle spielten Voltaire und die französische Enzyklopädie?
Beide waren Wegbereiter der Toleranzdebatte, indem sie religiösen Fanatismus kritisierten und die Vernunft als Maßstab für das Zusammenleben forderten.
Gibt es Vorläufer der Ringparabel?
Ja, das Motiv der drei Ringe findet sich bereits in älteren Quellen wie Boccaccios „Decamerone“, wurde aber von Lessing entscheidend um den Aspekt des Wettbewerbs in der Tugend erweitert.
- Quote paper
- Katja Riedel (Author), 2011, Gotthold Ephraim Lessings Ringparabel im Rahmen des Toleranzbegriffs des 18. Jahrhunderts, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/174400