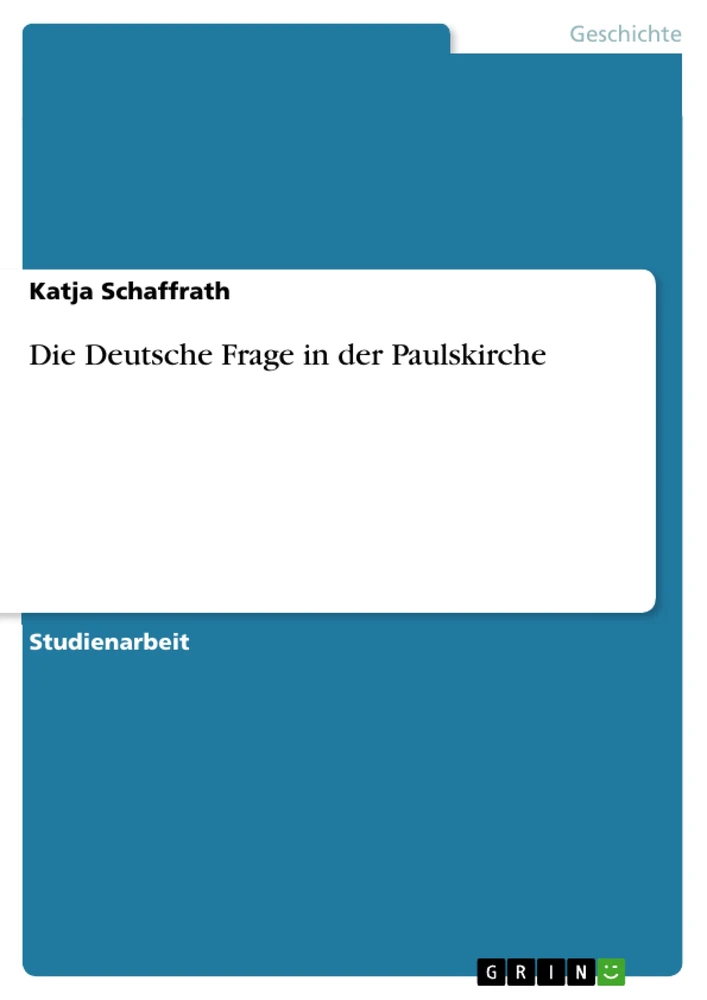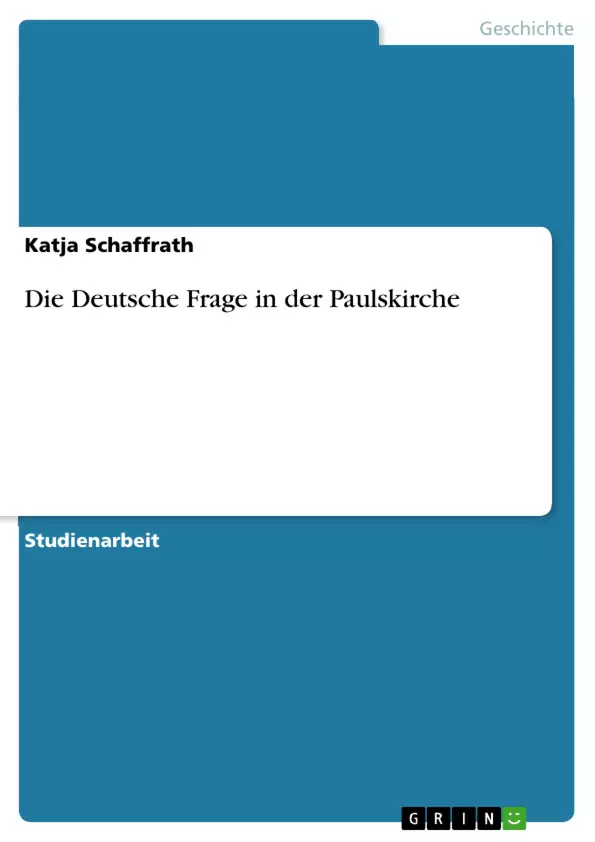Mit der Revolution 1848 wurden unter anderem Forderungen nach einer einheitlichen deutschen Nationalversammlung laut. Weitere Märzforderungen von 1848 waren zudem eine demokratische Verfassung, Versammlungsfreiheit und ein einheitlicher deutscher Nationalstaat. Die Folge daraus war, dass die gewählte Nationalversammlung im Mai 1848 erstmals in der Frankfurter Paulskirche zusammentrat. Ihre Aufgabe war es vor allem, eine demokratische Verfassung auszuarbeiten. In dieser Verfassung musste vor allem festgelegt werden, auf welches Staatsgebiet sie sich bezieht und für wen sie denn eigentlich gilt.
Das Ziel dieser Arbeit wird es sein, die Frage nach dem Gebiet der Deutschen Nation zu klären. Wer gehörte der Deutschen Nation an und welche Kriterien gab es zu ihr zu gehören? Die Schwerpunkte liegen dabei auf der Klärung der Schleswig-Frage, auf dem polnisch besiedelten Posen, auf Oberitalien und Limburg, auf Böhmen und Mähren, aber auch auf der Habsburger Monarchie im Allgemeinen. Sollte ein groß- oder ein kleindeutsches Reich ausgebildet werden? Es steht also die Frage im Raum, wie groß man sich dieses Reich vorstellte und welche Nationen vertreten sein sollten. Verschiedene Nationalitäten waren ja genügend vorhanden, schon allein wegen dem Vielvölkerstaat der Habsburger Monarchie.
Zudem ist es auch interessant zu erfahren welche Interessen vorwiegend vertreten wurden und wie auch diese verteidigt wurden. Wie wurde auf Minderheiten reagiert?
Ganz allgemein soll diese Arbeit den Umgang mit politischen Krisen aufzeigen und die Probleme einer Nationsbildung verdeutlichen.
Inhaltsverzeichnis
- Einführung
- Was ist des Deutschen Vaterland?
- Beweggründe und Ziele
- Die Gebiete
- Schleswig
- Posen
- Böhmen und Mähren
- Oberitalien
- Limburg
- Österreich
- Resümee
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Frage nach dem Gebiet der Deutschen Nation während der Revolution von 1848. Sie analysiert, wer zur Deutschen Nation gehörte und welche Kriterien für die Zugehörigkeit galten. Dabei stehen die Debatten um Schleswig, Posen, Oberitalien, Limburg, Böhmen und Mähren sowie die Rolle der Habsburger Monarchie im Vordergrund. Die Arbeit untersucht, wie groß sich das Deutsche Reich vorstellen ließ und welche Nationen darin vertreten sein sollten, sowie die Interessenvertretung und den Umgang mit Minderheiten während der Revolution. Sie zeigt auf, wie politische Krisen bewältigt wurden und welche Herausforderungen die Nationsbildung mit sich brachte.
- Definition der Deutschen Nation im Kontext der Revolution von 1848
- Die Territorialfrage: Einigung oder Teilung Deutschlands
- Der Umgang mit Minderheiten und die Interessenvertretung verschiedener Nationalitäten
- Die Rolle der Habsburger Monarchie in der deutschen Nationalbewegung
- Die Herausforderungen der Nationsbildung und der Umgang mit politischen Krisen
Zusammenfassung der Kapitel
Einführung
Die Arbeit beleuchtet die Anfänge der deutschen Nationalbewegung im Zuge der Revolution von 1848. Sie stellt die wichtigsten Forderungen der Revolutionäre vor, darunter die Forderung nach einer einheitlichen deutschen Nationalversammlung, einer demokratischen Verfassung und einem einheitlichen deutschen Nationalstaat. Die Arbeit konzentriert sich auf die Frage nach dem Staatsgebiet der Deutschen Nation und die Kriterien der Zugehörigkeit.
Was ist des Deutschen Vaterland?
Dieses Kapitel beschäftigt sich mit den Beweggründen und Zielen der deutschen Nationalbewegung. Es erläutert die Schwierigkeiten bei der Festlegung des Begriffs „Nation“ und die Herausforderungen, die sich aus der Umformung des Deutschen Bundes in einen Nationalstaat ergaben. Es analysiert die Konflikte mit anderen Nationen, die sich aus dem Streben nach nationaler Einheit ergaben, sowie die Rolle der Habsburger Monarchie als Vielvölkerstaat.
Die Gebiete
Dieses Kapitel befasst sich mit verschiedenen Regionen, deren Zugehörigkeit zur Deutschen Nation während der Revolution umstritten war. Es beleuchtet den Konflikt zwischen Dänemark und Deutschland um die Herzogtümer Schleswig und Holstein, die Debatte um das polnisch besiedelte Posen, die Frage nach der Zugehörigkeit Oberitaliens und Limburgs zum Deutschen Reich sowie die Rolle der Habsburger Monarchie in der deutschen Nationalbewegung.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den zentralen Themen der deutschen Nationalbewegung während der Revolution von 1848. Zu den zentralen Begriffen gehören Deutsche Nation, Nationalstaat, Nation, Nationalversammlung, Verfassung, Habsburger Monarchie, Schleswig, Posen, Oberitalien, Limburg, Böhmen, Mähren, Minderheiten, Interessenvertretung, politische Krisen, Nationsbildung, und Territorialfrage.
Häufig gestellte Fragen
Was war die "Deutsche Frage" in der Paulskirche?
Die Kernfrage war, welches Staatsgebiet ein künftiger deutscher Nationalstaat umfassen sollte und wer zur deutschen Nation gehört.
Was ist der Unterschied zwischen der großdeutschen und kleindeutschen Lösung?
Die großdeutsche Lösung sah ein Reich unter Einschluss Österreichs vor, während die kleindeutsche Lösung Österreich ausschloss.
Welche Rolle spielte die Schleswig-Frage?
Es ging um den territorialen Konflikt mit Dänemark um die Zugehörigkeit der Herzogtümer Schleswig und Holstein zum deutschen Nationalstaat.
Wie ging die Nationalversammlung mit Minderheiten um?
Die Arbeit untersucht die Debatten über Regionen wie Posen, Böhmen und Oberitalien und den Umgang mit den dort lebenden nicht-deutschen Nationalitäten.
Was waren die Hauptforderungen der Revolution von 1848?
Zu den Märzforderungen gehörten eine demokratische Verfassung, Versammlungsfreiheit und die Gründung eines einheitlichen Nationalstaats.
- Quote paper
- Katja Schaffrath (Author), 2007, Die Deutsche Frage in der Paulskirche, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/174413