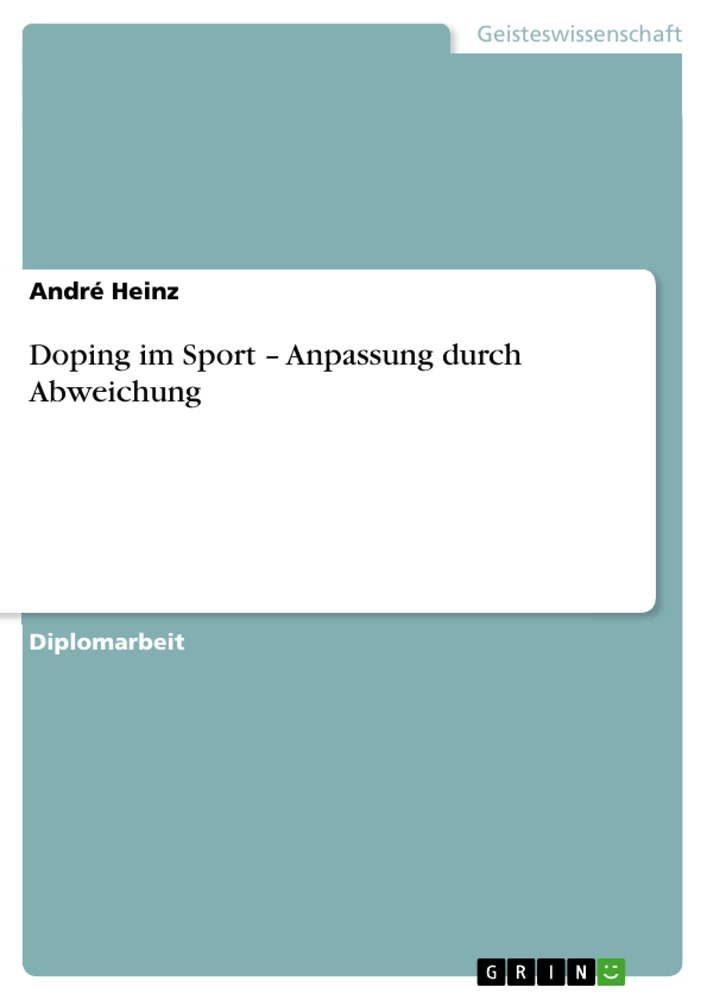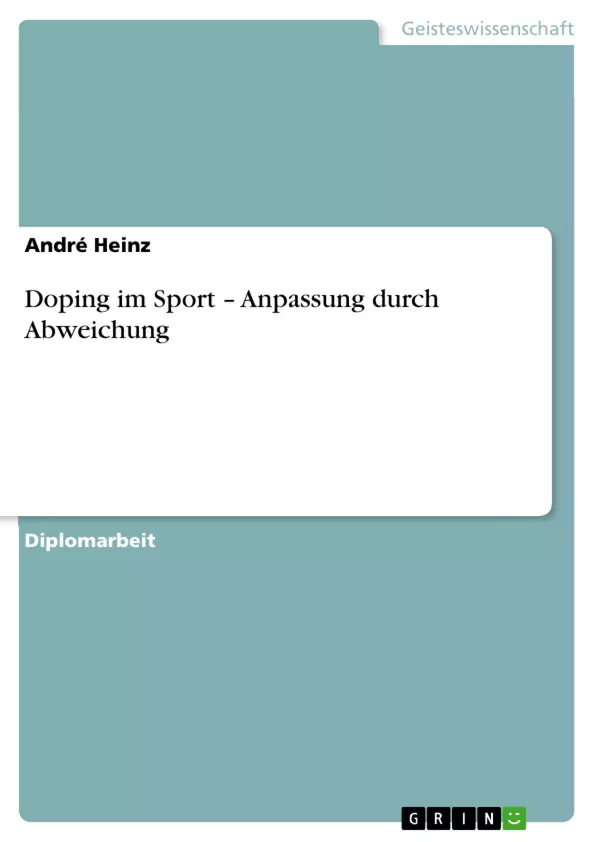Am 9. Juli 1998 wurde Willy Voet, Masseur und Betreuer des Radrennteams „Festina“, an der französisch-belgischen Grenze von Zollbeamten gestoppt. Sein Firmenwagen wurde durchsucht, und es wurden 80 Ampullen Wachstumshormone, 234 Fläschchen Erythropoietin, 160 Einheiten Testosteron und diverse andere Dopingmittel gefunden.
Voet war auf dem Weg zu seinem Team, das an der berühmten und zugleich berüchtigten „Tour de France“ teilnahm. Die nachfolgenden Untersuchungen der französischen Justiz brachten einen Skandal ans Licht, der die Dopingvorfälle aus den letzten Jahrzehnten in den Schatten stellte.
Im Profi-Team „Festina“ wurde systematisch und flächendeckend gedopt. Fast ausnahmslos alle Fahrer erhielten die Dopingmittel, die sie benötigten. Die Beschaffung und Dosierung wurde vom Mannschaftsarzt Dr. Erik Rijckaert kontrolliert. Beim Transport half unter anderem Willy Voet. Die Teamleitung mit Bruno Roussel als Teamchef förderte und unterstützte dieses Vorgehen.
Damit wurde nicht nur eine „Spitze des Eisberges“ offengelegt, sondern es wurde zum ersten Mal erkennbar, wie Doping im Sport funktionieren kann und wie weit verbreitet dieses Phänomen tatsächlich ist.
Der Fall „Festina“ war nicht der erste Dopingskandal in der Geschichte des Sports, und er war auch nicht der letzte. Doping ist kein neues Phänomen, sondern eine soziale Tatsache, die seit der Entstehung des modernen Sports existiert.
In den letzten Jahrzehnten gab es kaum ein großes Sportereignis, das nicht von Dopingfällen überschattet worden ist. Fast täglich kann man in die Tageszeitungen schauen und entdeckt Meldungen über Athleten, Trainer, Mediziner und Funktionäre, die in einem Zusammenhang mit Doping stehen. Verstärkte Kontrollen, alarmierende Appelle an das Sportlergewissen oder Verweisungen auf den olympischen Gedanken konnten das Problem nicht eindämmen.
Dabei ist kaum abzusehen, wie groß der Schaden ist, den das Doping anrichtet. Die Autorität und Autonomie, die der Sport von der Gesellschaft erhalten hat und das Vertrauen, das der Sport genießt, um seinen sozialen Auftrag zu erfüllen, sind bedroht. Es besteht also Handlungsbedarf.
Das Phänomen Doping erweist sich als eine sehr komplexe Tatsache, welche präzise erfasst und analysiert werden muss. Simple Ursache-Wirkung-Formeln sind hier genauso unangebracht, wie einzelne Personalisierungen (meist von den Massenmedien produziert), die das Doping als Verfehlung von wenigen Personen beschreiben. [...]
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Zur Methode
- 3. Begriffsbestimmung des Untersuchungsgegenstands
- 3.1 Probleme der Definition des Sportsystems
- 3.2 Doping als abweichendes Verhalten
- 4. Systemtheoretische Überlegungen
- 4.1 Sport als gesellschaftliches Teilsystem
- 4.2 Der Sieg/Niederlage-Code im Sport
- 4.3 Der Sieggedanke beim Sportler
- 5. Doping und strategische Rationalität
- 5.1 Zur Theorie rationalen Handelns
- 5.2 Der Sportler als „,REMM“
- 5.3 Das Gefangenendilemma-Spiel
- 5.3.1 Doping als strategisches Spiel
- 5.3.2 Ein weiteres Dilemma: Informationsdefizit
- 5.3.3 Exkurs: Vertrauen
- 5.4 Self-fulfilling prophecy
- 5.5 Biographische Bestimmung
- 5.6 Doping in der Realität des Hochleistungssports
- 6. Auswege aus dem Dilemma?
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht das Phänomen Doping im Sport aus soziologischer Perspektive. Ziel ist es, die Strukturen und Mechanismen aufzudecken, die zu Doping im Sport führen. Dabei wird analysiert, warum der Sportler zu Dopingmitteln greift und welche Folgen dies für das Sportsystem hat.
- Doping als abweichendes Verhalten im Sportsystem
- Systemtheoretische Analyse des Sports als gesellschaftliches Teilsystem
- Strategische Rationalität und das Gefangenendilemma im Kontext von Doping
- Die Rolle von Vertrauen und Informationsdefizit bei Dopingentscheidungen
- Die Institutionalisierung von Doping im Hochleistungssport
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1: Einleitung
Die Arbeit beginnt mit einem aktuellen Beispiel, dem Fall „Festina“, um die Relevanz des Themas Doping im Sport zu verdeutlichen. Es wird auf die weitverbreitete Praxis des Dopings und die damit verbundenen ethischen und gesellschaftlichen Probleme hingewiesen. - Kapitel 2: Zur Methode
Hier wird die methodische Herangehensweise der Arbeit erläutert. Es wird argumentiert, dass eine Kombination aus Systemtheorie und Rational Choice Theorie geeignet ist, das komplexe Phänomen Doping zu analysieren. - Kapitel 3: Begriffsbestimmung des Untersuchungsgegenstands
Dieses Kapitel beschäftigt sich mit der Definition von Doping und analysiert die Schwierigkeiten, die mit der Definition des Sportsystems verbunden sind. Doping wird als abweichendes Verhalten im Kontext des Sportsystems verstanden. - Kapitel 4: Systemtheoretische Überlegungen
In diesem Kapitel wird das Sportsystem als gesellschaftliches Teilsystem betrachtet. Der Sieg/Niederlage-Code im Sport und die Bedeutung des Sieggedankens für den Sportler werden analysiert. - Kapitel 5: Doping und strategische Rationalität
Hier werden die Theorien des rationalen Handelns und des Gefangenendilemmas auf Doping im Sport angewendet. Der Sportler wird als „REMM“ (rationaler Egoist mit Maximierungsmotivation) betrachtet. Es werden die strategischen Überlegungen des Sportlers im Kontext von Doping sowie die Rolle von Informationsdefizit und Vertrauen untersucht. - Kapitel 6: Auswege aus dem Dilemma?
Dieses Kapitel befasst sich mit möglichen Lösungen für das Dopingproblem im Sport. Es werden verschiedene Ansätze diskutiert, um die Ausbreitung des Dopings einzudämmen.
Schlüsselwörter
Doping, Sport, Sportsystem, Systemtheorie, Rational Choice, Gefangenendilemma, Vertrauen, Informationsdefizit, strategisches Handeln, abweichendes Verhalten, Hochleistungssport, Institutionalisierung.
Häufig gestellte Fragen
Warum wird Doping als „abweichendes Verhalten“ bezeichnet?
Aus soziologischer Sicht verstößt Doping gegen die institutionalisierten Regeln des Sportsystems, wird aber oft durch den extremen Leistungsdruck provoziert.
Was war der Festina-Skandal von 1998?
Ein massiver Dopingskandal bei der Tour de France, bei dem flächendeckendes, systematisches Doping innerhalb eines Profi-Radteams aufgedeckt wurde.
Was erklärt das Gefangenendilemma im Kontext von Doping?
Es beschreibt die Situation, in der ein Sportler dopt, weil er befürchtet, dass seine Konkurrenten es auch tun und er ohne Doping keine Siegchance mehr hätte.
Was bedeutet der Sieg/Niederlage-Code im Sport?
In der Systemtheorie ist dies der zentrale Code des Sports; alles Handeln ist darauf ausgerichtet, einen Sieg zu erringen, was den Druck zur Leistungssteigerung massiv erhöht.
Was ist ein „REMM“ in der Soziologie?
REMM steht für „Resourceful, Evaluative, Maximizing Man“ und beschreibt einen Akteur, der rational handelt, um seinen eigenen Nutzen (z. B. Erfolg) zu maximieren.
Können verstärkte Kontrollen das Dopingproblem allein lösen?
Die Arbeit stellt infrage, ob Kontrollen ausreichen, da Doping oft eine strukturelle Folge der Logik des Hochleistungssports ist und nicht nur ein individuelles Fehlverhalten.
- Arbeit zitieren
- Diplom-Sozialwissenschaftler André Heinz (Autor:in), 2002, Doping im Sport – Anpassung durch Abweichung, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/174464