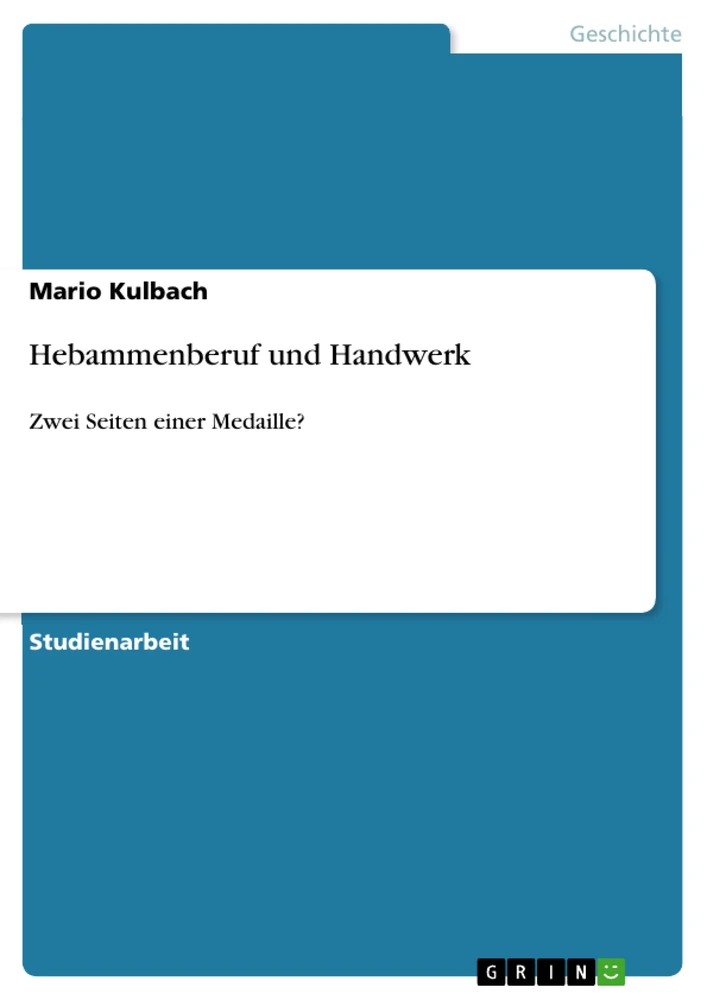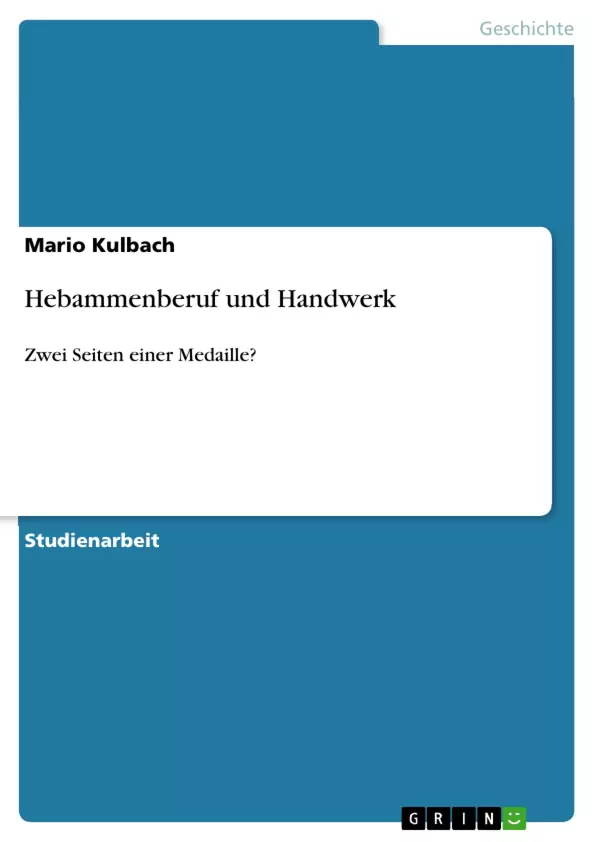Wenn man sich die Frage nach der Verortung der Hebammenarbeit als einer handwerklichen Tätigkeit stellt, würde man im Sinne Sennetts zu dem Schluss kommen, Hebammen als Handwerker zu bezeichnen. In diesem Beruf spielen Disziplin, Selbstreflexion, die Orientierung an standardisierten Heilverfahren, sowie das Streben nach Qualität im höchsten Maße eine zentrale Rolle. Zudem rief der Deutsche Hebammenverband (DHV) im Jahr 2010 unter dem Motto „Hebammen in Not – Rettet unser Handwerk“ zu bundesweiten Demonstrationen gegen die mittlerweile horrenden Haftpflichtversicherungsbeiträge für selbstständige Hebammen auf und bezeichnete in diesem Kontext den Beruf der Hebamme als Handwerk . Dennoch wurde das Hebammengewerbe nicht in die Handwerksrollen der jeweiligen Handwerkskammern aufgenommen, und gilt somit nach heutigem Verständnis nicht als Handwerk. Wie ist es zu erklären, dass ein Beruf der existenziell von seiner Handarbeit abhängt und der der obigen Handwerksdefinition zu entsprechen scheint, nicht als Handwerk deklariert wird? Für die Beantwortung dieser Frage lohnt sich der Blick in die Anfänge der Professionalisierung des Hebammenberufs ab dem 15. Jh. In diesem Zusammenhang wird nach der Mentalität der Menschen der Frühen Neuzeit, aber auch den berufsspezifischen, strukturellen Eigenarten von Hebammen und Handwerkern zu fragen sein.
In diesem Zusammenhang wird ein definitorischer Zugang, nach dem Motto „Was ist Handwerk?“, „Was ist Hebammenarbeit?“ und „Wo liegen demnach die Unterschiede?“, angeboten. Es werden darauf aufbauend grundlegende strukturelle Unterschiede und Gemeinsamkeiten dieser Berufsgruppen in den Blick genommen, jedoch sollen diese nicht als einzige Argumente für eine Trennung von Handwerk und Hebammerei angeführt werden. Vielmehr wird auf einen soziologisch-gesellschaftlichen Aspekt verwiesen werden. Was Hebammen die Etablierung eines eigenen beruflichen Zweiges erschwerte, lag u.a. an den geschaffenen Strukturen (z.B. Zunftzugehörigkeit), aber auch am vorherrschenden patriarchalischen System des 15./16. Jh. Eine These, die hier vertreten werden soll, lautet, dass eine Dominanz des männlichen Geschlechts in der Frühen Neuzeit dazu führte, Frauen eine berufliche Teilhabe zu erschweren. Im besonderen Fall galt dies für Hebammen, die sich in dieser Zeit zu professionalisieren begannen und ihr Wissen nicht mehr nur ihren Töchtern weitergaben, sondern sog. „Lehrtöchter“ ausbildeten . [...]
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Hebammen und andere Heilsberufe in der Frühen Neuzeit
- Handwerker in der Frühen Neuzeit
- Hebammenberuf und Handwerk - Zwei Seiten einer Medaille?
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit analysiert die Entstehung des Hebammenberufs in der Frühen Neuzeit im Kontext des Handwerks. Sie untersucht die spezifischen Merkmale und strukturellen Eigenarten beider Berufsfelder und beleuchtet die Frage, warum das Hebammengewerbe trotz seiner Handwerkscharakteristik nicht als Handwerk anerkannt wurde.
- Entwicklung des Hebammenberufs in der Frühen Neuzeit
- Strukturelle Merkmale und Eigenarten des Handwerks in der Frühen Neuzeit
- Die Rolle des patriarchalen Systems in der Berufsetablierung von Frauen
- Gender-Aspekte und die Ausgrenzung von Frauen aus handwerklichen Berufen
- Die Bedeutung von christlichen und religiösen Perspektiven für die Unterscheidung zwischen männlichem "Herstellen" und weiblichem "Austragen"
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Das erste Kapitel stellt die These auf, dass der Hebammenberuf im Sinne Sennetts als Handwerk betrachtet werden kann, da er Disziplin, Selbstreflexion und das Streben nach Qualität erfordert. Es wird die Frage aufgeworfen, warum der Hebammenberuf trotz seiner handwerklichen Merkmale nicht in den Handwerkrollen aufgenommen wurde und warum eine Betrachtung der Anfänge des Hebammenberufs ab dem 15. Jh. Aufschluss darüber geben kann.
- Hebammen und andere Heilsberufe in der Frühen Neuzeit: Das zweite Kapitel beleuchtet die Vielfalt der Heilsberufe in der Frühen Neuzeit, einschließlich der Unterscheidung zwischen inner- und außerkörperlichen Tätigkeiten. Es wird die Frage aufgeworfen, warum Bader und Barbiere als Handwerker in Zünften organisiert waren, während Hebammen diese Möglichkeit verwehrt blieb.
- Handwerker in der Frühen Neuzeit: Das dritte Kapitel befasst sich mit der Entstehung und den Strukturen des Handwerks in der Frühen Neuzeit, einschließlich der Bedeutung von Zünften und Gesellenausbildungen.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit der historischen Entwicklung des Hebammenberufs in der Frühen Neuzeit im Vergleich zum traditionellen Handwerk. Sie analysiert die strukturellen Merkmale und Unterschiede beider Berufsfelder, beleuchtet die Rolle des patriarchalischen Systems und der christlichen Religion sowie die Auswirkungen auf die Berufsetablierung von Frauen. Schlüsselwörter sind: Hebamme, Handwerk, Frühe Neuzeit, Patriarchat, Zünfte, Gender, Heilsberufe, Professionalisierung.
Häufig gestellte Fragen
Wurde der Hebammenberuf historisch als Handwerk anerkannt?
Nein, obwohl der Beruf viele Merkmale eines Handwerks aufweist, wurde er nicht in die offiziellen Handwerksrollen aufgenommen.
Welche Rolle spielte das Patriarchat bei der Professionalisierung der Hebammen?
Das patriarchalische System des 15. und 16. Jahrhunderts erschwerte Frauen die berufliche Teilhabe und die Organisation in Zünften.
Was unterscheidet Hebammen von Badern und Barbieren in der Frühen Neuzeit?
Während Bader und Barbiere (männlich dominierte Berufe) als Handwerker in Zünften organisiert waren, blieb Hebammen diese institutionelle Anerkennung verwehrt.
Gilt die Hebammenarbeit nach heutigem Verständnis als Handwerk?
In einem soziologischen Sinne (nach Richard Sennett) ja, da sie Disziplin und Qualitätsstreben erfordert, rein rechtlich jedoch nicht.
Was sind „Lehrtöchter“?
So wurden Auszubildende im Hebammenwesen bezeichnet, als Hebammen begannen, ihr Wissen über die eigene Familie hinaus weiterzugeben.
- Quote paper
- Mario Kulbach (Author), 2011, Hebammenberuf und Handwerk , Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/174553