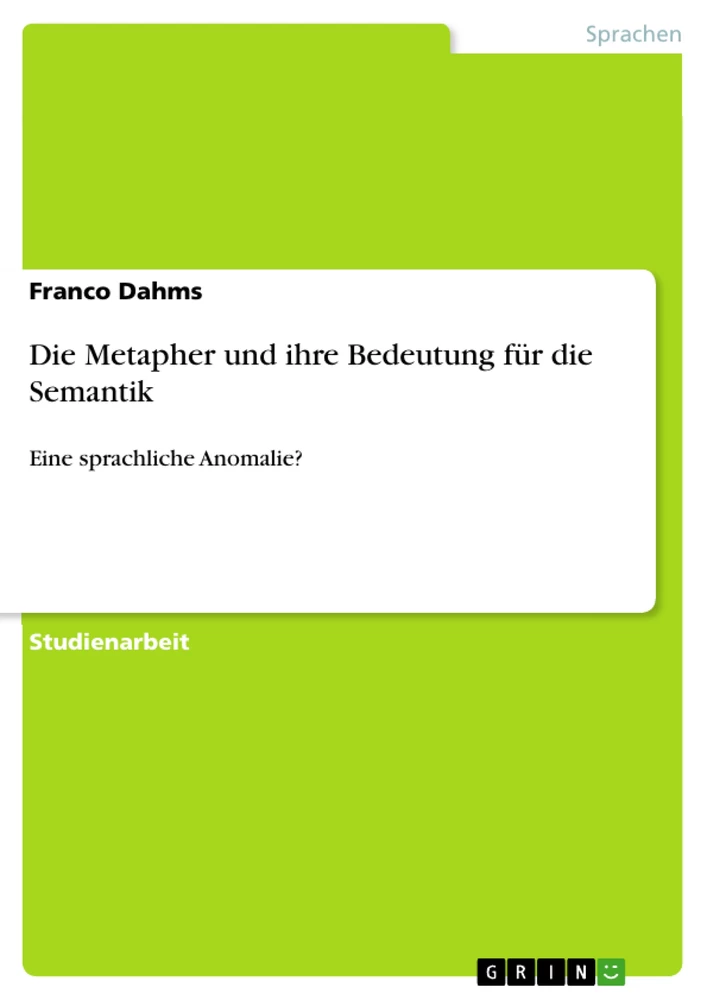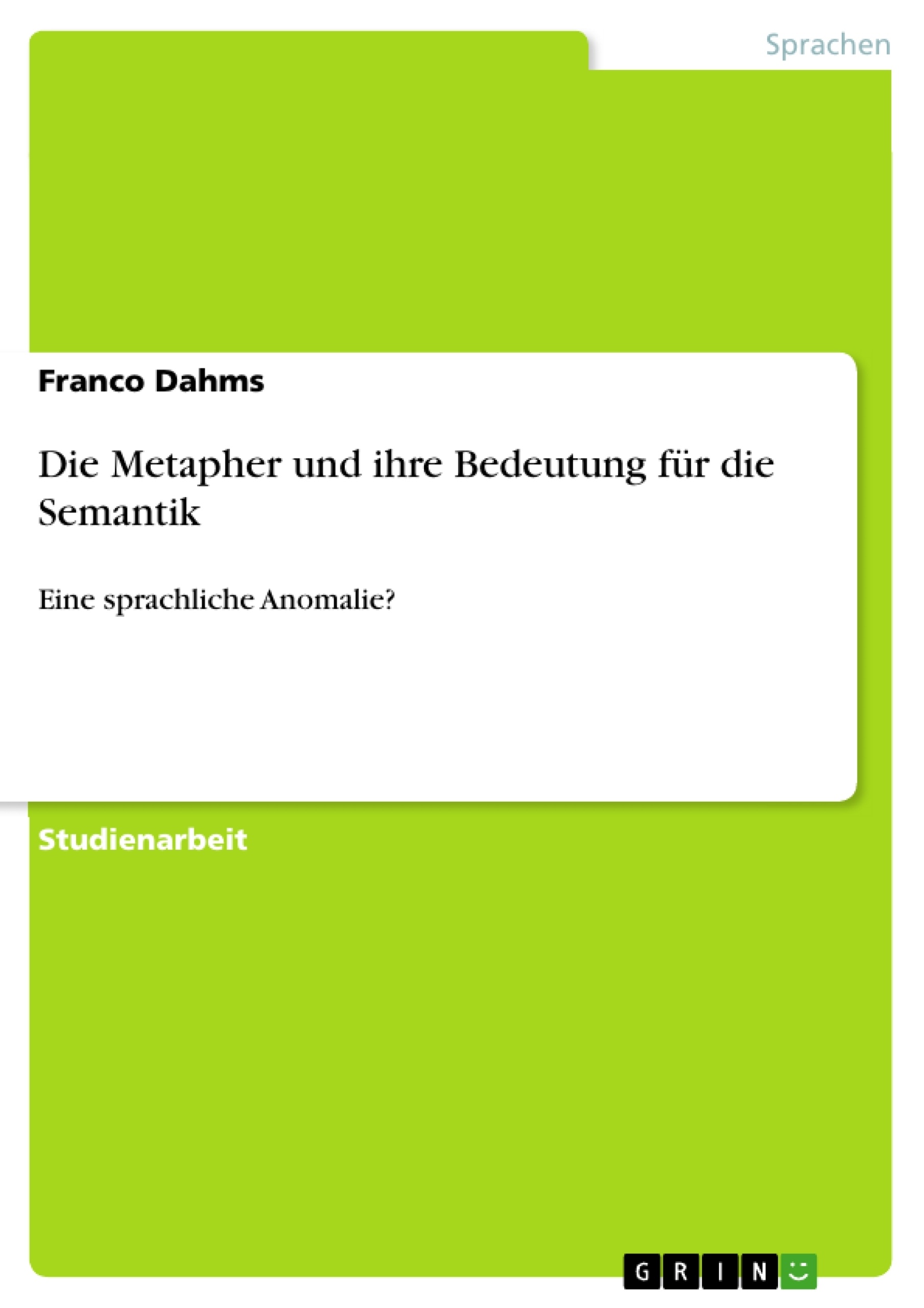Wir gebrauchen sie mitunter minutiös. Ob im Beruf, in der Freizeit, im Alltag, auf besonderen Veranstaltungen, beim Poesieren oder einfach nur beim Kaffeekranz mit den Großeltern.
Oft ist uns gar nicht bewusst, dass wir sie, und wenn, warum wir sie benützen. Wir tun es aus Gründen der Hervorhebung, der Veranschaulichung, der Beschönigung oder der Belebung und auch manchmal, weil uns nichts Besseres einfällt oder erst gar nicht existiert.
Die Rede ist von der Metapher.
„Metapher“ ist eine Entlehnung aus dem Griechisch-Lateinischem und deriviert vom Wort metaphorá, das zu gr. meta-phérein „anderswohin tragen; übertragen“ gehört. Gemeint ist also ein „übertragener, bildlicher Ausdruck“ . Wenn wir etwas verbalisieren und das Gesagte nicht wörtlich meinen, es also in einer uneigentlichen und übertragenen Weise verwenden, so referieren wir gewöhnlich auf diesen Umstand als metaphorisch bzw. auf diese Äußerung als metaphorisch gemeint. Dies ist ganz klar eine Sonderstellung, die der Metapher in unserer Sprache zukommt, nicht nur der des alltäglichen Lebens. Doch woher bezieht die Metapher ihre Wirkung, ihre Spezifität? Wenn gefragt ist, welche Domäne die Metapher darstellt, wird die Antwort Literatur und allem voraus Lyrik lauten. Mit dieser hat sie gemein, dass beide in ihrer sprachlichen Realisierung von der Norm abweichen. Das eine ist aber literarische Gattung, das andere sprachliches Mittel, dem diese Gattung ihre Wirkungskraft verdankt.
Jener sprachlichen (semantischen) Abweichung bzw. Anomalie widmet sich diese Hausarbeit.
Zu klären wird sein, worin diese Anomalie besteht. Daher wird in einem ersten Schritt die Funktionsweise der Metapher erläutert. Durch die Abgrenzung zu anderen mit der Metapher vergleichbaren Tropen, d.h. anderen „bildhaften Ausdrücken“ bzw. „sprachlichen Ausdrucksmitteln der uneigentlichen Rede“ , sollen noch bestehende Unklarheiten und Verwechslungsmöglichkeiten eliminiert werden, um letztlich einen tiefscharfe Definition der Metapher zu erhalten. Diese bildet alsdann die Grundlage und den Einstieg in die Metapherntheorie bzw. -geschichte, über die anschließend weitestgehend auf die Semantik fokussiert wird, um schlussfolgernd zu konstatieren, dass die Metapher nicht wirklich Anomalie und kein Mittel, sondern eher ein ‚Schöpfer’ unseres sprachlichen Systems ist.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 1.1 Funktionsweise der Metapher
- 1.2 Abgrenzung zu anderen Tropen
- 2. Linguistische Analyse
- 2.1 Metapherntheorie und -geschichte
- 2.2 Bedeutung für die Semantik
- 3. Resümee
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit untersucht die Metapher als sprachliches Phänomen und ihre Bedeutung für die Semantik. Ziel ist es, die Funktionsweise der Metapher zu erläutern, sie von anderen Tropen abzugrenzen und ihren Einfluss auf unser sprachliches Verständnis zu beleuchten. Die Arbeit konzentriert sich dabei auf die semantische Anomalie der Metapher und ihre Rolle in der Sprachproduktion und -rezeption.
- Funktionsweise der Metapher und ihre semantische Anomalie
- Abgrenzung der Metapher von anderen Tropen
- Metapherntheorie und -geschichte
- Bedeutung der Metapher für die Semantik
- Der soziologische Aspekt der Metapher und kulturelle Einflüsse auf die Interpretation
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema Metapher ein und beschreibt deren allgegenwärtige Verwendung in verschiedenen Kontexten. Sie betont die sprachliche Abweichung der Metapher von der Norm und kündigt die Zielsetzung der Arbeit an: die Untersuchung der semantischen Anomalie der Metapher und ihrer Rolle im sprachlichen System. Die Einleitung legt den Fokus auf die Klärung der Funktionsweise der Metapher und ihre Abgrenzung von ähnlichen Tropen, um eine präzise Definition zu erhalten. Schließlich wird die Bedeutung der Metapher für die Semantik und ihre Rolle als "Schöpfer" unseres sprachlichen Systems angedeutet.
1.1 Funktionsweise der Metapher: Dieser Abschnitt beschreibt die Metapher als bildlichen, übertragenen Ausdruck, der sich durch eine semantische Anomalie auszeichnet. Er erklärt das Konzept der zwei Ebenen (wörtliche und übertragene Bedeutung) und verwendet das Beispiel "Carlos es un tigre" um den Prozess der "Umdeutung" und Übertragung semantischer Merkmale zu veranschaulichen. Die Rolle des "tertium metaphorae" – der gemeinsamen Eigenschaft zwischen den beiden Begriffen – wird hervorgehoben, ebenso wie die Bedeutung des Weltwissens und gesellschaftlicher Konventionen für die Interpretation. Die Selektion der übertragenen Eigenschaften und die Möglichkeit von Fehlinterpretationen werden ebenfalls diskutiert.
Schlüsselwörter
Metapher, Semantik, sprachliche Anomalie, Trope, Übertragung, Bedeutung, Interpretation, "tertium metaphorae", Konnotation, soziologischer Aspekt, Weltwissen.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Seminararbeit: Metapher und Semantik
Was ist der Gegenstand dieser Seminararbeit?
Die Seminararbeit untersucht die Metapher als sprachliches Phänomen und ihre Bedeutung für die Semantik. Sie konzentriert sich auf die Funktionsweise der Metapher, ihre Abgrenzung von anderen Tropen und ihren Einfluss auf unser sprachliches Verständnis, insbesondere die semantische Anomalie der Metapher und ihre Rolle in der Sprachproduktion und -rezeption.
Welche Themen werden in der Seminararbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Schwerpunktthemen: Funktionsweise der Metapher und ihre semantische Anomalie, Abgrenzung der Metapher von anderen Tropen, Metapherntheorie und -geschichte, Bedeutung der Metapher für die Semantik und den soziologischen Aspekt der Metapher sowie kulturelle Einflüsse auf die Interpretation.
Wie ist die Seminararbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, einen linguistischen Analyseteil und ein Resümee. Die Einleitung führt in das Thema ein und beschreibt die Zielsetzung. Der linguistische Analyseteil befasst sich mit der Metapherntheorie, ihrer Bedeutung für die Semantik und ihrer Funktionsweise. Das Resümee fasst die Ergebnisse zusammen.
Wie wird die Funktionsweise der Metapher erklärt?
Die Funktionsweise der Metapher wird als bildlicher, übertragener Ausdruck beschrieben, der sich durch eine semantische Anomalie auszeichnet. Es werden die zwei Ebenen (wörtliche und übertragene Bedeutung) erläutert, und die Rolle des "tertium metaphorae" (gemeinsame Eigenschaft zwischen den beiden Begriffen) wird hervorgehoben. Die Bedeutung von Weltwissen und gesellschaftlichen Konventionen für die Interpretation sowie die Selektion der übertragenen Eigenschaften und die Möglichkeit von Fehlinterpretationen werden diskutiert.
Wie wird die Metapher von anderen Tropen abgegrenzt?
Die Seminararbeit geht auf die Abgrenzung der Metapher von anderen Tropen ein, um eine präzise Definition zu erhalten und die Besonderheiten der Metapher hervorzuheben. Genaueres zur Abgrenzung wird im Text beschrieben.
Welche Rolle spielt die Semantik in der Seminararbeit?
Die Semantik spielt eine zentrale Rolle, da die Arbeit die Bedeutung der Metapher für unser sprachliches Verständnis und ihren Einfluss auf die Semantik untersucht. Die semantische Anomalie der Metapher und ihre Rolle in der Sprachproduktion und -rezeption stehen im Fokus.
Welche Schlüsselwörter sind relevant für diese Seminararbeit?
Wichtige Schlüsselwörter sind: Metapher, Semantik, sprachliche Anomalie, Trope, Übertragung, Bedeutung, Interpretation, "tertium metaphorae", Konnotation, soziologischer Aspekt, Weltwissen.
Welche Kapitel gibt es und worum geht es in ihnen?
Die Arbeit umfasst eine Einleitung, welche das Thema einführt und die Zielsetzung beschreibt. Kapitel 1.1 beschreibt detailliert die Funktionsweise der Metapher. Weitere Kapitel behandeln die linguistische Analyse, inklusive Metapherntheorie und -geschichte sowie deren Bedeutung für die Semantik. Ein Resümee fasst die Ergebnisse zusammen.
- Quote paper
- Franco Dahms (Author), 2005, Die Metapher und ihre Bedeutung für die Semantik, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/174570