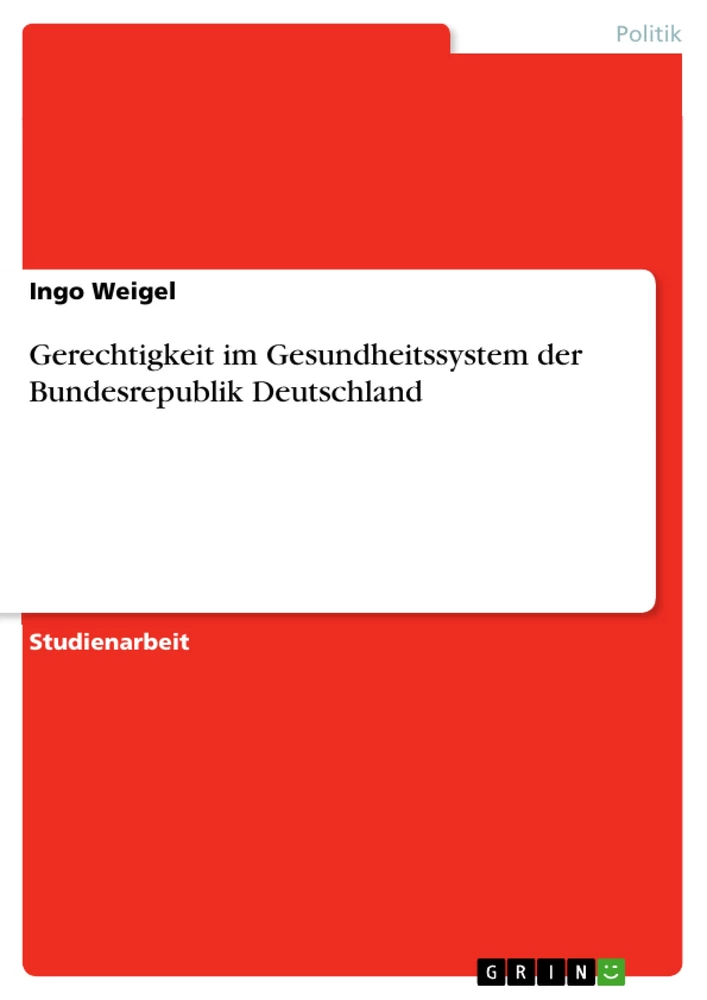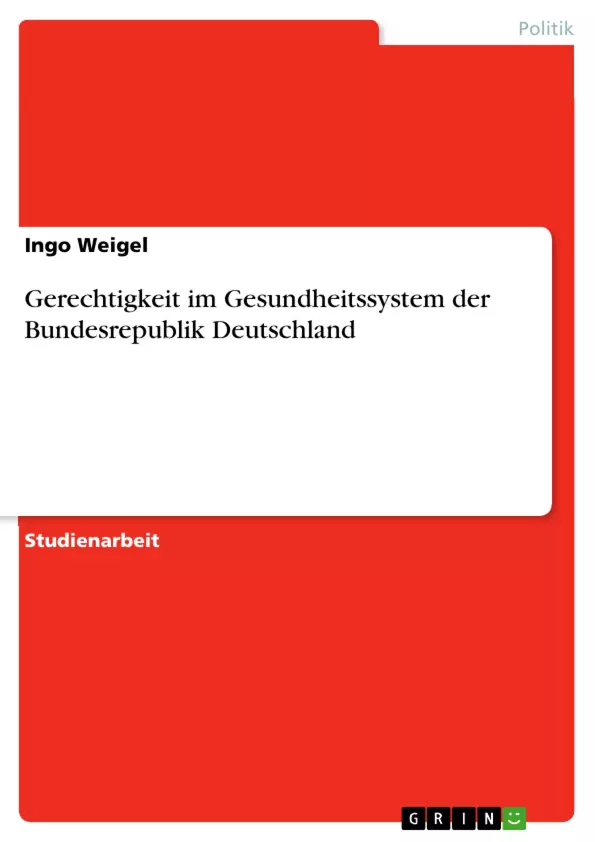Einleitung
Das Gesundheitswesen ist eines der größten politischen Streitthemen der letzten Jahre. Durch die demographische Entwicklung in Deutschland gibt es immer weniger Beitragszahler, die noch auf dem Arbeitsmarkt aktiv sind und immer mehr Rentner, die weniger Beiträge zahlen und mehr medizinische Versorgung in Anspruch nehmen. Zusätzlich zu den immer geringer werdenden Beiträgen kommt dazu, dass der medizinische Fortschritt mehr und mehr zunimmt und somit die Ausgabenseite immer stärker wächst. Das hat zur Folge, dass die Beitragssätze stetig steigen und der Staat mehr Geld zuschießen muss. Jede politische Partei hat ihre eigene Lösung für das Problem der Finanzierung des Gesundheitswesens. Doch wie sehen diese aus und sind sie gerechter und besser zur Finanzierung geeignet als das jetzige System? Im ersten Kapitel dieser Arbeit wird zuerst der Gerechtigkeitsbegriff unter Zuhilfenahme der beiden Gerechtigkeitstheorien von John Rawls und Robert Nozick erklärt. Darauf folgt die Entwicklung unseres Gesundheitssystems bis hin zur letzten Reform vom 01.01.2011. Diese aktuelle Ausgestaltung des Gesundheitssystems soll dann in ihren Hauptmerkmalen und besonders der neu geschaffenen Wahltarifen auf die Gerechtigkeitstheorien untersucht werden. Schließlich werden die zwei bekanntesten alternativen Finanzierungsmodelle besprochen. Dies wären zum einen die Bürgerversicherung und zum anderen die Kopfpauschale oder auch Gesundheitsprämie genannt. Ist eines von diesen Modellen geeignet um die immer größer werdende Finanzierungslücke auszugleichen?
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Was ist Gerechtigkeit?
- Die Gerechtigkeitstheorie von John Rawls
- Die Gerechtigkeitstheorie von Robert Nozick
- Das Gesundheitssystem der Bundesrepublik Deutschland
- Entwicklung des deutschen Gesundheitssystems
- Das Gesundheitssystem im Mittelalter
- Das Gesundheitssystem im Kaiserreich
- Das Gesundheitssystem der frühen BRD
- Finanzierung des Gesundheitssystems
- Gerechtigkeit im aktuellen System
- Alternative Finanzierungsmodelle
- Die Bürgerversicherung
- Die Gesundheitsprämie
- Fazit/Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert die Finanzierung des deutschen Gesundheitssystems im Kontext von Gerechtigkeitstheorien. Sie untersucht, inwiefern das aktuelle System und alternative Modelle den Prinzipien der Gerechtigkeit gerecht werden.
- Gerechtigkeitstheorien von John Rawls und Robert Nozick
- Entwicklung und Struktur des deutschen Gesundheitssystems
- Finanzierung des Gesundheitssystems und aktuelle Herausforderungen
- Bewertung des aktuellen Gesundheitssystems im Hinblick auf Gerechtigkeit
- Analyse von alternativen Finanzierungsmodellen (Bürgerversicherung, Gesundheitsprämie)
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik der Finanzierung des deutschen Gesundheitssystems ein und skizziert die zentralen Herausforderungen und Problemfelder. Das erste Kapitel definiert den Gerechtigkeitsbegriff anhand der Gerechtigkeitstheorien von John Rawls und Robert Nozick. Es werden die zentralen Prinzipien der beiden Theorien erläutert und deren Relevanz für die Beurteilung des Gesundheitssystems aufgezeigt. Der zweite Teil der Arbeit beleuchtet die Entwicklung des deutschen Gesundheitssystems von seinen Anfängen bis zur Gegenwart. Dabei werden die wichtigsten Reformen und Veränderungen hervorgehoben. Das dritte Kapitel analysiert die Finanzierung des aktuellen Gesundheitssystems und beleuchtet die aktuellen Herausforderungen und Problemfelder, wie zum Beispiel die steigenden Kosten und die demografische Entwicklung. Das vierte Kapitel beschäftigt sich mit alternativen Finanzierungsmodellen, wie der Bürgerversicherung und der Gesundheitsprämie. Die Stärken und Schwächen der einzelnen Modelle werden im Hinblick auf Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit analysiert.
Schlüsselwörter
Gerechtigkeit, Gesundheitssystem, Finanzierung, Bürgerversicherung, Gesundheitsprämie, John Rawls, Robert Nozick, Entwicklung, Finanzierungslücke, Beitragssätze, Sozialversicherung, Privatisierung, Solidarität, Gerechtigkeitstheorien
Häufig gestellte Fragen
Wie definiert John Rawls Gerechtigkeit im Kontext des Gesundheitswesens?
Rawls geht von einem „Schleier des Nichtwissens“ aus. Gerechtigkeit bedeutet für ihn, dass Institutionen so gestaltet sein müssen, dass sie den am wenigsten Begünstigten der Gesellschaft den größten Vorteil bringen (Differenzprinzip).
Was ist der Kern von Robert Nozicks Gerechtigkeitstheorie?
Nozick vertritt eine libertäre Position. Für ihn ist Gerechtigkeit eng mit individuellen Eigentumsrechten verknüpft; staatliche Eingriffe zur Umverteilung werden kritisch gesehen, solange der Erwerb von Gütern rechtmäßig erfolgte.
Warum steht die Finanzierung des deutschen Gesundheitssystems unter Druck?
Hauptursachen sind der demografische Wandel (weniger Beitragszahler, mehr Rentner) und der medizinische Fortschritt, der die Kosten für Behandlungen und Diagnostik stetig steigen lässt.
Was versteht man unter dem Modell der „Bürgerversicherung“?
Die Bürgerversicherung sieht vor, dass alle Bürger (auch Beamte und Selbstständige) in ein gemeinsames System einzahlen. Dabei werden meist nicht nur Erwerbseinkommen, sondern auch andere Einkunftsarten zur Beitragsbemessung herangezogen.
Was ist eine „Kopfpauschale“ oder Gesundheitsprämie?
Bei diesem Modell zahlt jeder Versicherte den gleichen absoluten Betrag, unabhängig vom Einkommen. Ein sozialer Ausgleich erfolgt dabei meist über Steuermittel statt über einkommensabhängige Beiträge.
Wie hat sich das deutsche Gesundheitssystem historisch entwickelt?
Die Entwicklung reicht von mittelalterlichen Hospitälern über die Einführung der Sozialversicherung unter Bismarck im Kaiserreich bis hin zu modernen Reformen wie dem GKV-Finanzierungsgesetz von 2011.
- Citation du texte
- Ingo Weigel (Auteur), 2011, Gerechtigkeit im Gesundheitssystem der Bundesrepublik Deutschland, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/174594