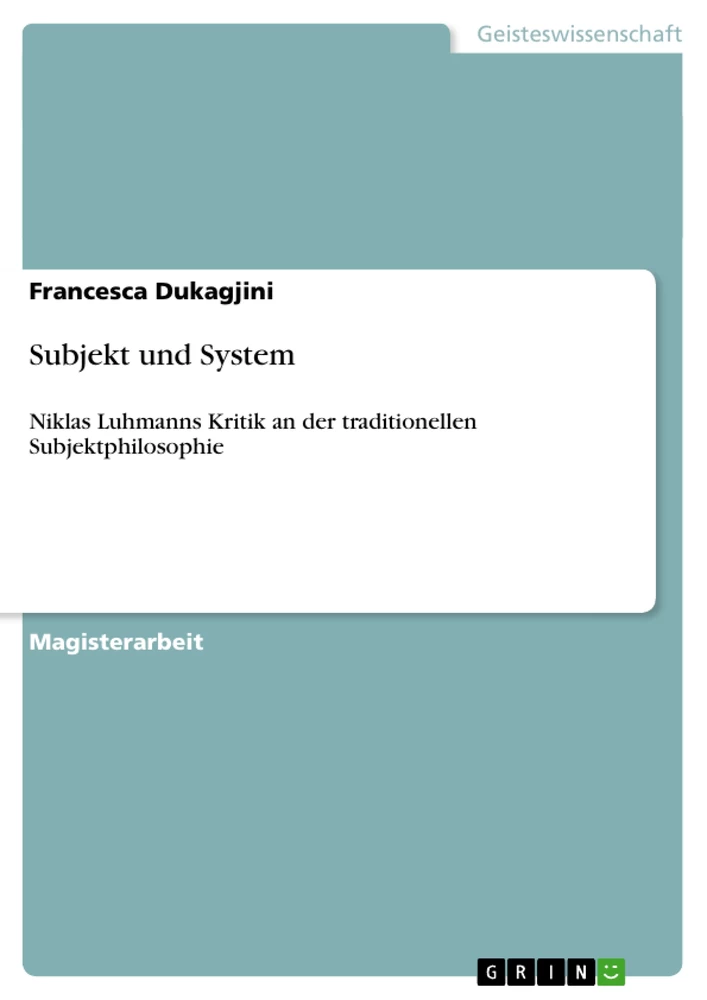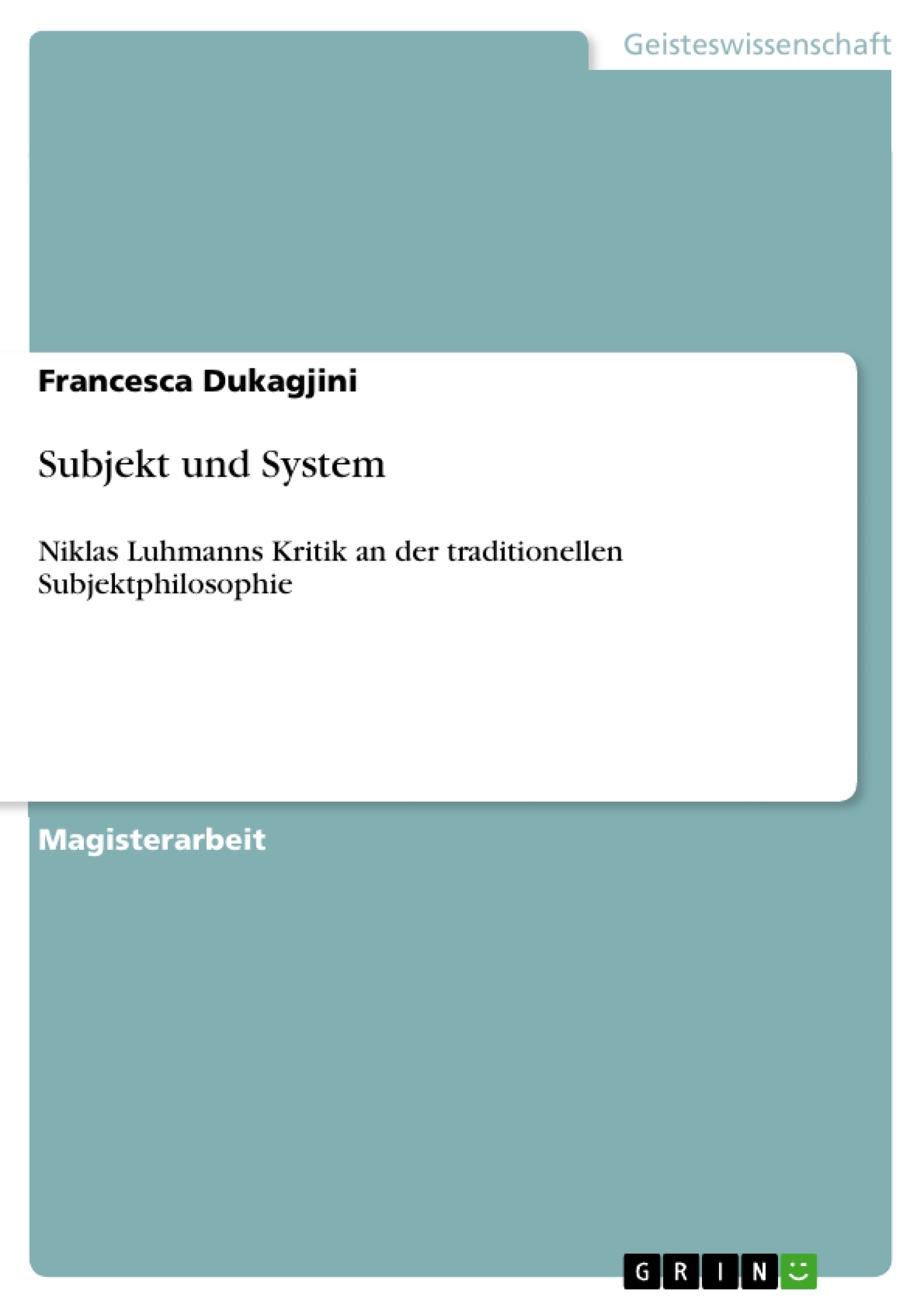Niklas Luhmanns Kritik an der traditionellen Subjektphilosophie ist einmal wegen der Fülle seiner eigenen Werke weitreichend, aber auch dank der philosophiegeschichtlichen Betrachtungen im Rahmen seiner Gesellschaftstheorie. So hat Luhmann deutlich machen können, dass eine Kritik des Subjekts sich ebenfalls gegen die Fundierung in Ontologie und Metaphysik richtet, und die kritische Auseinandersetzung in dieser Arbeit folgt in diesem Sinne seiner gesamtgesellschaftlichen Betrachtung.
Die Einleitungen in die Geschichte der Philosophie und in die Systemtheorie der ersten beiden Kapitel sollen verdeutlichen, weshalb gerade eine soziologische Theorie in der Lage sein soll, die Philosophie auf „blinde Flecken“ ihrer Beobachtung aufmerksam zu machen. Der Versuch einer Darstellung der wichtigsten Punkte der Kritik Luhmanns an Ontologie und Subjekt folgt. Wegen der Fülle subjekttheoretischer, aber eben auch metaphysischer und ontologischer Theorien der Philosophie soll im Anschluss – zur detaillierteren Analyse der „Treffsicherheit“ systemtheoretischer Vorwürfe – am Beispiel eines Philosophen - Edmund Husserls - die Erörterung der Kritik stattfinden, einmal, weil Luhmann sich in seiner Kritik mehrfach direkt gegen die phänomenologische Methode wendet, andererseits aber auch ein Reihe von Parallelen im Theoriegerüst aufzufinden sind.
Aus eben diesem Grund schließt sich die Frage an, ob Luhmann die von ihm kritisierten Probleme mit den Modifikationen und begrifflichen Verlagerungen selbst überwunden hat. Es handelt sich vor allem um das Problem der Intersubjektivität, die seiner Ansicht nach nicht aus dem Subjekt hervorgehen kann und begrifflich eine Paradoxie darstellt. In die Sprache der Theorie autopoietischer Systeme übersetzt, geht es um die Kopplung des Bewusstseinssystems mit dem Kommunikations-bzw. sozialen System. Auch bei Luhmann ist der Ausgangspunkt das geschlossen operierende System und der Übergang zur Sozialität scheint angesichts der von anderer Seite schon unterstellten monologischen Konstitution der Systeme ebenfalls problematisch. Es wird sich zeigen, dass Luhmann es nicht schafft, den Übergang vom selbstreferenziellen, psychischen System zu einem an Kommunikation teilnehmenden System zu konstruieren, ohne dass nicht das psychische System immer schon teilnehmend bzw. kommunizierend gewesen sein muss. Mit einer Erörterung dieses Sachverhalts und einem Ausblick auf einen möglichen Ausweg aus dem circulum vitiosus endet die Arbeit.
Inhaltsverzeichnis
- Vorwort
- Einleitung
- Die Ordnung des Kosmos
- Leib und Seele in Athen
- Die hellenistischen Naturwissenschaften
- Grenzen der Erkenntnis
- Der Zweifel
- Das Subjekt in humanistischer Tradition
- Das moralische Subjekt
- Subjektivität und Individualität
- Der Begriff der Ontologie
- Differenzen
- Zeit und Unordnung
- Das ökonomische Subjekt und seine Auflösung
- Das Subjekt wird pluralisiert und formalisiert
- Das biologische Selbst der Evolution
- Das Subjekt heute
- Das Selbst in systemtheoretischer Wandlung
- Selbstdarstellung in der Moderne
- Das Subjekt wird durch eine Differenz ersetzt
- ...und vom Gesellschaftsbegriff getrennt
- Die Reflexion
- Kognition
- Das Individuum und die autonome Gesellschaft
- Konsequenzen des verallgemeinerten Kognitionsbegriffs
- Die Individualisierung des Individuums
- Der Mensch als Objekt seiner Subjektivität
- Das Problem identischer Individuen
- Fazit
- Aspekte der Systemtheorie
- System und Umwelt
- Selbstreferenz und Autopoiese
- Selbstreferenz und Fremdreferenz
- Unterscheidung und Beobachtung
- Operationen und Selektionen
- Freiheit und Handlung
- Gedächtnis
- Prozesse und Strukturen
- Erwartungsstrukturen
- Reflexivität oder prozessuale Selbstreferenz
- Zeit
- Sinn und Information
- Handlung
- Konsequenzen der Radikalisierung des Sinnbegriffs
- Interpenetration statt Intersubjektivität
- Interaktionssysteme als Grundstein für Sozialität
- Kommunikation
- Reflexion
- Fazit
- Niklas Luhmanns Kritik an der traditionellen Subjektphilosophie
- Einführung
- Bewusstsein, Ich und Subjekt
- Symbolische Probleme des Subjekts
- Semantische Probleme des Subjekts
- Das Problem der Reflexion
- Der logisch unmögliche Begriff der Intersubjektivität
- Ontologie
- Operative Geschlossenheit statt ontologischer Paradoxien
- Luhmanns Einwände gegen Husserls Phänomenologie
- Evidenz und Bewusstsein
- Wahrnehmung und Kinästhesen
- Das Problem der Monadengemeinschaft
- Schlussfolgerungen
- Der Weg
- Selbstreferenz
- Alter Ego
- Doppelte Kontingenzen
- Systeme in der Umwelt des Systems
- Sinn als verbindende Form
- Die Erwartung als kontingente Lösung
- Sozialität lernen
- Ein möglicher Ausweg: Husserls Kinästhesen und Bråtens Dyade
- Die Annahme eines prä-kommunikativen Verstehens
- Das Problem der Kommunikation
- Fazit
- Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit analysiert Niklas Luhmanns Kritik an der traditionellen Subjektphilosophie und beleuchtet dabei insbesondere die Auswirkungen der systemtheoretischen Argumentation auf das Verständnis von Subjektivität, Interaktion und Sozialität. Sie untersucht, wie Luhmanns Kritik an der Subjektphilosophie zur Klärung der Frage beiträgt, wie die Interaktion von Individuen und Gesellschaften auf systemtheoretischer Grundlage begriffen werden kann.
- Die Kritik an der traditionellen Subjektphilosophie im Kontext der autopoietischen Systemtheorie
- Die Relevanz der systemtheoretischen Kritik für die Analyse sozialer Phänomene
- Die Herausforderungen der Konstruktion von Sozialität und Interaktion im Rahmen der Systemtheorie
- Die Rolle von Bewusstsein, Kommunikation und Sinn in der Konstruktion sozialer Systeme
- Die Problematik der Intersubjektivität und die Suche nach alternativen Erklärungsmustern
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik der Subjektkritik in der Systemtheorie ein und beleuchtet die historische Entwicklung des Subjektbegriffs. Das erste Kapitel behandelt die wichtigsten Aspekte der autopoietischen Systemtheorie und deren Kritik an der traditionellen Subjektphilosophie, insbesondere an Ontologie und Metaphysik. Das zweite Kapitel analysiert Luhmanns Kritik an der Phänomenologie Edmund Husserls, die als Beispiel für die "Treffsicherheit" systemtheoretischer Vorwürfe dient.
Das dritte Kapitel untersucht die Frage, ob Luhmann die von ihm selbst kritisierten Probleme durch seine systemtheoretischen Modifikationen und begrifflichen Verlagerungen tatsächlich überwindet. Es fokussiert dabei besonders auf die Problematik der Intersubjektivität und die Frage, ob sich ein Übergang vom psychischen zum sozialen System ohne eine implizite Annahme von Kommunikation und Teilhabe konstruieren lässt.
Schlüsselwörter
Die zentralen Schlüsselbegriffe dieser Arbeit sind Subjektphilosophie, Systemtheorie, Niklas Luhmann, Edmund Husserl, Autopoiesis, Selbstreferenz, Intersubjektivität, Kommunikation, Sozialität, Ontologie, Metaphysik, Phänomenologie, Bewusstsein, Sinn.
Häufig gestellte Fragen
Was kritisiert Niklas Luhmann an der traditionellen Subjektphilosophie?
Luhmann kritisiert die Fundierung des Subjekts in Ontologie und Metaphysik und ersetzt den Subjektbegriff durch die Unterscheidung von System und Umwelt.
Was ist das Problem der Intersubjektivität bei Luhmann?
Luhmann hält Intersubjektivität für eine Paradoxie. Er ersetzt sie durch den Begriff der „Interpenetration“ oder „strukturellen Kopplung“ zwischen Bewusstsein und Kommunikation.
Wie hängen psychische und soziale Systeme zusammen?
Psychische Systeme (Bewusstsein) und soziale Systeme (Kommunikation) sind füreinander Umwelt. Sie sind operativ geschlossen, aber strukturell aneinander gekoppelt.
Warum wird Edmund Husserl in der Arbeit herangezogen?
Husserls Phänomenologie dient als Beispiel für eine Subjektphilosophie, an der Luhmann seine Kritik festmacht, obwohl es interessante Parallelen in beiden Theoriegerüsten gibt.
Was ist ein autopoietisches System?
Ein System, das sich selbst aus seinen eigenen Elementen produziert und erhält (z. B. Kommunikation produziert neue Kommunikation).
- Quote paper
- Francesca Dukagjini (Author), 2007, Subjekt und System, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/174598