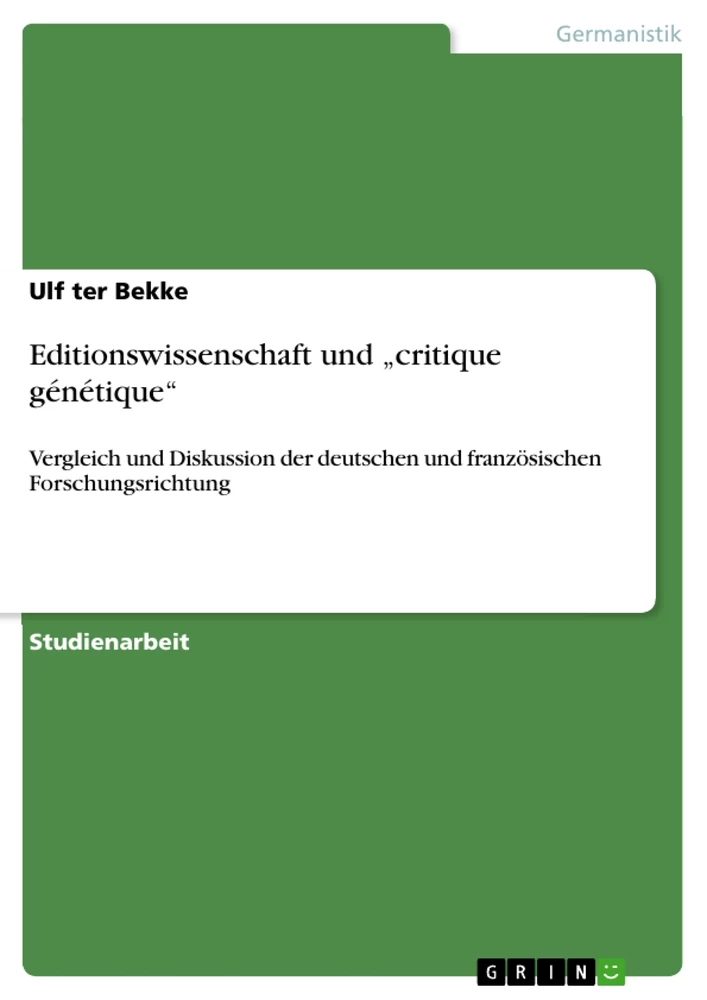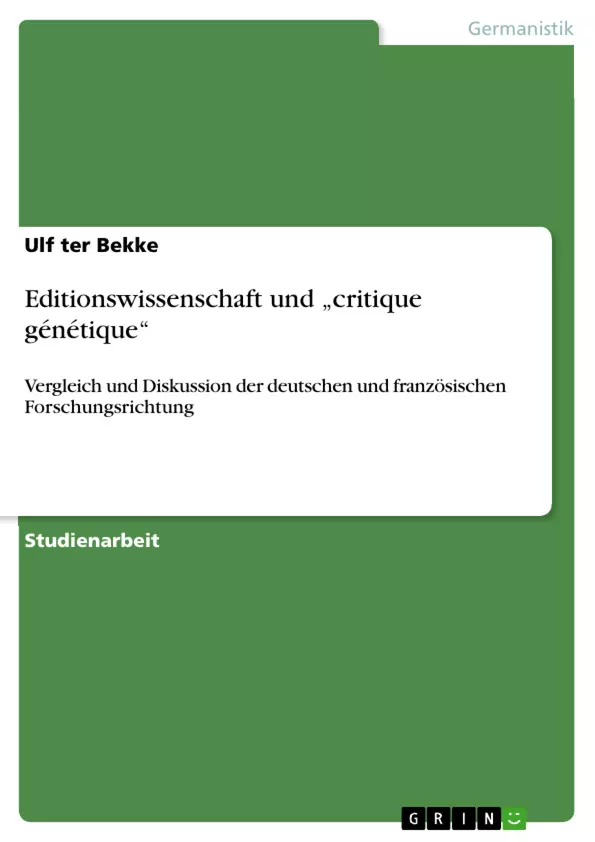1. Einleitung
„Wenn ein Autor behauptet, er habe im Rausch der Inspiration geschrieben, lügt er. Genie ist zehn Prozent Inspiration und neunzig Prozent Transpiration.“
Dieses Zitat von Umberto Eco verdeutlicht einen Umschwung bei der Betrachtung literarischer Werke, der bereits im 18. Jahrhundert begann. Das Schaffen eines Textes ist nicht mehr zurückzuführen auf eine einzigartige, geniale Inspiration des Autors, sondern vor allem auf lange, detaillierte Arbeit am Text. So ist es nicht verwunderlich, dass sich das Interesse der Rezipienten, aber noch mehr der Literaturwissenschaft auch auf eben diese Arbeit richtet: auf die Entwicklung eines Textes bis zur endgültigen Fassung sowie die Vorgehensweise des Autors während des Schaffensprozesses. Die Analyse von Handschriften und Vorstufen literarischer Texte kann viele interessante Fragen beantworten, Verständnishilfe schaffen und Vorraussetzungen für weitere Forschungen geben. So ist es zu beobachten, dass sich in verschiedenen Ländern verschiedene Methoden zur Untersuchung der Textgenese entwickelt haben, mit ebenso verschiedenen Leitmotiven und Zielen. Dies sind alles Gründe, weswegen eine nähere Beschäftigung mit dieser Thematik lohnenswert erscheint.
Diese Arbeit behandelt nun die deutsche Editionswissenschaft sowie die französische „critique génétique“. Die beiden Strömungen bieten sich sehr gut für einen Vergleich an, da sie in vielen Punkten miteinander Verbunden sind, sowohl inhaltlich als auch geschichtlich. Es sollen nun beide Forschungsrichtungen zuerst hinsichtlich ihrer Historie und Entwicklung vorgestellt werden um in die Thematik einzuleiten und ein ausreichendes Vorwissen zu schaffen. Folgend werden die Zielsetzungen und Arbeitsweisen der beiden Strömungen dargestellt, um genauere Einblicke in die Strömungen zu vermitteln – der Genauigkeit wird natürlich durch den Umfang dieser Arbeit eine enge Grenze gesetzt. Die so erlangten Kenntnisse sollen genutzt werden, um einen Vergleich zwischen beiden Forschungsrichtungen anzustellen. Diese Gegenüberstellung soll zum einen Gemeinsamkeiten herausarbeiten als auch Gegensätze aufzeigen. So ist der Vergleich ebenfalls ein passender Punkt, um Kritik an gewissen Eigenschaften und Methoden der Strömungen zu üben oder gegebenenfalls auch Kritiken entgegenzutreten. Schließlich sollen die gewonnenen Einsichten dazu genutzt werden, Möglichkeiten zur Annäherung und Verständigung zwischen der deutschen und der französischen Forschungsart zu finden. [...]
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Entstehungsgeschichte und Entwicklung beider Strömungen
- 2.1 Die deutsche Editionswissenschaft
- 2.2 Die französische „critique génétique“
- 3. Editionswissenschaft: Zielsetzung und Arbeitsweise
- 3.1 Die Ziele der Editionswissenschaft
- 3.2 Die Arbeitsweise der Editoren
- 4. „Critique génétique“: Zielsetzung und Arbeitsweise
- 4.1 Die Ziele der „critique génétique“
- 4.2 Die Arbeitsweise der Textgenetiker
- 5. Vergleich und Kritik: Editionswissenschaft vs. „critique génétique“
- 5.1 Gemeinsamkeiten der beiden Forschungsrichtungen
- 5.2 Unterschiede der beiden Forschungsrichtungen
- 5.3 Kritik: Editionswissenschaft vs. „critique génétique“
- 5.4 Wertschätzung
- 6. Möglichkeiten der Verständigung und Ausblick
- 6.1 Zur Verständigung und zum Konsens
- 6.2 Blick in die Zukunft
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit vergleicht die deutsche Editionswissenschaft und die französische „critique génétique“. Ziel ist eine genaue Gegenüberstellung beider Forschungsrichtungen, hinsichtlich ihrer Entstehungsgeschichte, Zielsetzungen, Arbeitsweisen, Gemeinsamkeiten und Unterschiede. Zusätzlich werden kritische Aspekte beleuchtet und Möglichkeiten der Annäherung und zukünftige Entwicklungen aufgezeigt.
- Entstehungsgeschichte und Entwicklung der Editionswissenschaft und der „critique génétique“
- Vergleich der Zielsetzungen und Arbeitsweisen beider Forschungsrichtungen
- Analyse der Gemeinsamkeiten und Unterschiede beider Ansätze
- Kritische Auseinandersetzung mit den Methoden und Ergebnissen
- Möglichkeiten der Verständigung und zukünftige Entwicklungen
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der Textgenese ein und erläutert die Bedeutung der Analyse von Handschriften und Vorstufen literarischer Texte für das Verständnis des Entstehungsprozesses. Sie begründet den Vergleich der deutschen Editionswissenschaft und der französischen „critique génétique“ aufgrund ihrer inhaltlichen und geschichtlichen Verknüpfungen und skizziert den Aufbau der Arbeit, der die historische Entwicklung, die Zielsetzungen und Arbeitsweisen, einen Vergleich und eine kritische Auseinandersetzung sowie einen Ausblick beinhaltet. Das zentrale Ziel ist eine präzise Gegenüberstellung beider Forschungsansätze.
2. Entstehungsgeschichte und Entwicklung beider Strömungen: Dieses Kapitel beleuchtet die historische Entwicklung der Auseinandersetzung mit der Textgenese. Es beschreibt, wie das Interesse an der Textgenese erst im Laufe der Zeit, mit dem Aufkommen der Romantik und nationaler Bewegungen, wuchs. Die Kapitel 2.1 und 2.2 gehen dann tiefer auf die jeweilige Entwicklung der deutschen Editionswissenschaft und der französischen „critique génétique“ ein, wobei die Entwicklung der deutschen Editionswissenschaft als eine Revision altphilologischer Vorgehensweisen auf neuere Texte charakterisiert wird, während die Entwicklung der „critique génétique“ noch weiter erörtert werden müsste.
3. Editionswissenschaft: Zielsetzung und Arbeitsweise: Dieses Kapitel beschreibt die Ziele und die Arbeitsweise der deutschen Editionswissenschaft. Es werden die Bestrebungen nach einer methodisch fundierten Textkritik und die Entwicklung des wissenschaftlichen Apparats zur Dokumentation textgenetischer Entwicklungen behandelt. Dabei wird die Bedeutung der Berücksichtigung aller Textfassungen und die Herausforderung, die Textentstehung für den Benutzer nachvollziehbar darzustellen, hervorgehoben. Das Kapitel analysiert verschiedene Ansätze und deren Erfolge und Misserfolge, die letztlich zur Entwicklung methodisch festerer Grundsätze führten.
4. „Critique génétique“: Zielsetzung und Arbeitsweise: Dieses Kapitel widmet sich den Zielen und der Arbeitsweise der französischen „critique génétique“. Ähnlich wie im vorhergehenden Kapitel werden die Methoden und Zielsetzungen detailliert beschrieben, wobei der Fokus auf den spezifischen Ansätzen der französischen Schule liegt. Die Kapitel 4.1 und 4.2 würden dann jeweils die Ziele und die Arbeitsweisen im Detail beleuchten.
5. Vergleich und Kritik: Editionswissenschaft vs. „critique génétique“: Dieses Kapitel stellt einen detaillierten Vergleich zwischen der deutschen Editionswissenschaft und der französischen „critique génétique“ an. Es werden sowohl Gemeinsamkeiten als auch Unterschiede in den Ansätzen, Methoden und Zielen herausgearbeitet. Die Kapitel 5.1, 5.2 und 5.3 würden die Gemeinsamkeiten, Unterschiede und die jeweilige Kritik an beiden Forschungsansätzen analysieren. Kapitel 5.4 würde dann die Wertschätzung der jeweiligen Ansätze behandeln.
6. Möglichkeiten der Verständigung und Ausblick: Das Kapitel befasst sich mit der Frage nach der Verständigung und dem Konsens zwischen beiden Forschungsrichtungen. Es wird analysiert, wie eine Annäherung der beiden Ansätze erreicht werden kann. Die Kapitel 6.1 und 6.2 würden dann die Verständigung und den Ausblick in die Zukunft behandeln.
Schlüsselwörter
Editionswissenschaft, critique génétique, Textgenese, Textkritik, Variantenverzeichnung, Handschriften, philologische Methoden, wissenschaftlicher Apparat, Textentstehung, Vergleichende Literaturwissenschaft.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zum Vergleich von Editionswissenschaft und Critique Génétique
Was ist der Inhalt dieser Arbeit?
Diese Arbeit vergleicht die deutsche Editionswissenschaft und die französische „critique génétique“. Sie untersucht Entstehungsgeschichte, Zielsetzungen, Arbeitsweisen, Gemeinsamkeiten und Unterschiede beider Forschungsrichtungen. Kritische Aspekte werden beleuchtet, und Möglichkeiten der Annäherung sowie zukünftige Entwicklungen werden aufgezeigt.
Welche Themen werden im Einzelnen behandelt?
Die Arbeit umfasst folgende Themen: Entstehungsgeschichte und Entwicklung der Editionswissenschaft und der „critique génétique“, Vergleich der Zielsetzungen und Arbeitsweisen beider Forschungsrichtungen, Analyse der Gemeinsamkeiten und Unterschiede, kritische Auseinandersetzung mit Methoden und Ergebnissen, sowie Möglichkeiten der Verständigung und zukünftige Entwicklungen.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit ist in sechs Kapitel gegliedert: Einleitung, Entstehungsgeschichte und Entwicklung beider Strömungen (inkl. Unterkapitel zu deutscher Editionswissenschaft und französischer „critique génétique“), Editionswissenschaft: Zielsetzung und Arbeitsweise, „Critique génétique“: Zielsetzung und Arbeitsweise, Vergleich und Kritik: Editionswissenschaft vs. „critique génétique“ (inkl. Unterkapitel zu Gemeinsamkeiten, Unterschieden, Kritik und Wertschätzung), und Möglichkeiten der Verständigung und Ausblick (inkl. Unterkapitel zu Verständigung und Zukunftsblick).
Was sind die Ziele der Editionswissenschaft laut dieser Arbeit?
Die Editionswissenschaft zielt auf eine methodisch fundierte Textkritik und die Entwicklung eines wissenschaftlichen Apparats zur Dokumentation textgenetischer Entwicklungen. Es geht darum, alle Textfassungen zu berücksichtigen und die Textentstehung für den Benutzer nachvollziehbar darzustellen.
Was sind die Ziele der „critique génétique“ laut dieser Arbeit?
Die Arbeit beschreibt die Ziele und die Arbeitsweise der französischen „critique génétique“ detailliert, wobei der Fokus auf den spezifischen Ansätzen der französischen Schule liegt. Die genauen Ziele werden in Kapitel 4.1 näher erläutert.
Welche Gemeinsamkeiten und Unterschiede bestehen zwischen Editionswissenschaft und „critique génétique“?
Kapitel 5 widmet sich einem detaillierten Vergleich beider Forschungsrichtungen. Es werden sowohl Gemeinsamkeiten als auch Unterschiede in Ansätzen, Methoden und Zielen herausgearbeitet. Die spezifischen Gemeinsamkeiten und Unterschiede werden in den Unterkapiteln 5.1 und 5.2 analysiert.
Wie wird die Kritik an beiden Forschungsansätzen behandelt?
Kapitel 5.3 analysiert die Kritik an den Methoden und Ergebnissen sowohl der Editionswissenschaft als auch der „critique génétique“.
Wie wird die Wertschätzung beider Ansätze betrachtet?
Kapitel 5.4 behandelt die Wertschätzung der jeweiligen Ansätze.
Wie wird die Frage der zukünftigen Entwicklungen behandelt?
Kapitel 6, insbesondere Kapitel 6.2, befasst sich mit den Möglichkeiten der Verständigung zwischen beiden Forschungsrichtungen und gibt einen Ausblick auf zukünftige Entwicklungen.
Welche Schlüsselwörter sind relevant für diese Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Editionswissenschaft, critique génétique, Textgenese, Textkritik, Variantenverzeichnung, Handschriften, philologische Methoden, wissenschaftlicher Apparat, Textentstehung, vergleichende Literaturwissenschaft.
- Quote paper
- Ulf ter Bekke (Author), 2010, Editionswissenschaft und „critique génétique“ , Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/174618