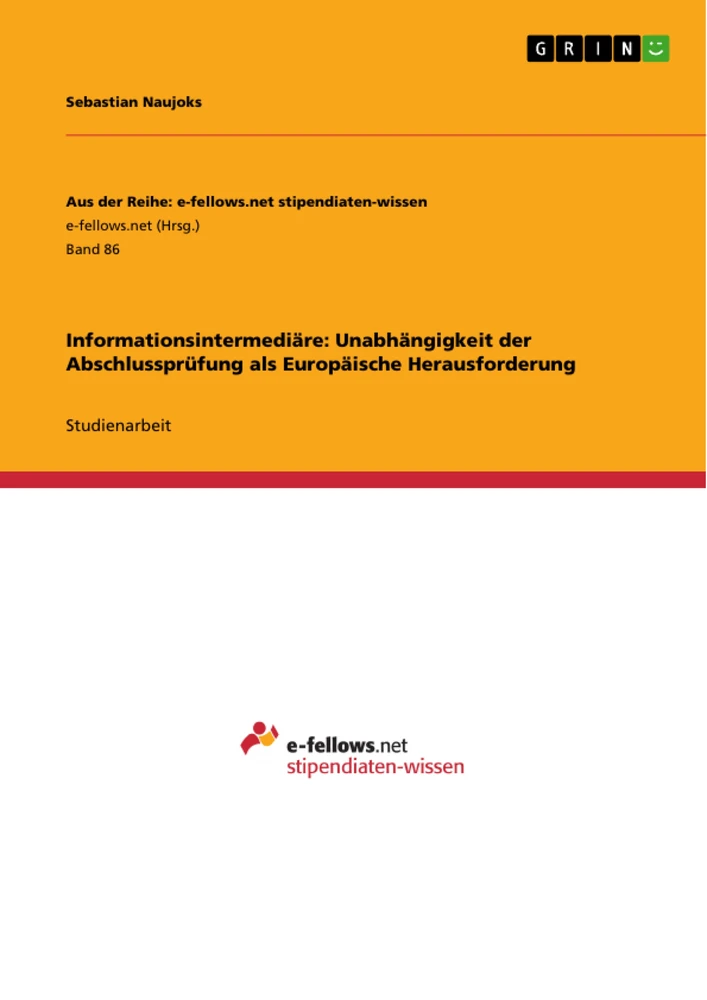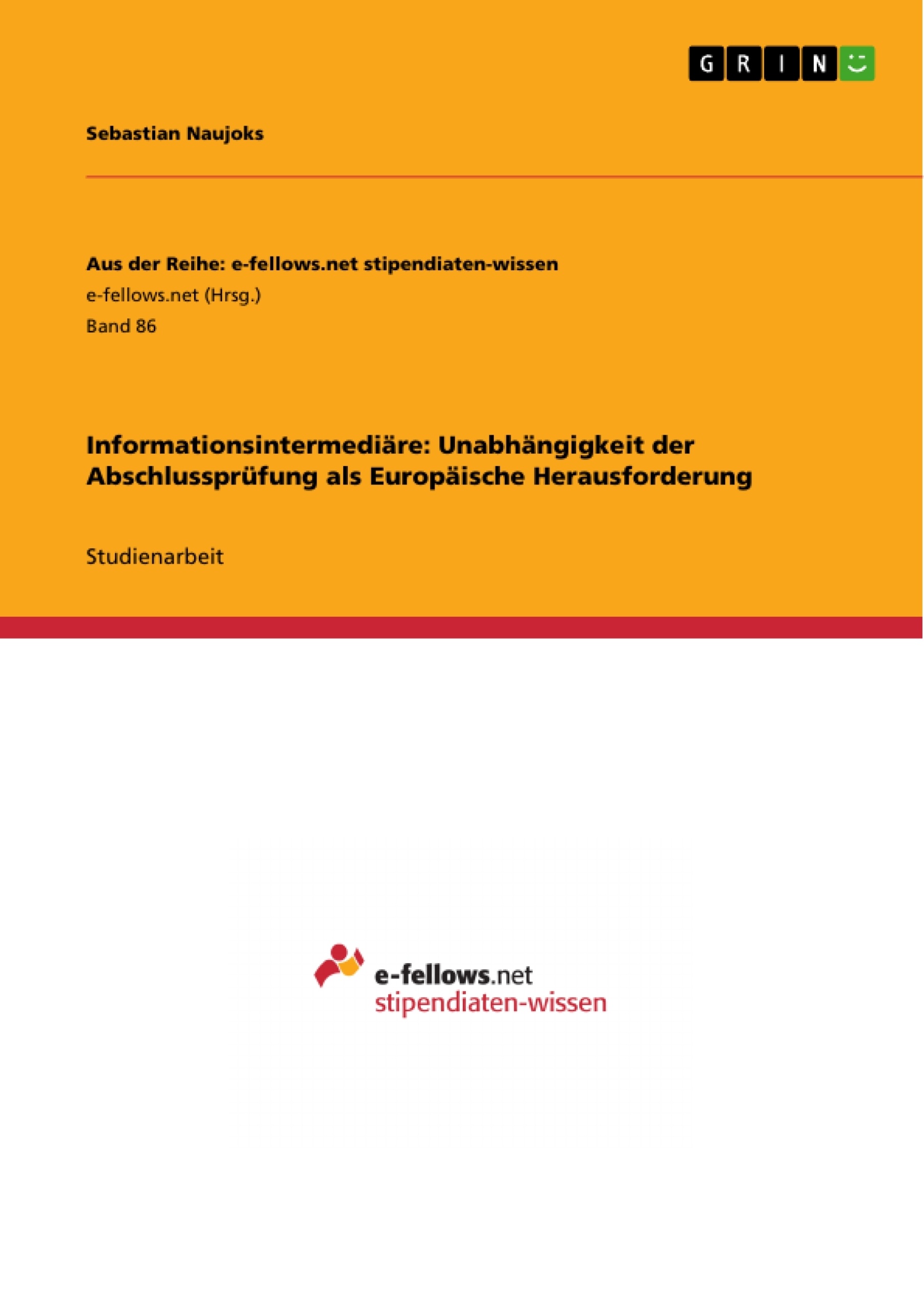„Wir sind kein Business – wir sind Abschlussprüfer. Wir üben eine Tätigkeit im öffentlichen Interesse aus, und daran hat sich alles auszurichten.“ Mit dieser Aussage bringt der Vorstandsvorsitzende der mittelständigen BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Holger Otte, die aktuelle Diskussion um die Unabhängigkeit der Abschlussprüfer auf den Punkt. Den Anstoß dazu gab das Grünbuch der Europäischen Kommission zum weiteren Vorgehen im Bereich der Abschlussprüfung vom 13.10.2010. Regelmäßige Kritik am Abschlussprüfer und der Institution Abschlussprüfung folgte nicht nur aus spektakulären Zusammenbrüchen und Schieflagen von Unternehmen, die als Ergebnis ihrer letzten Jahresabschlussprüfung einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erhalten hatten, sondern auch aus der Tatsache, dass im Rahmen der Finanzkrise die Bilanzen der Großbanken trotz immenser Verluste in den Jahren 2007 bis 2009 von den jeweiligen Abschlussprüfern uneingeschränkt testiert wurden. Hierdurch schien das Fundament auf dem die Abschlussprüfung gründet – nämlich das Vertrauen der Öffentlichkeit in die Unabhängigkeit, die Integrität und
den Sachverstand des Abschlussprüfers - erschüttert. Können Eigen- und Fremdkapitalgeber nicht mehr in die von den Unternehmen veröffentlichten und vom Abschlussprüfer testierten
Informationen vertrauen, kann das zu empfindlichen Beeinträchtigungen auf dem Kapitalmarkt führen. Da der nationale Gesetzgeber um die Bedeutung der Unabhängigkeit der Abschlussprüfer seit langem weiß, wurde er unter Berücksichtigung europäischer Vorgaben und internationaler Erfordernisse bereits mehrfach tätig, um die Unabhängigkeit der Abschlussprüfer und das Vertrauen in die Abschlussprüfung zu stärken. Die rechtliche Einordnung dieser Arbeit beschränkt sich mithin allein auf die Darstellung der derzeit geltenden Regelungen zur Prüferunabhängigkeit. Nach Darstellung der rechtlichen und ökonomischen Grundlagen zur Prüferunabhängigkeit soll der Schwerpunkt dieser Arbeit auf einer rechtsökonomischen Analyse ausgewählter Vorschläge der Kommission aus ihrem Grünbuch vom 13.10.2010 liegen. Dazu werden zunächst die Voraussetzungen, wann eine regulatorische Regelungsoption einer marktbasierten Lösung vorzuziehen ist, dargestellt. Vor diesem Hintergrund soll anschließend insbesondere die Zweckdienlichkeit der diskutierten Maßnahmen für die Stärkung der Prüferunabhängigkeit untersucht werden. Abschließend werden die gewonnenen Erkenntnisse thesenförmig zusammengefasst.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Die Bedeutung der Abschlussprüfung für das Funktionieren von Märkten
- 2.1 Informationsasymmetrie als Grundlage der Abschlussprüfung
- 2.2 Die Bedeutung des Abschlussprüfers im Kontext der „Agency-Theorie“
- 3 Das Problem der Unabhängigkeit des Abschlussprüfers
- 3.1 Die Gefahren der Abhängigkeit
- 3.2 Die Bedeutung der Qualität der Abschlussprüfung
- 3.3 Die Rolle der Europäischen Union und der IFAC
- 4 Die aktuelle Situation in der Bundesrepublik Deutschland
- 4.1 Die gesetzliche Regelung zur Abschlussprüfung
- 4.2 Die Praxis der Abschlussprüfung in Deutschland
- 4.3 Probleme der aktuellen Situation
- 5 Lösungsansätze der Europäischen Kommission
- 5.1 Das Grünbuch der Europäischen Kommission
- 5.2 Kritische Betrachtung der Vorschläge
- 6 Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit analysiert die Rolle der Abschlussprüfung in der Europäischen Union und beleuchtet die Herausforderungen, die sich aus der Sicherstellung der Unabhängigkeit der Abschlussprüfer ergeben. Sie untersucht die Bedeutung der Abschlussprüfung für das Funktionieren von Märkten und die „Agency-Theorie“ sowie die potenziellen Gefahren der Abhängigkeit von Abschlussprüfern. Des Weiteren werden die aktuellen gesetzlichen Regelungen in Deutschland, die Praxis der Abschlussprüfung und die Lösungsansätze der Europäischen Kommission im Kontext des „Grünbuchs“ zur Abschlussprüfung diskutiert.
- Die Bedeutung der Abschlussprüfung für das Funktionieren von Märkten
- Die Herausforderungen der Sicherstellung der Unabhängigkeit der Abschlussprüfer
- Die Rolle der Europäischen Union und der IFAC bei der Regulierung der Abschlussprüfung
- Die aktuelle Situation in Deutschland und die Probleme der bestehenden Regelungen
- Die Lösungsansätze der Europäischen Kommission im Kontext des „Grünbuchs“
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel führt in die Thematik der Abschlussprüfung ein und erläutert die Bedeutung der Abschlussprüfung für das Funktionieren von Märkten. Dabei wird insbesondere auf die Informationsasymmetrie zwischen Unternehmen und Anlegern eingegangen. Das zweite Kapitel beleuchtet das Problem der Unabhängigkeit des Abschlussprüfers. Es werden die Gefahren der Abhängigkeit, die Bedeutung der Qualität der Abschlussprüfung und die Rolle der Europäischen Union und der IFAC im Kontext der Regulierung der Abschlussprüfung diskutiert. Das dritte Kapitel widmet sich der aktuellen Situation in der Bundesrepublik Deutschland. Hier werden die gesetzlichen Regelungen zur Abschlussprüfung, die Praxis der Abschlussprüfung in Deutschland und die Probleme der aktuellen Situation analysiert. Das vierte Kapitel behandelt die Lösungsansätze der Europäischen Kommission im Kontext des „Grünbuchs“ zur Abschlussprüfung. Es werden die wichtigsten Vorschläge des Grünbuchs vorgestellt und kritisch beleuchtet.
Schlüsselwörter
Abschlussprüfung, Unabhängigkeit, Informationsasymmetrie, Agency-Theorie, Europäische Union, IFAC, Grünbuch, Regulierung, Deutschland, gesetzliche Regelungen, Praxis, Lösungsansätze, Qualität, Transparenz, Marktfunktion, Anleger, Unternehmen.
Häufig gestellte Fragen
Warum ist die Unabhängigkeit der Abschlussprüfer so wichtig?
Die Unabhängigkeit ist das Fundament für das Vertrauen der Öffentlichkeit in die Bilanzierung. Nur ein unabhängiger Prüfer garantiert die Integrität der Informationen, die für Kapitalgeber essenziell sind.
Was kritisiert die EU-Kommission im „Grünbuch“ zur Abschlussprüfung?
Das Grünbuch von 2010 hinterfragt die Unabhängigkeit der Prüfer, insbesondere nach der Finanzkrise, in der Banken trotz hoher Verluste uneingeschränkte Bestätigungsvermerke erhielten.
Was besagt die „Agency-Theorie“ im Kontext der Abschlussprüfung?
Die Theorie beschreibt das Spannungsfeld zwischen Unternehmenseignern (Prinzipale) und Management (Agenten). Der Abschlussprüfer fungiert als Kontrollinstanz, um Informationsasymmetrien abzubauen.
Welche Gefahren bestehen bei einer Abhängigkeit des Prüfers?
Es besteht die Gefahr von Interessenkonflikten (z. B. durch Beratungsleistungen beim selben Mandanten), die dazu führen können, dass Mängel in der Bilanz nicht aufgedeckt oder verschwiegen werden.
Wie ist die aktuelle rechtliche Lage in Deutschland geregelt?
Die Arbeit beschreibt die derzeit geltenden gesetzlichen Regelungen zur Prüferunabhängigkeit in Deutschland, die unter Berücksichtigung europäischer Vorgaben mehrfach verschärft wurden.
- Quote paper
- Sebastian Naujoks (Author), 2011, Informationsintermediäre: Unabhängigkeit der Abschlussprüfung als Europäische Herausforderung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/174701