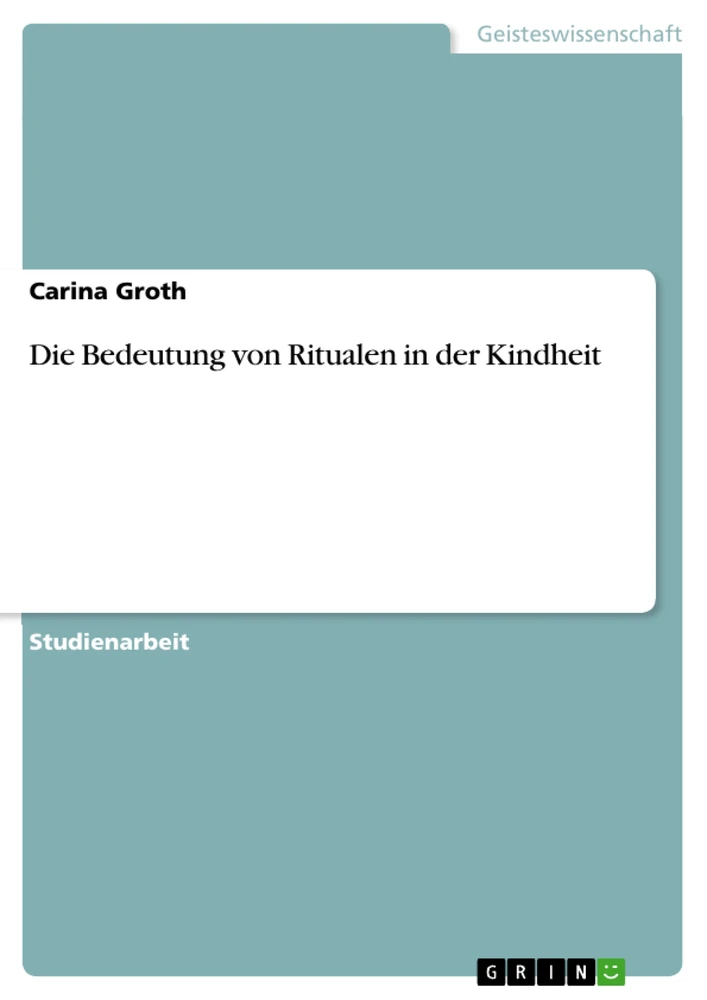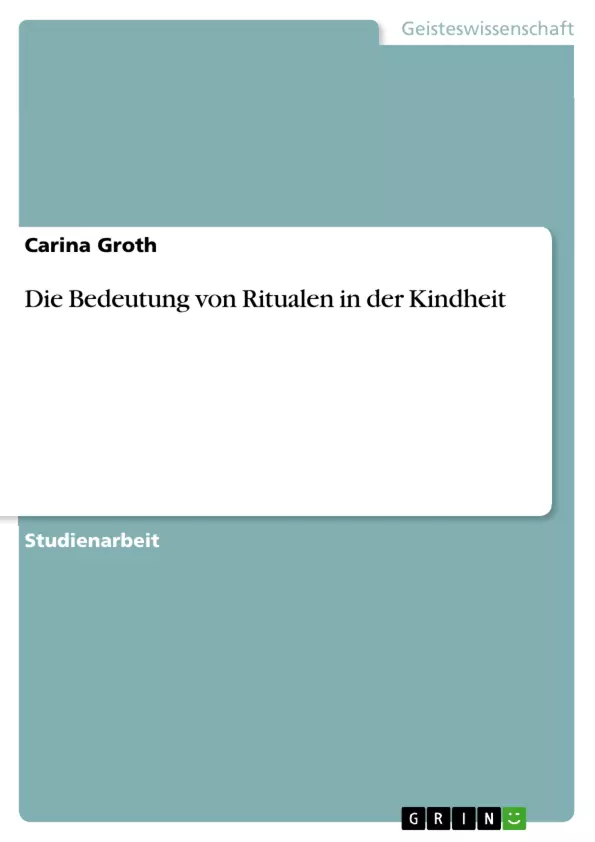Was machen Rituale aus und wozu dienen sie? Was genau ist ein Ritual? Diese Fragen werde ich im ersten Teil meiner Arbeit klären. Zunächst werde ich dabei den Begriff Ritual klären und gehe dabei auf die Ansichten von Arnold van Gennep und Lorelies Singerhoff näher ein.
Im nächsten Teil geht es um die Rituale in der Kindheit. Hier gibt es viele rituelle Handlungen und Abläufe, die zu bestimmten Ereignissen stattfnden (z.B. Namensgebung, Einschulung, die „Gutenachtgeschichte“). Aber was bedeuten Rituale für Kinder?
Viele Abläufe nehmen in der Kindheit rituellen Charakter an, sei es durch die Erwachsenen vorgegeben oder durch die Kinder selbst, die sich selbst oft ihre eigenen kleinen Rituale schaffen. Warum das so ist und warum Rituale so wichtig für Kinder sind, werde ich im Folgenden beschreiben. Dabei gehe ich auf die verschiedenen Entwicklungsbereiche ein, die im Kindergarten auch durch Rituale gefördert werden. Mit
Hilfe von rituellen Handlungssequenzen können nämlich unterschiedliche Fähigkeiten bei Kindern sensibilisiert und ausgebaut werden. Hierzu finden sich dann im weiteren Verlauf meiner Arbeit zwei Praxisbeispiele aus dem Alltag in Kindertageseinrichtungen.
Zunächst wird der „Morgenkreis“ als Beispiel angeführt, den man in den meisten Einrichtungen für Kinder findet. Da ich während meiner Ausbildung zur Erzieherin und auch später wieder in einem Montessori-Kinderhaus gearbeitet habe, stelle ich die Stille-Übung vor, die ich für ein gutes Beispiel einer rituellen Handlungssequenz sehe.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Klärung des Begriffs Ritual
- Rituale in der Kindheit
- Warum sind Rituale wichtig für Kinder?
- Praxisbeispiel: Morgenkreis
- Praxisbeispiel: Stille-Übung
- Fazit
- Literatur
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit der Bedeutung von Ritualen in der Kindheit. Ziel ist es, den Begriff Ritual zu klären, die Bedeutung von Ritualen in der kindlichen Entwicklung aufzuzeigen und anhand von Praxisbeispielen aus dem Kindergartenalltag zu verdeutlichen, wie Rituale die Entwicklung von Kindern fördern können.
- Definition des Begriffs „Ritual“
- Rituale als wichtige Elemente der kindlichen Entwicklung
- Rituale im Kindergartenalltag
- Förderung von Fähigkeiten durch Rituale
- Beispiele für rituelle Handlungssequenzen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die zentralen Fragen der Arbeit vor, die sich mit dem Begriff des Rituals und seiner Bedeutung in der Kindheit beschäftigen. Im ersten Teil wird der Begriff „Ritual“ mithilfe der Ansichten von Arnold van Gennep und Lorelies Singerhoff geklärt. Dabei werden die Übergangsriten als wichtige Elemente der menschlichen Entwicklung und die Bedeutung von Ritualen bei diesen Übergängen erläutert.
Der zweite Teil der Arbeit konzentriert sich auf die Bedeutung von Ritualen in der Kindheit. Hier werden die vielfältigen rituellen Handlungen und Abläufe in der Kindheit beschrieben und deren Bedeutung für die kindliche Entwicklung herausgestellt. Es wird hervorgehoben, wie Rituale verschiedene Entwicklungsbereiche von Kindern fördern können, z.B. die sprachliche und soziale Entwicklung, die Kreativität und die emotionale Stabilität.
Die beiden Praxisbeispiele, der „Morgenkreis“ und die „Stille-Übung“, veranschaulichen die Anwendung von Ritualen im Kindergartenalltag und zeigen konkret, wie Rituale die Entwicklung von Kindern positiv beeinflussen können.
Schlüsselwörter
Rituale, Kindheit, Entwicklung, Übergangsriten, Kindergartenalltag, Morgenkreis, Stille-Übung, Arnold van Gennep, Lorelies Singerhoff.
Häufig gestellte Fragen
Warum sind Rituale für Kinder so wichtig?
Rituale bieten Kindern Struktur, Sicherheit und Orientierung im Alltag und fördern verschiedene Entwicklungsbereiche wie Sprache, Sozialverhalten und emotionale Stabilität.
Was versteht man unter dem Begriff „Übergangsriten“?
Nach Arnold van Gennep sind dies Rituale, die den Übergang von einem Lebensstadium in ein anderes begleiten, wie etwa die Einschulung oder die Namensgebung.
Welche Praxisbeispiele aus dem Kindergarten werden genannt?
Die Arbeit führt den „Morgenkreis“ und die „Stille-Übung“ (nach Montessori) als Beispiele für rituelle Handlungssequenzen an.
Können Kinder eigene Rituale schaffen?
Ja, neben den von Erwachsenen vorgegebenen Abläufen neigen Kinder oft dazu, sich selbst kleine rituelle Handlungen zu schaffen, um ihre Welt zu ordnen.
Welche Autoren beeinflussten die Ritual-Definition in dieser Arbeit?
Die Arbeit stützt sich primär auf die Ansichten von Arnold van Gennep und Lorelies Singerhoff.
- Arbeit zitieren
- Carina Groth (Autor:in), 2009, Die Bedeutung von Ritualen in der Kindheit, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/174709